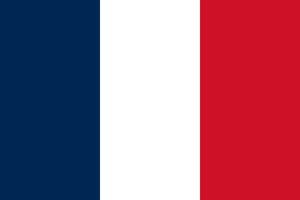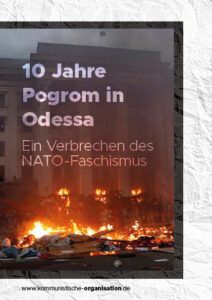Bürgerliche Faschismustheorien in der BRD
Themen: Faschismus
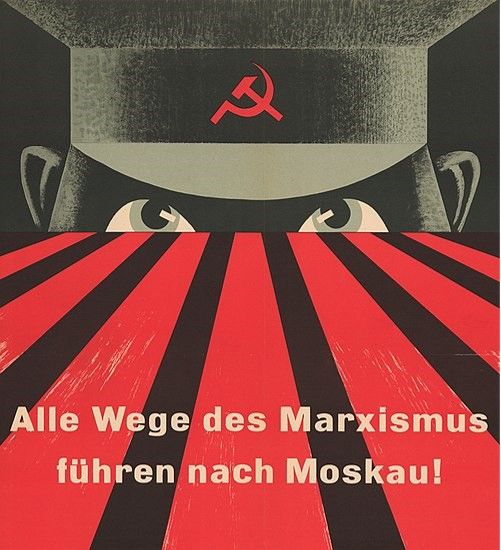
Von Michael Gellrich
Wir veröffentlichen in den kommenden Wochen die einzelnen Kapitel und Abschnitte der Broschüre „Faschismus – Kommunistische und bürgerliche Analysen im Überblick“ als Fließtexte Online. Die gesamte Broschüre ist bereits auf der Website verfügbar.
Nach der Niederlage des Faschismus 1945 herrschte in Deutschland zunächst weitgehend Einigkeit über die Ursachen der faschistischen Diktatur und die daraus abzuleitenden Konsequenzen. Antifaschisten aus dem Widerstand, der Emigration und den Konzentrationslagern erkannten, dass die Herrschaft des Faschismus durch die Unterstützung maßgeblicher gesellschaftlicher Eliten aus Militär, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft ermöglicht wurde. Daraus folgte die Forderung nach einer umfassenden Säuberung dieser Machtpositionen sowie nach einer demokratischen Kontrolle wirtschaftlicher Strukturen bis hin zu Sozialisierungsmaßnahmen. Diese Einsichten spiegelten sich in politischen Programmen, Landesverfassungen und Beschlüssen der Jahre 1946/47 wider.[1]
Anfangs verfolgten auch die Alliierten eine konsequente Entnazifizierungspolitik, was sich in den Urteilen der Nürnberger Prozesse gegen führende Vertreter des NS-Regimes, der Wehrmacht und des Großkapitals zeigte.[2] Doch mit dem Beginn des Kalten Krieges veränderte sich die Politik der Westmächte grundlegend. Die Entnazifizierung wurde weitgehend eingestellt, und vormals belastete Eliten kehrten in Führungspositionen zurück, da sie als Verbündete im Kampf gegen den Kommunismus galten.[3] Dies hatte weitreichende Folgen für die politische Kultur der Bundesrepublik. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Faschismus wurde zugunsten eines antikommunistischen Geschichtsbildes zurückgedrängt. Die in der Bundesrepublik vertretenen Faschismus-Theorien sind somit immer im Kontext der politischen Rahmenbedingungen und ideologischen Interessen zu berücksichtigen.[4]
Im folgenden Abschnitt werden zentrale bürgerliche Faschismustheorien vorgestellt und kritisch beleuchtet – von klassischen Konzepten wie der Führertheorie über die Totalitarismus-Doktrin und Deutungen des Faschismus als Reaktion bis hin zu Ansätzen der Frankfurter Schule, die auch psychoanalytische Elemente einbeziehen. Abschließend wird die ideologische Neuausrichtung der Faschismustheorien nach 1990 eingeordnet.
Führertheorie
Nach der Niederlage der faschistischen Hauptmächte Deutschland, Italien und Japan im Jahr 1945 war der Faschismus angesichts der ungeheuren Verbrechen, die er begangen hatte, in den Augen der Weltöffentlichkeit und der Mehrheit des deutschen Volkes vollständig diskreditiert. Mit ihm waren auch all jene diskreditiert, die ihn getragen und unterstützt hatten.[5]
Dennoch war ein Großteil der Historiker – ebenso wie Juristen, Wirtschaftswissenschaftler und Germanisten –, die an den Universitäten lehrten und die fachwissenschaftliche Diskussion bestimmten, zuvor ideologische Wegbereiter oder gar Unterstützer des Faschismus gewesen. Nach 1945 sahen sie sich daher gezwungen, Interpretationen zu verbreiten, die ihre eigene Unschuld betonten – ebenso wie die Unschuld der bürgerlichen Gesellschaft, der sie sich verpflichtet fühlten.[6]
Eine besonders wirksame Strategie bot die sogenannte Führertheorie. Diese schob die gesamte Verantwortung auf Adolf Hitler sowie einige wenige führende Nationalsozialisten wie Göring, Goebbels und Himmler, während alle anderen als wehrlose Befehlsempfänger oder gar als Opfer der Führerdiktatur dargestellt wurden. Diese Theorie erfüllte eine primär defensive Funktion: Sie diente dazu, die Mitverantwortung der Eliten aus Wirtschaft, Militär und Bürokratie zu verschleiern, indem sie Hitler als allmächtigen Alleinherrscher inszenierte. Dadurch konnte der Faschismus als singuläres Ereignis erscheinen, das mit dem Tod Hitlers und der Kapitulation Deutschlands endgültig beendet war. In diesem Sinne argumentierten Historiker wie Golo Mann und Joachim Fest [7], die behaupteten, der deutsche Faschismus sei quasi übergangslos verschwunden. Damit wurde die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Bedingungen und Interessen, die zur faschistischen Diktatur führten, systematisch ausgehebelt.[8]
Mit dem Verbot der KPD im Jahr 1956 entstand zudem ein effektives Mittel, um jede kritische Äußerung als „kommunistisch beeinflusst“ und damit als potenziell verbotswürdig zu brandmarken. Dies schuf ein Klima der Repression: In den 1950er Jahren gab es jährlich etwa 15.000 politische Ermittlungsverfahren, was eine auch nur halbwegs offene wissenschaftliche Diskussion nahezu unmöglich machte.[9]
Zwar verschwand die Führertheorie nicht völlig, doch blieb sie, was sie im Rahmen der bürgerlichen Geschichtsschreibung stets gewesen war: ein zentrales Erklärungsmuster, das historische Entwicklungen auf das Wirken einzelner „großer Persönlichkeiten“ zurückführt – ob im positiven oder negativen Sinne. Als solches fügte sie sich nahtlos in die ideologische Abwehr materialistischer Analysen ein, die Produktions- und Klassenverhältnisse in den Mittelpunkt stellen.[10]
Die eigentliche Kernfrage all dieser Deutungen war und ist, ob die faschistische Diktatur und ihre Politik aus den gesellschaftlichen Bedingungen, Kräften und Interessen heraus erklärt werden – also aus den kapitalistischen Strukturen – oder ob sie primär auf die Person Hitlers, irrationale Massenbewegungen oder zufällige Verkettungen von Umständen zurückgeführt wird. Eine besondere Rolle spielt dabei die Bonapartismusthese[11], die eine Brücke zwischen diesen Deutungsmustern schlägt. Indem sie den Faschismus als Ergebnis einer spezifischen Krisensituation begreift, in der ein scheinbar „autonomer“ Führer zwischen den Klassen vermittelt, lenkt sie tendenziell von den grundlegenden kapitalistischen Strukturen ab, die den Faschismus erst hervorgebracht haben. Dadurch wird der Monopolkapitalismus aus der direkten Verantwortung genommen und der Faschismus als eine Art Ausnahmeerscheinung dargestellt – ein Deutungsmuster, das sich mit den Interessen bürgerlicher Geschichtsschreibung deckt.
Die Totalitarismus-Doktrin
Die Weigerung, den Faschismus als eine spezifische Form kapitalistischer Herrschaft zu analysieren, führte in den 1950er Jahren zur Etablierung der Totalitarismustheorie als neuer dominanter Faschismusinterpretation. Diese löste die Führertheorie in ihrer hegemonialen Rolle ab und erfüllte eine doppelte Funktion: Einerseits suggerierte sie eine scheinbare antifaschistische Kontinuität, indem sie die noch starken antifaschistischen Stimmungen der Bevölkerung aufgriff. Andererseits funktionalisierte sie diese, indem sie den Kommunismus zur eigentlichen totalitären Hauptgefahr erklärte. Die DDR wurde nun als moderne Ausprägung des Totalitarismus dargestellt – zugespitzt in der politischen Parole: „Hitler ist tot, Ulbricht aber lebt.“[12]
Ursprung und Funktion der Totalitarismustheorien
Der Begriff „Totalitarismus“ entstand in den 1920er Jahren und wurde von bürgerlichen Kreisen verwendet, um die faschistischen Diktaturen in Italien und später auch in Deutschland zu charakterisieren. Diese Regime wurden als „totalitär“ bezeichnet, da sie durch spezifische Machtmechanismen eine umfassende Kontrolle über das gesellschaftliche und private Leben ihrer Bürger ausübten.[13] Die Totalitarismustheorien greifen ein Konzept auf, das bereits nach 1917 gezielt als ideologisches Mittel gegen die Russische Revolution entwickelt wurde. Im Mittelpunkt steht dabei die Gegenüberstellung von Demokratie und Diktatur, die bis heute weit verbreitet ist. Demokratie werde demnach durch eine Vielzahl miteinander verflochtener Strukturen und Entscheidungsprozesse gekennzeichnet, während Diktatur als ihr diametraler Gegensatz dargestellt werde.[14]
Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs und insbesondere in der Zeit des Kalten Krieges eigneten sich Vertreter eines aggressiven Antikommunismus die Totalitarismustheorie an, um die sozialistische Staatsmacht der Sowjetunion zu diskreditieren. Während die UdSSR zunächst als alliierter Partner galt, wurde sie zunehmend als zukünftiger Hauptgegner der aufstrebenden imperialistischen Macht USA betrachtet. Nach 1945 wurde die Theorie weiterentwickelt und als ideologisches Instrument genutzt, um eine angebliche Wesensgleichheit zwischen Faschismus auf der einen und Sozialismus bzw. Kommunismus auf der anderen Seite zu konstruieren. Durch bewusste Verzerrung historischer Fakten wurde behauptet, beide Systeme hätten gemeinsame gesellschaftliche Wurzeln, würden ähnliche Staats- und Gesellschaftsformen hervorbringen und sich gleichermaßen durch repressive Methoden auszeichnen, die die persönliche Freiheit und Würde unterdrückten.[15]
Eine zentrale Grundlage dieser Doktrin ist die Entstellung der Geschichte nach 1789 und vor allem nach der Oktoberrevolution 1917. Revolutionäre Umbrüche werden nicht als Ausdruck gesellschaftlicher Umwälzungen, sondern als Wegbereiter von „Terror“ und „Diktatur“ gedeutet – eine Deutung, die tief in der bürgerlichen Geschichtsschreibung verwurzelt ist. Ergänzt wird sie durch soziologische Theorien über die „moderne Industrie- und Massengesellschaft“ sowie durch philosophische Konzepte individueller Freiheit aus bürgerlicher Perspektive. In den kapitalistischen Kernstaaten avancierte die Totalitarismustheorie zur dominierenden Form des Antikommunismus, da sie den Faschismus scheinbar ebenso verurteilt und dadurch auch in demokratischen Kreisen Anklang findet.[16]
Der Historiker Kurt Gossweiler fasst die Problematik dieser Theorien treffend zusammen: „Es ist kennzeichnend für die völlige Unwissenschaftlichkeit der Totalitarismustheorie, dass sie, um Wesensgleichheit zu beweisen, nicht etwa inhaltliche Merkmale der als, totalitär‘ gleichgesetzten Herrschaftssysteme untersucht, sondern krampfhaft nach äußerlichen Ähnlichkeiten fahndet oder aber solche einfach erfindet.“ [17]
Die Gleichsetzung von Faschismus und Sozialismus als antikommunistische Strategie
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Theorie durch die Arbeiten von Hannah Arendt, Carl Friedrich und Zbigniew Brzeziński eine systematische und einflussreiche Gestalt.
Hannah Arendt wurde durch ihr Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951) zu einer zentralen Figur in den ideologischen Auseinandersetzungen des Kalten Krieges. In ihrem Werk stellte sie Nationalsozialismus und Kommunismus als zwei Varianten totalitärer Herrschaft dar – eine These, die insbesondere im westlichen Diskurs großen Anklang fand. Als Autorin zahlreicher Artikel, die in von der CIA finanzierten Zeitschriften erschienen, geriet sie in die ideologischen Grabenkämpfe jener Zeit.[18]
Hannah Arendt argumentierte, dass Terror das zentrale Element totalitärer Herrschaft ist, das nicht nur zur Sicherung der Macht, sondern zur vollständigen Umformung der menschlichen Natur dient. Die Lager (Konzentrationslager, Arbeitslager) seien das zentrale Herrschaftsinstrument, um Individuen in gleichgeschaltete, spontaneitätslose Wesen zu verwandeln. Arendt sah eine ideologische Parallele zwischen dem Nationalsozialismus und dem Bolschewismus: Während die Nazis sich auf die „Naturgesetze“ der Rassenideologie beriefen, rechtfertigten die Bolschewisten die Vernichtung der „absterbenden Klassen“ mit den „objektiven Gesetzen der Geschichte“.
Arendt plädierte dafür, den Begriff „totalitär“ nur auf Herrschaftsformen anzuwenden, die sowohl Terror als auch eine umfassende ideologische Mobilisierung der Bevölkerung beinhalten. Sie betonte, dass der Totalitarismus aus der Atomisierung der Gesellschaft hervorging, die durch den Zerfall der Klassengesellschaft im 19. Jahrhundert begünstigt wurde. Diese Zersplitterung führte zu einer Entfremdung der Individuen und schuf den Nährboden für autoritäre Bewegungen. In einem totalitären System verliert der Mensch die Fähigkeit zur freien, kreativen Entfaltung und wird in eine „spontaneitätslose“ Gleichförmigkeit gezwungen, wodurch die Macht des Regimes gesichert wird. Nach Stalins Tod sei die Sowjetunion im „strengen Sinne“ nicht mehr totalitär gewesen, sondern nur noch eine autoritäre Einparteienherrschaft.[19]
Carl Joachim Friedrich und Zbigniew Brzezinski entwickelten gemeinsam eine weiterführende Theorie des Totalitarismus, die sie 1956 in ihrem Werk Totalitarian Dictatorship and Autocracy veröffentlichten. Ihr Ziel war es, eine systematische, empirisch überprüfbare Klassifikation totalitärer Systeme zu erstellen. Sie betrachteten den Totalitarismus dabei als eine historisch einzigartige Staatsform.
| Zur Analyse der totalitären Herrschaft entwickelten Friedrich und Brzezinski sechs zentrale Merkmale, die ihrer Ansicht nach für jede totalitäre Diktatur charakteristisch sind: 1. eine herrschende Ideologie, die der Bevölkerung keine Möglichkeit lässt, eine eigene abweichende Meinung zu äußern, und die alle Aspekte und Bereiche des menschlichen Lebens erfasst; 2. eine ideologisch strukturierte Massenpartei, die, auf einen einzelnen Parteiführer ausgerichtet und streng hierarchisch organisiert, noch über der Staatsbürokratie steht; 3. ein polizeistaatliches System der totalen Kontrolle und des Terrors durch Repressalien nicht nur gegen „äußere“ Feinde, sondern vor allem auch gegen bestimmte Gruppen der eigenen Bevölkerung mit der Absicht, ein psychologisches Klima zu schaffen, in dem niemand Zweifel und Kritik am herrschenden Regime zu artikulieren wagt; 4. strenge Zensur aller Massenmedien — Presse, Film, Funk und Fernsehen —, aber auch der Literatur und überhaupt der Kunst bis hin zur Reglementierung der Architektur und schließlich sogar der Wissenschaft; 5. das Monopol auf Waffenbesitz und dessen lückenlose Kontrolle; 6. eine totale Kontrolle der gesamten Wirtschaft. |
Friedrich argumentierte, dass der Totalitarismus als Regierungsform nur unter den Bedingungen des 20. Jahrhunderts entstehen konnte – geprägt durch Demokratie, moderne Technologie und das Erbe des Christentums. In dieser Hinsicht sei er nicht einfach eine modernisierte Form der Autokratie, sondern eine neue, eigenständige Staatsform. Friedrich und Brzezinski betonen, dass sich totalitäre Systeme – ob nationalsozialistisch oder bolschewistisch – in ihren wesentlichen Strukturen ähnlich sind wie andere Regierungsformen. Insgesamt hatte Totalitarian Dictatorship and Autocracy einen enormen Einfluss auf die Totalitarismusforschung und galt als das meistzitierte Standardwerk dieses Forschungsfeldes. Spätere Theorien greifen die Grundideen von Friedrich und Brzezinski auf, variieren sie jedoch oder ergänzen sie um neue Perspektiven. Diese Kriterien wurden so gewählt, dass sie eine Vergleichbarkeit zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion suggerieren.[20]
Fazit
Die Totalitarismustheorie geht von der Grundannahme aus, dass es zwei gegensätzliche politische Systeme gebe: die „freie Welt“ der liberalen Demokratien auf der einen Seite und die „totalitären Systeme“ auf der anderen – gleichgültig, ob es sich dabei um faschistische oder sozialistische Staaten handelt. Entscheidend sei dabei nicht die Frage nach den gesellschaftlichen Eigentumsverhältnissen oder der Klassenmacht, sondern das Maß, in dem der Staat in das individuelle Leben eingreife. Damit erhebt sich die bürgerliche Demokratie zum alleinigen Maßstab für Legitimität – und erklärt alles, was diesen Maßstab nicht erfüllt, zu potenzieller Gefahr.
Doch diese Theorie ist keine neutrale wissenschaftliche Analyse, sondern ein ideologisches Konstrukt. Ihr Zweck war und ist die Delegitimierung des Sozialismus – durch seine Gleichsetzung mit dem historisch längst moralisch verurteilten Faschismus. So wird nicht der Faschismus im Kapitalismus, sondern der Sozialismus im Antifaschismus verdächtig gemacht. Die Totalitarismustheorie verschleiert, dass es sich bei Faschismus und Sozialismus um diametral entgegengesetzte Gesellschaftsformationen handelt: Während der Faschismus eine Form der brutalen kapitalistischen Klassenherrschaft ist, strebt der Sozialismus deren Überwindung an. Die einen führen den Weltkrieg, die anderen organisieren den Widerstand. Bei der Totalitarismustheorie bleiben nur die Uniformen übrig – und nicht die politischen Inhalte.
Kurt Gossweiler formulierte dazu treffend:
„Um das Kartenhaus der Totalitarismus-Doktrin zum Einsturz zu bringen, genügt es, die Frage nach den herrschenden Klassen und dem Inhalt der herrschenden Ideologie in den sogenannten ,totalitären‘ Staaten zu stellen, weil dann offenbar wird, dass hier die schärfsten, unvereinbaren Gegensätze unter ein und denselben Begriff gebracht werden.“ [21]
Gerade darin liegt die ideologische Funktion dieser Theorie: Sie stabilisiert kapitalistische Herrschaft, indem sie jede Alternative als ebenso repressiv, ja als gleichermaßen verbrecherisch erscheinen lässt. Das zeigt sich etwa in der EU-Resolution von 2009[22], welche Faschismus und Kommunismus auf eine Stufe stellt – ein Beispiel für die politische Nutzung der Theorie zur Geschichtsumdeutung und zur moralischen Legitimierung des westlichen Systems.
Die Folgen reichen weit über die historische Deutung hinaus: Die Totalitarismustheorie hat die Linke gespalten, indem sie den „realen Sozialismus“ zum Tabu erklärte. Bis heute greifen selbst linksradikale Gruppen die Begriffe dieser Theorie auf – wenn sie z. B. bestreiten, dass der Sozialismus in der Sowjetunion oder der DDR jemals „wirklich“ existiert habe. Dadurch wird die Geschichte revolutionärer Bewegungen entwertet und die Suche nach Alternativen zum Kapitalismus systematisch unterminiert. Eine materialistische Analyse macht sichtbar: Die Totalitarismustheorie ist keine Theorie, sondern eine politische Waffe – und als solche muss sie entlarvt und entschieden zurückgewiesen werden.
Faschismus als Reaktion
Ernst Nolte entwickelte in den 1960er Jahren eine umfassende Theorie des Faschismus, die eine geschlossene Interpretation aller internationalen Erscheinungsformen dieser Ideologie liefern und eine Alternative zur marxistischen Faschismusforschung bieten sollte. Seine zentrale Arbeit Der Faschismus in seiner Epoche basiert auf einem phänomenologischen Ansatz und versucht, den Faschismus als historisches Gesamtphänomen zu erklären.
Nolte argumentiert, dass der Faschismus als politische Bewegung aus der Herausforderung des „liberalen Systems“ durch die Russische Revolution und den internationalen Kommunismus hervorgegangen sei. Der Faschismus stelle die radikalste Reaktion auf diese Bedrohung dar, die darauf abzielte, sowohl den Kommunismus als auch das liberale System selbst zu zerstören. Dabei erhielt er Unterstützung von den traditionellen Eliten, ohne deren Hilfe eine Machtergreifung nicht möglich gewesen wäre. Auf internationaler Ebene versuchte der Faschismus, durch seinen konsequenten Antikommunismus Bündnisse mit konservativen und liberalen Kräften zu schmieden.
Noltes Konzept der „Epoche des Faschismus“ vergleicht diese mit historischen Phasen wie der Gegenreformation. Der Faschismus sei die bestimmende politische Strömung einer Zeit gewesen, in der Europa noch einmal als Zentrum der Weltgeschichte fungierte. Vor 1914 habe er nur in Ansätzen existiert, nach 1945 sei er als weltgeschichtliche Tendenz erloschen.[23]
| Nolte beschreibt fünf zentrale Charakteristika des Faschismus: 1. Der rapide Ausbau des Wahlrechts führte zur Massenbeteiligung an der Politik, wodurch der Faschismus als Antwort auf die als chaotisch empfundene parlamentarische Demokratie entstand. 2. Der Faschismus war vom Geist des Ersten Weltkriegs geprägt, organisierte sich nach militärischem Vorbild und setzte auf Stoßtruppmethoden. 3. Er stand in einem ambivalenten Verhältnis zum Bürgertum: Er verteidigte bürgerliche Interessen, setzte aber Methoden ein, die den bürgerlichen Traditionen fremd waren. Seine Anhänger rekrutierten sich häufig aus Kleinbürgern und radikalisierten Akademikern. 4. Der Faschismus wies eine ideologische Nähe zu seinen Gegnern auf: Viele seiner Führer stammten aus der Arbeiterbewegung und übernahmen deren Massenmobilisierungsstrategien. 5. Der Nationalismus wurde zum Extrem geführt und in einen aggressiven Imperialismus überführt.[24] |
Kritik an der Faschismuskonzeption von Nolte
Reinhard Kühnl kritisiert die Faschismuskonzeption von Ernst Nolte als unzureichend, da sie sich auf eine bloße Aufzählung von Merkmalen des Faschismus beschränkt, ohne zentrale Zusammenhänge zu erklären. Besonders unzureichend wird die Wechselwirkung zwischen Ideologie, Sozialstruktur und der Funktion des Faschismus analysiert. Es bleibt offen, warum sich insbesondere kleinbürgerliche Schichten dem Nationalsozialismus anschlossen, warum Juden, Intellektuelle und Marxisten als Hauptfeindbilder dienten und warum der Faschismus nach der Machtergreifung entgegen seiner Propaganda nicht die Interessen seiner Anhängerschaft erfüllte.
Ein zentrales Problem in Noltes phänomenologischem Ansatz ist die Überbewertung ideologischer Erscheinungsformen des Faschismus im Vergleich zu den politischen und gesellschaftlichen Funktionen. Dies führt dazu, dass seine Darstellung in gewisser Weise die Selbstwahrnehmung der Faschisten rechtfertigt, anstatt die realen gesellschaftlichen Kräfte und Strukturen zu hinterfragen. So wird etwa vernachlässigt, dass Ideologien immer in konkreten sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen verankert sind, und es wird zu wenig auf die strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen Faschismus und konservativen Kräften eingegangen.[25]
Außerdem stellt Nolte den Faschismus als „Antiglauben“ zum Marxismus dar, wodurch er ideologische Gegensätze überbetont und die sozialen und politischen Zusammenhänge vernachlässigt. Noltes These, dass der Faschismus eine „abgeschlossene historische Epoche“ sei, erweist sich ebenfalls als problematisch. Die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, die den Faschismus begünstigten – etwa soziale Deklassierung und wirtschaftliche Krisen sind auch heute noch relevant. Der Aufstieg rechtsextremer Bewegungen in Europa und autoritärer Regime in anderen Teilen der Welt zeigt, dass faschistische Strukturen weiterhin eine Gefahr darstellen.
Noltes Fokus auf den Ersten Weltkrieg und den Aufstieg des Sozialismus als Hauptursachen des Faschismus vernachlässigt tiefere gesellschaftliche Veränderungen. Auch seine starke Ausrichtung auf Europa und die Vernachlässigung globaler Dimensionen des Faschismus sind problematisch. Noltes Ansatz bleibt auf einer ideologischen Ebene verhaftet und lässt die sozialen und ökonomischen Faktoren, die Faschismus begünstigen, unbeachtet. Der Aufstieg rechtsextremer Bewegungen in Europa und faschistischer Regime in anderen Teilen der Welt, wie etwa die Pinochet-Diktatur in Chile, zeigt, dass faschistische Strukturen weiterhin eine reale Gefahr darstellen.
Diese ideologiezentrierte Herangehensweise ist jedoch nicht nur bei Nolte zu finden. Sie zieht sich durch die bürgerliche Faschismusforschung insgesamt und ist auch bei aktuellen Theoretikern wie Roger Griffin zu finden. Griffin, der Faschismus als eine Form von „palingenetischem Ultranationalismus“ beschreibt, stellt die nationale Erneuerung und den Mythos einer Wiedergeburt ins Zentrum seiner Analyse. Ähnlich wie Nolte vernachlässigt er die materiellen Ursachen und ökonomischen Bedingungen und fokussiert sich auf die ideologische Dimension des Faschismus. Beide Ansätze betonen kulturelle und symbolische Aspekte faschistischer Bewegungen, während die sozialen und ökonomischen Grundlagen als weniger bedeutend erachtet werden.
Schließlich ist Noltes These, der Faschismus sei eine abgeschlossene historische Epoche, nicht haltbar. Die gesellschaftlichen Bedingungen, die den Faschismus ermöglichten – soziale Deklassierung, wirtschaftliche Krisen, autoritäre Mentalitäten und Feindbilder – bestehen weiterhin. Der Aufstieg rechtsextremer Bewegungen in Europa und Militärdiktaturen in anderen Teilen der Welt zeigen, dass faschistische Strukturen weiterhin eine reale Gefahr darstellen. Noltes Erklärung, die Ursachen des Faschismus lägen allein im Ersten Weltkrieg und im Aufstieg des Sozialismus, greift zu kurz, da sie die tieferliegenden gesellschaftlichen Veränderungen außer Acht lässt. Auch seine Fokussierung auf Europa erscheint problematisch, da faschistische Ideologien und Herrschaftsformen weltweit zu beobachten sind. Letztlich krankt Noltes Ansatz an seinem idealistischen Geschichtsverständnis, das die Bedeutung von sozialen und ökonomischen Faktoren für die Entstehung des Faschismus vernachlässigt.
Die ideologiezentrierte Analyse, die Nolte verfolgt, findet sich auch in den Arbeiten moderner Faschismusforscher wie Roger Griffin.[26] Griffin betont die palingenetische Idee der nationalen Wiedergeburt, die ähnliche ideologische Akzente setzt wie Nolte. Beide forschen aus einer Perspektive, die die ideologischen Erscheinungsformen des Faschismus überbewertet und die sozialen und ökonomischen Grundlagen aus dem Blick verliert. Aus einer marxistischen Sicht ist dies problematisch, da es die wahre Funktion des Faschismus als Werkzeug der Bourgeoisie verschleiert.
Das Faschismusverständnis der Kritischen Theorie
Die „Kritische Theorie“ der Frankfurter Schule, vertreten durch Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und später Jürgen Habermas, spielte insbesondere in den 1950er- und 1960er-Jahren eine zentrale Rolle in der kritischen Auseinandersetzung mit der spätkapitalistischen Gesellschaft. Ihre Analysen des kapitalistischen Kulturbetriebs und seiner ideologischen Mechanismen trugen dazu bei, Herrschaftsstrukturen offenzulegen und eine kritische Haltung gegenüber bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen zu fördern. Während sie damit auch eine Beschäftigung mit marxistischen Ideen anregte, etablierte sie gleichzeitig durch bestimmte erkenntnistheoretische und methodische Positionen Barrieren gegenüber einer konsequent materialistischen Gesellschaftsanalyse. Für die Faschismustheorie ist die Frankfurter Schule besonders durch ihre Untersuchungen zum autoritären Charakter, zur Kulturindustrie und zur Dialektik von Aufklärung und Herrschaft von Bedeutung.[27]
Die Auseinandersetzung der Frankfurter Schule mit dem Faschismus entwickelte sich maßgeblich im Kontext der Emigration ihrer führenden Vertreter in den 1930er und 1940er Jahren. Angesichts des Aufstiegs des Nationalsozialismus und der eigenen Exilerfahrung bemühten sich Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Franz Neumann und andere, den Faschismus als gesellschaftliches, politisches und psychologisches Phänomen zu analysieren.
Ästhetisierung der Politik und Massenmobilisierung
Ein zentraler Aspekt der Faschismusanalyse der Frankfurter Schule war die Untersuchung der Ästhetik faschistischer Herrschaft. Walter Benjamin beschrieb in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (1936) die Tendenz des Faschismus, politisches Handeln durch spektakuläre Inszenierungen zu ersetzen.[28]
Faschistische Regime nutzten Massenveranstaltungen, Propagandafilme und architektonische Monumentalität, um emotionale Zustimmung zu erzeugen und kritische Reflexion zu unterdrücken. Diese Strategie zielte darauf ab, die politische Realität durch einen Mythos der „Volksgemeinschaft“ zu ersetzen.
Eine weitere zentrale These der Frankfurter Schule war die Bedeutung autoritärer Charakterstrukturen für den Erfolg faschistischer Ideologien. Theodor W. Adorno untersuchte gemeinsam mit Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson und Nevitt Sanford in den 1940er Jahren in den USA die „autoritäre Persönlichkeit“. Diese Studie identifizierte ein psychologisches Profil, das durch Schwarz-Weiß-Denken, Unterwürfigkeit gegenüber Autoritäten sowie Feindseligkeit gegenüber vermeintlich Schwächeren geprägt war. Antisemitismus interpretierten die Autoren als Projektion verdrängter Ängste und Aggressionen: Im antisemitischen Weltbild erkennen die Autoren das Resultat einer ritualisierten manischen Projektion unverstandener abstrakter Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse auf personalisierte (eingebildete) Mächte, die im „Juden“ versinnbildlicht werden. Die Unzufriedenheit mit der eigenen sozialen Lage wurde auf eine scheinbar „mächtige“ Minderheit umgelenkt, um strukturelle Ungerechtigkeiten zu verschleiern.
Adorno und Horkheimer vertieften diese Überlegungen in ihrer „Dialektik der Aufklärung“ (1944). Sie argumentierten, dass die Rationalität der Moderne in ihr Gegenteil umschlagen könne – insbesondere in Zeiten, wenn Menschen nach einfachen Lösungen und autoritären Krisenfiguren verlangten. Hierzu schreiben sie: „Die antisemitische Verhaltensweise wird in den Situationen ausgelöst, in denen verblendete, der Subjektivität beraubte Menschen als Subjekte losgelassen werden.“[29] Diese Analyse soll zeigen, wie der Antisemitismus als Ventil für Ohnmachtsgefühle dient, indem er komplexe gesellschaftliche Dynamiken in ein Feindbild „des Jüdischen“ verdichtet – eine Projektion, die zugleich von den realen Machtstrukturen des Kapitalismus ablenkt.[30]
Zwischen Machtkampf und Propaganda: Franz Neumanns Analyse des NS-Staates
Eine erste systematische Auseinandersetzung mit dem NS-Regime, die zum Standardwerk avancierte, verfasste der ebenfalls emigrierte Mitarbeiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung (IfS), Franz Neumann. Der Jurist und Politologe entwickelte in seiner 1942 in den USA veröffentlichten Studie Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus eine alternative Analyse des NS-Staates. Dabei ging er auf Distanz zu den an die Bonapartismustheorie angelehnten Faschismusdeutungen seines früheren Studienkollegen Ernst Fraenkel.[31]
In Anlehnung an die jüdische Mythologie kennzeichnete Neumann das Herrschaftssystem als „Behemoth“ – ein monströses Symbol für einen bürgerkriegsähnlichen „Unstaat“, der nicht mehr den rationalen Kategorien moderner Staatlichkeit entsprach. Anders als traditionelle Staatskonzepte beschrieb er das nationalsozialistische Deutschland nicht als hierarchisch organisierten „Leviathan“, sondern als chaotisches Geflecht konkurrierender Machtapparate.[32]
Neumann betonte, der NS-Staat sei ein pluralistisches Herrschaftssystem, geprägt durch die permanente Rivalität und Radikalisierung von vier Machtzentren: Partei, Wehrmacht, Bürokratie und Großkapital. Diese Konkurrenz führte zu einer ständigen Eskalation der Politik, da keine Instanz die Kontrolle über den Gesamtprozess besaß. Dabei analysierte Neumann auch deutlich den monopolkapitalistischen Charakter des NS-Regimes – ein Aspekt, der ihn der staatsmonopolistischen Kapitalismustheorie (SMK) nahebringt. Die Verflechtung von Großindustrie und staatlicher Macht, die Konzentration wirtschaftlicher Ressourcen und politischer Steuerung in den Händen einiger weniger Kapitalfraktionen, wird bei ihm zentral behandelt. Für diese ökonomische Schwerpunktsetzung wurde Neumann innerhalb der Frankfurter Schule auch kritisiert – insbesondere von Vertretern wie Adorno, die stärker auf kulturelle und subjektive Dimensionen fokussierten.[33]
Ein weiteres zentrales Element in Neumanns Analyse war die Untersuchung faschistischer Aneignungsstrategien. Um die Wirkungsmacht der Propaganda zu verdeutlichen, zeigte er in einer Gegenüberstellung auf, „wie marxistische Formeln von der nationalsozialistischen Politik übernommen und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten wurden“. So wurde die „Volksgemeinschaft“ als Ersatz für den Klassenkampf propagiert, der 1. Mai zum nationalen Feiertag erhoben und Arbeiterlieder mit neuen ideologischen Inhalten übernommen. Neumann erklärte: „Doch der Nationalsozialismus bietet dem Arbeiter alles an, was der Marxismus ihm bietet, und das ohne Klassenkampf. Er bietet ihm eine höhere Form des Lebens, die „Volksgemeinschaft“, und die Herrschaft der Arbeit über das Geld, ohne ihn zum Kampf gegen seine eigene herrschende Klasse zu zwingen.“ Diese Umdeutungen dienten dazu, Arbeiter für das Regime zu gewinnen, ohne die kapitalistischen Besitzverhältnisse anzutasten. Selbst Symbole wie die rote Fahne (mit Hakenkreuz versehen) oder revolutionäre Rhetorik wurden instrumentalisiert, um eine Scheinidentität zwischen NS-Ideologie und sozialistischen Utopien zu konstruieren.[34]
Fazit
Die Kritische Theorie durchlief seit ihrer Entstehung eine tiefgreifende Transformation: Während sie ursprünglich zum Teil als marxistische Gesellschaftsanalyse zur Aufdeckung kapitalistischer Herrschaftsmechanismen diente, wurde sie im Zuge ihrer Entwicklung zunehmend von marxistischen Grundlagen befreit und in eine bürgerlich-liberale Theorie überführt. Besonders deutlich zeigt sich dieser Wandel bei der Rezeption von Adorno und Horkheimer, deren abstrakte Vernunftkritik in der Dialektik der Aufklärung zwar interessante Aspekte zum Antisemitismus und zur Kulturindustrie lieferte, gleichzeitig jedoch die politisch-ökonomische Kapitalismuskritik weitgehend durch eine allgemeine Kritik an rationaler Identitätsbildung ersetzte.
Bei der Einschätzung der „Frankfurter Schule“ ist – wie Robert Steigerwald in seiner kritischen Auseinandersetzung Bürgerliche Philosophie und Revisionismus im imperialistischen Deutschland betont – diese komplizierte Ursprungssituation und die eigenartige Stellung zwischen den Fronten stets zu beachten. Die Begründer und führenden Repräsentanten der Schule waren antifaschistisch aktiv und mussten aus Deutschland emigrieren. Sie hatten kultur- und ideologiekritisch bemerkenswerte Arbeiten hervorgebracht. Doch sie verhielten sich dabei stets distanziert gegenüber der realen Arbeiterbewegung und dem existierenden Sozialismus, womit sie – so Steigerwald – letztlich daran arbeiteten, oppositionellen Kräften den Übergang auf sozialistische Positionen zu erschweren. Die aus dieser Haltung resultierende negative Beurteilung des Sozialismus und der Arbeiterbewegung bewirkte laut Steigerwald eine Parteinahme gegen den organisierten Klassenkampf, gegen antiimperialistische Bündnispolitik und trug zur Wiederbelebung anarchistischer Zielvorstellungen bei.[35]
Das Verständnis vom Faschismus wandelte sich in diesem Prozess ebenfalls. Während die ursprüngliche Kritische Theorie – insbesondere bei Franz Neumann – eine enge Verbindung zwischen Kapitalismus und Faschismus erkannte, wurde diese Perspektive in der liberalisierten Frankfurter Schule zunehmend aufgegeben. Die faschismustheoretischen Arbeiten Adornos und Horkheimers verschoben den Fokus – wie Reinhard Opitz in Das Argument (1974) kritisch anmerkt – auf die Untersuchung autoritärer Persönlichkeitsstrukturen und der familiären Sozialisation, etwa in Studien zum autoritären Charakter oder in Autorität und Familie. Diese Reduktion der Faschismusanalyse auf psychologische und kulturelle Faktoren schuf den Boden für eine totalitarismustheoretische Sichtweise, die den historischen und ökonomischen Charakter des Faschismus zunehmend entkernte. Wie Opitz feststellt, ist dem von der kritischen Theorie entwickelten Begriff der autoritären Persönlichkeit eine Tendenz zur Totalitarismustheorie immanent – eine Tendenz, die letztlich auch die Unterscheidung zwischen Faschismus, Spätkapitalismus und Sozialismus verwischt und damit dem ideologischen Schema westlicher Gleichsetzungen Vorschub leistet.[36]
Zudem ergibt sich aus dieser Subjektzentrierung eine gefährliche politische Konsequenz: Die Analyse von Faschismus wird auf Elemente des Bewusstseins, der Erziehung und des Charakters verlagert. Damit entsteht der Eindruck, der Faschismus komme „von unten“ – aus der autoritären Disposition einzelner Menschen oder der Masse. Dies ist nicht nur eine Abkehr von einer klassenanalytischen Sichtweise, sondern öffnet auch einer pauschalen Verachtung der sogenannten „autoritären“ Unterschichten und der Arbeiterklasse Tür und Tor.
Hinzu kommt, dass der Antisemitismus bei Adorno und Horkheimer – besonders in der Dialektik der Aufklärung – nicht als ideologisch-funktionales Instrument der faschistischen Herrschaft verstanden wird, sondern als ein quasi-metaphysisches Grundmuster irrationaler Herrschaft überhaupt. Diese theoretische Verschiebung, Antisemitismus nicht als bewusst eingesetztes Machtinstrument kapitalistischer Klassenherrschaft zu analysieren, sondern als „Wesen des Faschismus“ schlechthin zu bestimmen, ermöglichte eine entkontextualisierte Faschismusdefinition. Daraus erwuchs später ideologisch das Fundament für antideutsche Positionen, die jede materialistische Faschismusanalyse ablehnen und Antisemitismus zur alleinigen Erklärungskategorie machen – unabhängig von imperialistischer Ökonomie, Klassenverhältnissen oder historischer Konstellation.
Gleichzeitig ist es jedoch zu einfach, die gesamte Kritische Theorie vorschnell zu verwerfen, nur weil ihre Hauptvertreter später antikommunistische Positionen einnahmen. Gerade bei Neumann, aber auch in den frühen Arbeiten von Horkheimer finden sich wertvolle Beiträge zur Analyse ideologischer Herrschaft, der Funktion von Propaganda und zur Integration der Arbeiterklasse in faschistische und kapitalistische Strukturen. Diese Analysen verdienen auch aus marxistisch-leninistischer Perspektive eine differenzierte Auseinandersetzung – insbesondere hinsichtlich ihrer Einsichten in die ideologische Vermittlung zwischen Ökonomie und Bewusstsein. Doch muss diese Auseinandersetzung stets die ideologische Verengung und antikommunistische Funktionalisierung im Spätwerk vieler Vertreter kritisch mitbedenken.
Die Faschismustheorie und ideologische Neuausrichtung nach 1990
Nach 1990 erfuhr die Faschismustheorie in Deutschland eine ideologische Neuausrichtung, die auch maßgeblich durch den Einfluss des Verfassungsschutzes geprägt wurde. Bürgerliche Politikwissenschaftler wie Armin Pfahl-Traughber, Eckhard Jesse und Uwe Backes trieben die Entwicklung der sogenannten Extremismus-Doktrin voran, welche die Totalitarismus-Doktrin fortsetzte und verschärfte.
Diese Extremismus-Doktrin postuliert eine vermeintliche Gleichsetzung von „Links-“ und „Rechtsextremismus“, indem beiden Strömungen eine grundsätzliche Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und eine potenzielle Gewaltbereitschaft unterstellt wird. Das häufig genutzte Hufeisenmodell suggeriert, dass sich die politischen Extreme einander annähern und gleichermaßen eine Bedrohung für die „demokratische Mitte“ darstellen.
Diese Darstellung dient nicht nur der Relativierung rechter Gewalt, sondern verschleiert die historisch belegte Tatsache, dass die Weimarer Republik durch eine Allianz aus Großkapital und bürgerlicher Reaktion zugunsten des Faschismus zerstört wurde. Statt einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit politischen Positionen entscheidet allein die Haltung zum Grundgesetz über deren Einordnung als „extremistisch“. Die Definitionshoheit darüber obliegt dem Verfassungsschutz selbst.[37]
Die bürgerliche Geschichtsschreibung, eine Gesellschaftsordnung verteidigend, die historisch in der Defensive ist, hat die Faschismusforschung grundsätzlich in den Dienst des Antikommunismus und Antisowjetismus gestellt. Im engeren Sinne wird die bürgerliche Faschismusgeschichtsschreibung von zwei Zielstellungen bestimmt: Erstens das kapitalistische System vom Schandmal des Faschismus reinzuwaschen, d. h. faschistische Bewegungen und vor allem faschistische Herrschaftsformen als etwas der „westlichen“, der „demokratisch-pluralistischen Gesellschaft“ wesensfremdes hinzustellen; zweitens zugleich die faschistischen Bewegungen, Herrschaftsformen und -methoden auf ihre Brauchbarkeit für die Stabilisierung des kapitalistischen Systems nach innen sowie für sein expansives Vorgehen nach außen zu untersuchen.[38]Letzteres geschieht jedoch nicht etwa, um faschistische Tendenzen in bürgerlichen Demokratien aufzudecken, sondern in einem bewusst verkürzten Zugriff, der den Antikommunismus absichert: Die Gleichsetzung von Faschismus und Sozialismus in der Totalitarismus- und Extremismustheorie dient letztlich dazu, die Geschichte des Sozialismus zu delegitimieren.
Wiederaufstieg und ideologische Instrumentalisierung der Totalitarismustheorie seit den 1980er Jahren
Der Zusammenbruch des sozialistischen Systems in Osteuropa und die Annexion der DDR durch die BRD stellten eine tiefgreifende Zäsur dar, die nicht nur politische und wirtschaftliche, sondern auch identitätsstiftende Fragen aufwarf. Der deutsche Imperialismus musste sich im Rahmen seiner neuen Ausdehnung neu definieren und suchte nach einer einheitlichen Geschichtsinterpretation, die sowohl die eigene Vergangenheit als auch die Legitimation des neuen, gesamtdeutschen Staates umfasste. In diesem Kontext kam es zu einer verstärkten Debatte über die NS-Vergangenheit, wobei insbesondere die Frage der deutschen Schuld, die Rolle des Antisemitismus sowie die Deutung des Faschismus kontrovers diskutiert wurden. Dazu führte die sogenannte Goldhagen-Debatte, welche später im Text näher beschrieben wird, zu einer intensiven Diskussion über die gesellschaftlichen Grundlagen des Holocaust.
Nach der Konterrevolution von 1989/90 kam es vermehrt zu Versuchen, die DDR und das faschistische Deutschland unter dem Paradigma der Totalitarismustheorie gleichzusetzen. Diese Betrachtungsweise war kein wissenschaftlicher Zugang zur Geschichte, sondern diente politisch-ideologischen Zwecken: Sie sollte die DDR als illegitime Diktatur und somit den Sozialismus als gescheitertes und verbrecherisches Projekt brandmarken.
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ befasste sich 1992 auch mit dem Diktaturenvergleich in Deutschland. Jürgen Habermas, ein prominenter Vertreter der „Frankfurter Schule“, plädierte dabei für einen Vergleich zwischen der sogenannten „SED-Diktatur“ und dem Nationalsozialismus. Er wies darauf hin, dass der Vergleich die „totalitären Gemeinsamkeiten“ der beiden Diktaturen hervorheben und den Blick auf die Enteignung von Bürgern richten könne, die in beiden Regimen ihre soziale und rechtliche Autonomie verloren. Habermas warnte vor Einseitigkeiten: „Wo die Rechten zur Angleichung neigen, wollen die Linken vor allem Unterschiede sehen.“ Er betonte, dass beide Seiten denselben Maßstab anlegen müssten, um ein objektives Ergebnis zu erzielen.[39]
Diese Argumentationsweise griff Elemente des Historikerstreits von 1986/87 auf, bei dem insbesondere die schon genannten Thesen von Ernst Noltes eine Rolle spielten (siehe Kapitel: Faschismus als Reaktion). Nolte hatte eine kausale Verbindung zwischen stalinistischen Verbrechen und dem Holocaust behauptet und damit versucht, die NS-Verbrechen als eine bloße Reaktion auf den Bolschewismus zu relativieren. Während diese Position im Historikerstreit klar zurückgewiesen wurde, ist diese Theorie mittlerweile fester ideologischer Bestandteil des deutschen Imperialismus.
Parallel zur Wiederbelebung der Totalitarismustheorie entwickelte sich ab den späten 1970er Jahren in den USA eine Debatte über die Singularität des Holocausts. Historiker wie Yehuda Bauer, Saul Friedländer und Eberhard Jäckel betonten die Einzigartigkeit des Holocausts als ersten industriell organisierten, staatlich betriebenen Versuch der physischen Auslöschung einer ganzen ethnischen oder religiösen Gruppe. Diese Sichtweise prägte die westdeutsche Erinnerungskultur nachhaltig.
In der Debatte wird jedoch zunehmend hinterfragt, ob die Fixierung auf die Singularität des Holocausts nicht zur Marginalisierung anderer Verbrechen führt, etwa der deutschen Kolonialverbrechen. Der Historiker A. Dirk Moses kritisiert in seinem Konzept des „Holocaust-Katechismus“ die politische Instrumentalisierung dieser Singularitätsthese. Moses argumentiert, dass der moralische Ausnahmecharakter des Holocausts genutzt werde, um andere historische und gegenwärtige Verbrechen – insbesondere aus dem Kontext des Kolonialismus und Imperialismus – aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verdrängen und damit die heutige geopolitische Rolle Deutschlands zu legitimieren.[40]
Die Goldhagen-Debatte: Verkürzte Täteranalyse und ideologische Engführung
Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser ideologischen Wende war die Goldhagen-Debatte, die in den 1990er Jahren internationale Aufmerksamkeit erlangte. Goldhagen argumentierte in seinem Werk Hitler’s Willing Executioners (1996), dass die Deutschen seit dem 19. Jahrhundert von einem „eliminatorischen Antisemitismus“ geprägt waren, der auf die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung abzielte. Er vertrat die These, dass die deutsche Gesellschaft bereits vor dem Nationalsozialismus für die Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden mobilisierbar gewesen sei. Goldhagens Werk trug dazu bei, die Diskussion um die Verantwortung der deutschen Gesellschaft für den Holocaust auf eine individualisierte Täteranalyse zu fokussieren und so von tiefergehenden sozialen und wirtschaftlichen Ursachen abzulenken.
Ein weiteres zentrales Motiv seiner Arbeit war die Charakterisierung der Täter als „gewöhnliche Deutsche“. Goldhagen schätzte die Zahl der direkt an der Judenvernichtung beteiligten Täterinnen und Täter auf etwa eine halbe Million und betonte, dass diese nicht einer militärischen Elite angehörten, sondern typische Vertreter der deutschen Gesellschaft der 1940er Jahre waren. Damit schloss er von den Tätern auf die gesamte deutsche Gesellschaft und postulierte, dass deren Handeln Ausdruck einer verbreiteten antisemitischen Mentalität gewesen sei.
Im empirischen Teil seiner Arbeit untersuchte Goldhagen verschiedene Institutionen der Judenvernichtung und die dort tätigen Täterinnen und Täter. Er analysierte deren Verhalten, emotionale und rationale Motivationen sowie die Bedingungen ihres Handelns. Auf dieser Grundlage kam er zu dem Schluss, dass die Verbrechen bewusst und willentlich aus antisemitischer Überzeugung begangen wurden. Andere Erklärungsansätze wies er zurück.[41]
Antideutsche Ideologie und die geopolitische Umorientierung
1999 führte Deutschland unter der rot-grünen Bundesregierung nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals wieder einen Krieg, der moralisch mit der Verhinderung eines „neuen Auschwitz“ begründet wurde. Fischers „Nie wieder Auschwitz“ wurde zu einem Symbol für die Verbindung von „moralischer Verantwortung“ und imperialistischer Außenpolitik. Die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit und dem Holocaust wird seither genutzt, um militärische Interventionen zu rechtfertigen oder imperialistische Aggressionen zu legitimieren. Diese Logik wurde zunehmend durch die Entwicklung der Antideutschen und ihre spezifische Interpretation des Faschismus und der deutschen Geschichte verstärkt.[42]
In den 1990er Jahren entstand im Umfeld der Wiedervereinigung Deutschlands die Strömung der Antideutschen, die sich aus der Ablehnung eines neuen deutschen Nationalismus herausbildete. Diese Haltung wurde durch Diskussionszirkeln wie dem Hamburger „Roten Forum“ formuliert, das 1989 den Slogan „Nie wieder Deutschland“ prägte. Dieser Ausdruck, der sich gegen den Nationalismus und die Wiedervereinigung richtete, wurde zu einem zentralen Schlachtruf der antinationalen Linken. Aus dieser Bewegung heraus übernahmen die Antideutschen zahlreiche Fragmente der Kritischen Theorie, insbesondere die Analysen von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer zur autoritären Persönlichkeit und die Kritik an der deutschen Kultur, die sie als besonders anfällig für Faschismus und Antisemitismus ansahen. Diese Rezeption der Kritischen Theorie war in ihrer ursprünglichen Form eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Doch die Antideutschen übersetzten diese kritischen Ansätze zu einer Vereinfachung, die den deutschen Antisemitismus als kulturell verankert verstand und dabei die kapitalistischen Verhältnisse als sekundär ansah.
Sie rezipierten Werke wie Daniel Goldhagens „Hitlers willige Vollstrecker“, das den Holocaust als Ausdruck eines spezifisch deutschen Antisemitismus und nicht primär als Resultat kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse interpretiert. Diese Interpretation des Antisemitismus als ein „deutsches“ Phänomen wurde von den Antideutschen stark betont. Der Antisemitismus wurde dabei als reaktionärer, verkappter Antikapitalismus verstanden, der vor allem mit der „ungebildeten“ deutschen Arbeiterklasse verbunden war. Hier griffen sie auf Adornos und Horkheimers kritische Theorie zurück, die den deutschen Antisemitismus als tief verwurzelt in der deutschen Kultur und Geschichte begreift; jedoch wurde diese Sichtweise von den Antideutschen zu einer vereinfachten Ablehnung des deutschen Nationalismus und einer Verwerfung der traditionellen linken Klassenanalyse zugunsten einer betonten Distanzierung vom „deutschen Volk“ und seiner Geschichte.[43]
In dieser Entwicklung zeigten sich auch Berührungspunkte zur Wertkritik, die in den 1980er und 1990er Jahren in Teilen der Linken entstand. Die Wertkritik, vertreten etwa von Robert Kurz oder der Gruppe „Krisis“, kritisierte den Kapitalismus nicht primär als ungerechte Verteilungsordnung, sondern als ein auf abstrakten, gesellschaftlich verselbstständigten Wertformen beruhendes System. Während Teile der Wertkritik sich noch bemühten, die kapitalistischen Wertverhältnisse als Grundlage für Antisemitismus und Krisendynamiken zu analysieren, übernahmen viele Antideutsche lediglich Fragmente dieser Kritik. Sie reduzierten den Antisemitismus letztlich auf kulturelle Faktoren und blendeten die Kritik an den systemischen kapitalistischen Grundlagen weitgehend aus. Statt die Verselbstständigung gesellschaftlicher Abstraktionen wie Geld und Ware zu analysieren, verschoben die Antideutschen die Problemanalyse auf nationale oder kulturelle „Defekte“.[44]
Dieses Denken trug eine tiefe Skepsis gegenüber revolutionären Bewegungen in sich und schuf die Grundlage für eine später offen pro-imperialistische Haltung. Die Antideutschen leiteten daraus ab, dass sie revolutionäre Bewegungen, insbesondere in der Dritten Welt, als potenziell gefährlich und antisemitisch betrachteten, da diese ihrer Ansicht nach ebenfalls antikapitalistische Elemente enthalten könnten. In der Folge übernahmen sie die Vorstellung, dass der westliche Kapitalismus als das stabilisierende System gegen den „Islam-Faschismus“ fungiere und die einzige Garantie für die Aufrechterhaltung der „westlichen Zivilisation“ sei.[45]
In der weiteren Entwicklung griff die außenpolitische Parole „Nie wieder Auschwitz“ diese ideologischen Elemente auf und nutzte sie zur Legitimation imperialistischer Kriegspolitik. Die Solidarität mit Israel wurde zu einem zentralen Bekenntnis, das zunehmend auch eine Verachtung des Islams beinhaltete. Die Dichotomie von „Barbarei versus Zivilisation“, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September 2001, wurde auf die Spitze getrieben. Schließlich zeigt sich heute eine Konvergenz zwischen antideutschen und offen faschistischen Positionen, insbesondere in Bezug auf ihre Haltung zu Kriegen in der Ukraine oder im Nahen Osten.
Die in Westdeutschland entstandene Ideologie der Antideutschen gewann in den 1990er Jahren zunehmend Einfluss auf das Verständnis von Faschismus und wirkte sich schrittweise auf bürgerliche bis linke Kreise aus. Dieses Faschismusverständnis ist uneinheitlich und oft widersprüchlich, geprägt von einer tief verwurzelten Ablehnung des traditionellen Antifaschismus. Zentral in ihrer Weltanschauung ist die Annahme, dass der Kapitalismus, insbesondere in seiner Form als „freie Marktwirtschaft“, als Bollwerk gegen den „Islam-Faschismus“ fungiere. Hierbei verweisen Antideutsche oft auf die USA als das bevorzugte Modell einer kapitalistischen Demokratie, die ihrer Ansicht nach in der Lage ist, die gefährlichen reaktionären Kräfte zu bekämpfen. Dies führt zu einer ambivalenten Haltung zum Kapitalismus selbst: Obwohl sie theoretisch ein anderes, besseres System anstreben, sehen sie das kapitalistische System derzeit als notwendig an, um die Ausbreitung des Faschismus zu verhindern.
Ein zentraler Punkt der antideutschen Ideologie ist die Umdeutung des Holocausts. Während marxistische Theorien den Holocaust als eine Manifestation des Kapitalismus im Rahmen einer faschistischen Herrschaft begreifen, stellen die Antideutschen den Faschismus als ein eigenständiges, vom Kapitalismus losgelöstes Phänomen dar und als Teil einer militärischen Kolonialisierungsstrategie. In ihrer Sichtweise wird die Welt in „zivilisatorische Demokratien“ und „faschistisch-antisemitische Diktaturen“ unterteilt, wobei der Zusammenhang imperialer Interessen des Westens ausgeblendet wird. Diese Sichtweise führt zu einer Verzerrung der historischen Realität, da sie die kapitalistischen Wurzeln des Faschismus ignoriert und die Verantwortung der „Demokratien“ für die Entstehung und Ausbreitung faschistischer Regime leugnet.
Ein weiteres Merkmal der Antideutschen ist ihre weit verbreitete Bevölkerungsverachtung. In ihren Texten und öffentlichen Auftritten zeigen sie wenig Interesse an der breiten Bevölkerung und sehen sich selbst als eine intellektuelle Avantgarde, die es mit einer „verblendeten“ Masse zu tun hat. Diese Haltung führt zu einer Entfremdung von der breiten gesellschaftlichen Basis, da sie die „dumme Mehrheit“ nicht nur als passiv, sondern als aktiv destruktiv wahrnehmen. Besonders die Deutschen selbst werden als unfähig angesehen, revolutionäre Gedanken zu fassen, da sie von den „Manipulationen“ der Medien und Politiker vereinnahmt wurden. Die klassische proletarische Sichtweise, dass die Arbeiterklasse das Potenzial zur Veränderung hat, wird von den Antideutschen weitgehend abgelehnt Die pessimistische Haltung gegenüber der Arbeiterklasse und die frühe Abkehr von klassenbasiertem Denken trugen zur Entpolitisierung und Entfremdung gegenüber gesellschaftlichen Basisbewegungen bei.
In Bezug auf den Antisemitismus verfolgen die Antideutschen eine radikale Position, die diesen als ein isoliertes, einzigartiges Phänomen betrachten. Sie trennen den Antisemitismus vom allgemeinen Rassismus und vertreten die Ansicht, dass nur Antisemitismus im engeren Sinne, wie etwa Israel-Feindlichkeit, bekämpft werden müsse.[46]
Im Zuge der ideologischen Verschiebung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde der Begriff „Faschismus“ zunehmend auf muslimische Bewegungen übertragen, wobei deren Struktur und antiwestliche Ausrichtung hervorgehoben wurden. Islamismus galt fortan nicht mehr primär als Ausdruck sozialer oder antiimperialistischer Konflikte, sondern wurde in weiten Teilen der Diskussion pauschal als faschistische Bedrohung für die westliche Demokratie interpretiert.
Diese Sichtweise übernahmen auch Teile der kommunistischen und linksradikalen Szene, darunter Organisationen wie der Kommunistische Aufbau, die damit eine entscheidende strategische Verschiebung vollzogen: Anstatt weiterhin den antiimperialistischen Befreiungskampf in den Vordergrund zu stellen, passten sie sich faktisch der imperialistischen Ideologie an, die jede oppositionelle Bewegung außerhalb des westlichen Einflussbereichs als potenziell faschistisch diskreditierte.
Fazit
Ernst Thälmann formulierte bereits 1932 mit den Worten: „Kampf gegen den Faschismus – das ist Kampf gegen das kapitalistische System.“ Auch die autonome Göttinger Antifa (M) hielt 1991 fest: „Kampf dem Faschismus heißt Kampf dem imperialistischen System.“ Demgegenüber stehen Theorien, die den Faschismus weniger als Instrument der Eliten, sondern als Produkt irrationaler und verrohter Massenbewegungen betrachten. Vertreter dieser Sicht, darunter der neurechte Historiker Rainer Zitelmann, behaupteten, das Bürgertum habe den Faschismus überwiegend abgelehnt, während Hitler als Repräsentant der „kleinen Leute“ agierte.
Während die DDR den Antifaschismus als Kampf gegen den Kapitalismus verstand, setzt sich in der BRD zunehmend eine Perspektive durch, die die Verantwortung der unteren Klassen betont. Diese Entwicklung speist sich aus dem Anspruch westdeutscher Linker, vermeintliche Defizite der „traditionsmarxistischen“ Faschismustheorie zu überwinden. Kritiker wie Mathias Wörsching fordern, den Bruch zwischen Kapitalismus und Faschismus stärker zu betonen und faschistische Ideologie wörtlich zu nehmen. Damit entfernt sich die Analyse jedoch zunehmend von materialistischen Ansätzen und verfällt im Idealismus.
Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind weitreichend. In der Wochenzeitung Jungle World wurde zum Beispiel behauptet, die DDR habe einen „unheimlichen Gemeinschaftsgeist“ konserviert, der bereits den Nationalsozialismus zur Massenbewegung gemacht habe. Der Zerfall des autoritären Antifaschismus sei daher mitverantwortlich für rechtsextreme Entwicklungen wie den NSU. Solche Thesen kehren die marxistische Faschismusanalyse um: Statt den Faschismus als Produkt kapitalistischer Widersprüche zu begreifen, wird er als „barbarischer Einbruch“ in einer ansonsten fortschrittlichen Gesellschaft dargestellt.
Dieser Paradigmenwechsel spiegelt sich auch in globalen Debatten wider. Moderne „Antifaschisten“, die der Historiker Gazi Caglar als „Huntington-Linke“ bezeichnet, behaupten mit der gleichen Vehemenz wie US-Neocons die Existenz eines „Islamfaschismus“. In der Antifa-Zeitschrift Phase 2 wurde 2008 der Nationalsozialismus mit dem Djihadismus gleichgesetzt, wobei die islamische Umma mit dem Führerkult der Nazis verglichen wurde. Auch akademisch verpackte Begriffe wie „religiöser Faschismus“ dienen letztlich derselben Argumentation. Damit wird Antifaschismus zunehmend zur Legitimationsideologie für neoliberale Kriege und westliche Expansion.[47]
In der neuen Antifa-Bewegung wird die marxistische Definition von Faschismus als Form bürgerlicher Herrschaft zunehmend abgelehnt. Statt sich gegen kapitalistische Herrschaft und imperialistische Kriege zu wenden, richtet sich der Fokus auf eine undifferenzierte Bekämpfung von als antisemitisch oder nationalistisch empfundenen Positionen. Vertreter wie Peter C. Walther von der VVN-BdA argumentieren, dass Faschismus nicht zwingend mit Kapitalismus verbunden werden darf und Antifaschismus kein Teil des Klassenkampfes sei. Einige Gruppen vertreten zudem die Ansicht, dass die Macht der Eliten eine Illusion sei und dass Kapitalismus eine unpersönliche Herrschaft darstelle, die sowohl Unternehmer als auch Arbeiter gleichermaßen betreffe. Diese Abkehr von der marxistischen Faschismusdefinition führt zu einer politischen Umorientierung der Antifa. Dabei wird Faschismus oft primär als Anti-Liberalismus verstanden, wodurch dessen wirtschaftliche und klassenbezogene Wurzeln in den Hintergrund treten. In der Folge verliert der Antifaschismus seine antikapitalistische Perspektive und nähert sich offen neokonservativen Positionen an, die eine Unterstützung imperialistischer Aggressionen beinhalten.
[1] Vgl. Kühnl, Reinhard: „Faschismustheorien“, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 50 ff.
[2] Auch Vertreter des Großkapitals (z.B. Industrielle wie Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Manager von IG Farben, Siemens, AEG usw.) wurden in den Nürnberger Prozessen zumindest teilweise zur Verantwortung gezogen. Besonders bekannt sind der IG-Farben-Prozess, der Krupp-Prozess und der Flick-Prozess. Allerdings fielen die Urteile gegen Wirtschaftsführer oft milder aus als die gegen politische oder militärische Führungspersonen. Viele Manager wurden relativ bald wieder freigelassen und spielten später eine zentrale Rolle beim wirtschaftlichen Wiederaufbau Westdeutschlands.). Quelle: Landeszentrale für politische Bildung BW: „Die Nürnberger Prozesse“, Online: https://www.lpb-bw.de/nuernberger-prozesse#c23402 (aufgerufen: 22.04.2025).
[3] Zahlreiche Nazis machten nach 1945 in der Bundesrepublik erneut Karriere, etwa Hans Globke (Chef des Bundeskanzleramts unter Adenauer, Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze) oder Kurt Georg Kiesinger (NSDAP-Mitglied, später Bundeskanzler). Quelle: Gelsenzentrum: „Die Mörder des ‚Dritten Reichs’“, Online: http://www.gelsenzentrum.de/deutsche_nazi_karrieren.htm (aufgerufen: 22.04.2025).
[4] Vgl. Kühnl, Reinhard: „Faschismustheorien“, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 50 ff.
[5] Vgl. Kühnl, Reinhard: „Faschismustheorien“, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 307.
[6] Vgl. Kühnl, Reinhard: „Faschismustheorien“, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 308.
[7] Golo Mann (1909–1994) war ein deutscher Historiker, Publizist und Sohn von Thomas Mann. Für Golo Mann ist Hitler ein „Monstrum“, das „grauenhafteste menschliche Phänomen unseres … Jahrhunderts“. Er sei Diktator geworden, „weil er es wollte“.
Vgl. Golo Mann: Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1958.
Joachim Fest (1926–2006) war ein deutscher Historiker, Journalist und Verleger. Er prägte die westdeutsche Erinnerungskultur mit seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, insbesondere durch seine Hitler-Biografie (Hitler. Eine Biographie, 1973). Als Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vertrat er konservative Positionen.
Vgl. Joachim Fest: Hitler. Eine Biographie, Frankfurt am Main 1973.
[8] Vgl. Kühnl, Reinhard: „Faschismustheorien“, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 309 ff.
[9] Vgl. Ebd.
[10] Vgl. Ebd.
[11] Vgl. Kapitel I sowie Kapitel II, Abschnitt zu Kühnl
[12] Vgl. Ebd.
[13] AG Totalitarismus (Corell, Karlchen; Müller, Stephan; Rosa): „Die Totalitarismus-Doktrin oder die reaktionäre Ideologie ‘Links gleich rechts’. Teil 2: Revisionismus – Opportunismus – Reaktion“, in: KAZ, Nr. 341, 2012, Online: https://www.kaz-online.de/artikel/die-totalitarismus-doktrin-oder-die-reaktionaere-ideologie-links-gleich-rechts–2#ref-24 (aufgerufen: 14.02.2025).
[14] Vgl. Kühnl, Reinhard: „Faschismustheorien“, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 134
[15] AG Totalitarismus (Corell, Karlchen; Müller, Stephan; Rosa): „Die Totalitarismus-Doktrin oder die reaktionäre Ideologie ‘Links gleich rechts’. Teil 2: Revisionismus – Opportunismus – Reaktion“, 2012, Online: https://www.kaz-online.de/artikel/die-totalitarismus-doktrin-oder-die-reaktionaere-ideologie-links-gleich-rechts–2#foot-1 (aufgerufen: 14.02.2025).
[16] AG Totalitarismus (Corell, Karlchen; Müller, Stephan; Rosa): „Die Totalitarismus-Doktrin oder die reaktionäre Ideologie ‘Links gleich rechts’. Teil 2: Revisionismus – Opportunismus – Reaktion“, in: KAZ, Nr. 341, 2012, Online: https://www.kaz-online.de/artikel/die-totalitarismus-doktrin-oder-die-reaktionaere-ideologie-links-gleich-rechts–2#ref-24 (aufgerufen: 15.02.2025).
[17] Gossweiler, Kurt: „Aufsätze zum Faschismus, Band II“, Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 1988, S. 371 ff.
[18] Deppe, Frank: „Arendt und politisches Denken“, in: UTOPIE kreativ, Heft 201/202 (Juli/August 2007), S. 681–697, hier S. 682.
[19] Vollnhals, Clemens: „Der Totalitarismusbegriff im Wandel“, 2006, Online: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29513/der-totalitarismusbegriff-im-wandel/ (aufgerufen: 25.01.2025).
[20] Parkhomenko, Roman: „Cassirers politische Philosophie. Zwischen allgemeiner Kulturtheorie und Totalitarismus-Debatte“, Karlsruhe 2006, Online: https://books.openedition.org/ksp/3208#bodyftn53 (aufgerufen: 12.03.2025).
[21] Gossweiler, Kurt: „Aufsätze zum Faschismus, Band II“, Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 1988, S. 371 ff.
[22] Europäisches Parlament: „Entschließung zum Gewissen Europas und zum Totalitarismus (2009/2557(RSP))“, 2009, Online: https://de.wikipedia.org/wiki/Entschlie%C3%9Fung_des_Europ%C3%A4ischen_Parlaments_zum_Gewissen_Europas_und_zum_Totalitarismus_(2009/2557_(RSP)) (aufgerufen: 04.01.2025).
[23] Vgl. Kühnl, Reinhard: „Faschismustheorien“, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 145 ff.
[24] Vgl. Kühnl, Reinhard: „Faschismustheorien“, Distel Verlag, Heilbronn 1990, S. 154 ff.
[25] Ebd. S.161 ff.
[26] Roger Griffin ist ein führender Vertreter der ideologiezentrierten Faschismusforschung. In seiner Theorie des „palingenetischen Ultranationalismus“ (2007) stellt er Faschismus als eine politische Bewegung dar, die auf die nationale Wiedergeburt und Erneuerung durch eine aggressive, ultranationalistische Ideologie abzielt. Griffin betont die Bedeutung kultureller Mythen und symbolischer Narrative in faschistischen Bewegungen, wobei soziale und ökonomische
[27] Vgl. Verlag Marxistische Blätter: „Die ‘Frankfurter Schule’ im Lichte des Marxismus“, Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt am Main 1970, S. 5 ff.
[28] Vgl. Häusler, Alexander; Fehrenschild, Michael: „Faschismus in Geschichte und Gegenwart“, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin 2020, S. 57 ff.
[29] Vgl. Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W.: „Dialektik der Aufklärung“, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1988, S. 180.
[30] Vgl. Häusler, Alexander; Fehrenschild, Michael: „Faschismus in Geschichte und Gegenwart“, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin 2020, S. 57 ff.
[31] Fraenkel, Ernst: Der Doppelstaat. Versuch einer Pathologie des autoritären Staates.
Fraenkel analysierte den NS-Staat als „Doppelstaat“, der eine Kombination aus einer legalen bürokratischen Struktur und einer illegalen, willkürlichen Gewaltordnung unter der Kontrolle der NS-Partei darstellt. Diese Doppelstruktur führte zu einer instabilen Herrschaftsordnung, die im Gegensatz zu Neumanns Vorstellung eines chaotischen, pluralistischen Machtgefüges stand.
[32] Vgl. Neumann, Franz L.: „Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1984, S. 12 ff.
[33] Vgl. Eichholtz, Dietrich; Gossweiler, Kurt (Hrsg.): „Faschismus-Forschung“, Akademie-Verlag, Berlin 1980, S. 327 ff.
[34] Vgl. Häusler, Alexander; Fehrenschild, Michael: „Faschismus in Geschichte und Gegenwart“, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin 2020, S. 58 ff.
[35] Vgl. Steigerwald, Robert: „Bürgerliche Philosophie und Revisionismus im imperialistischen Deutschland“, Akademie-Verlag, Berlin 1980, S. 151 ff.
[36] Vgl. Opitz, Reinhard: „Über die Entstehung und Verhinderung von Faschismus“, in: Das Argument, Heft 87/1974, S. 560 ff.
[37] AG Totalitarismus (Corell, Karlchen; Müller, Stephan; Rosa): „Die Totalitarismus-Doktrin oder die reaktionäre Ideologie ‘Links gleich rechts’. Teil 2: Revisionismus – Opportunismus – Reaktion“, in: KAZ, Nr. 341, 2012, Online: https://www.kaz-online.de/artikel/die-totalitarismus-doktrin-oder-die-reaktionaere-ideologie-links-gleich-rechts–2#ref-24 (aufgerufen: 17.03.2025).
[38] Vgl. Eichholtz, Dietrich; Gossweiler, Kurt (Hrsg.): „Faschismus-Forschung“, Akademie-Verlag, Berlin 1980, S. 327 ff.
[39] Vgl. Jesse, Eckhard: „Das Dritte Reich und die DDR“, Edition Temmen, Bremen 2005, S. 44.
[40] Wildt, Michael: „Was heißt: Singularität des Holocaust?“, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 19 (2022), H. 1, URL: https://zeithistorische-forschungen.de/1-2022/6022 (aufgerufen: 25.04.2025); Druckausgabe: S. 128–147.
[41] Vgl. Schepers, Norbert: „Einen Nerv getroffen. Debatten zum Umgang mit der NS-Vergangenheit in den neunziger Jahren in Deutschland“, Karl Dietz Verlag, Berlin 2005, S. 11 ff.
[42] Vgl. Hagen, Patrick: „Die Antideutschen und die Debatte der Linken über Israel“, 2005, Online: http://www.trend.infopartisan.net/trd0405/t030405.html#7 (aufgerufen: 23.04.2025).
[43] Vgl. Hagen, Patrick: „Die Antideutschen und die Debatte der Linken über Israel“, 2005, Online: http://www.trend.infopartisan.net/trd0405/t030405.html#7 (aufgerufen: 23.04.2025).
[44] Ebd.
[45] Vgl. Erdem, Isabel: „Anti-deutsche Linke oder anti-linke Deutsche? Eine sachliche Betrachtung, Karl Dietz Verlag, Berlin, 2005 S.4 ff.
[46] Vgl. Erdem, Isabel: „Anti-deutsche Linke oder anti-linke Deutsche? Eine sachliche Betrachtung, Karl Dietz Verlag, Berlin, 2005 S.8 ff.
[47] Sommer, Michael; Witt-Stahl, Susann: „Hayek oder Holzhacken. Die Einsicht, dass Antifaschismus und Antikapitalismus zusammengehören, droht verlorenzugehen. Teil I: Die Umdeutung des Faschismus zur Massenbewegung der Subalternen“, in: junge Welt, 2012, Online: https://www.jungewelt.de/artikel/191048.hayek-oder-holzhacken.html (aufgerufen: 01.03.2025).