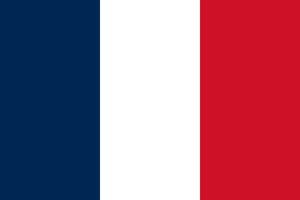Wer Geschichtsrevisionismus betreibt, verharmlost den Faschismus
Themen: Deutscher Imperialismus, Faschismus

Ein Kommentar der Kommunistischen Organisation zu 80ten Jahrestag der Selbstbefreiung von Buchenwald
Nach 80 Jahren Selbstbefreiung spuken die Geister der Vergangenheit über den Ettersberg
Seit 2022 werden Vertreter der Russischen Föderation nicht zu der Gedenkfeier eingeladen und ihre Kränze für die Opfer des Lagers entsorgt. Russland zahlte mit Millionen Toten einen großen Blutzoll für die Befreiung vom Faschismus, kaum eine Familie blieb verschont. Auch das Georgsband, ein Symbol des Kampfes gegen den Faschismus, ist auf dem Gelände verboten. Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz beschuldigte die Gedenkstättenleitung Russland der Instrumentalisierung der faschistischen Vergangenheit, wenn seine Politiker von einer Entnazifizierung der Ukraine sprechen.[1] Kein Wort zu den faschistischen Mörderbanden im ukrainischen Militär und Geheimdienst oder zum Bandera-Kult und Russenhass, der die Gesellschaft durchsetzt. Passend zu dieser Linie wurde 2022 auf der offiziellen Gedenkfeier nicht die weißrussische Flagge angebracht, sondern die der Opposition.[2] Und das, obwohl die Flaggen für gewöhnlich die Nationalitäten der Häftlinge repräsentieren sollen. Die Fahne der weißrussischen Opposition war zur Zeit des Konzentrationslagers Buchenwald das Symbol der judenhassenden, weißrussischen Nazi-Kollaborateure.
Auch die gescheiterten Versuche vom letzten Jahr, Antifaschisten mit Kufiyah den Eintritt in die Gedenkstätte zu verwehren, reihen sich in diese katastrophale Politik ein. Faschisten und palästinasolidarische Aktivisten werden ohnehin gerne mal in einen Topf geworfen: »Wenn junge Leute in Berlin „Free Palestine from German guilt“ skandieren, unterscheidet sich das kaum vom „Schuldkult“-Narrativ der extremen Rechten.«[3] so die Gedenkstättenleitung in einer Rede vom 27. Januar dieses Jahres. Während die einen darauf bestehen, die deutsche Schuld am Holocaust aufzuarbeiten, anstatt sie auf Araber und Palästinenser zu übertragen, leugnen die anderen die faschistischen Verbrechen Deutschlands.
Diese Politik der Gedenkstätte hat ihre Wurzeln im stockreaktionären Geschichtsrevisionismus, auf den sich die Bundesrepublik stützt. Wir wollen im Folgenden Hintergründe liefern und die Geschichte der Gedenkstätte Buchenwald anlässlich 80 Jahren Selbstbefreiung aufarbeiten. Die Entlassungen und politischen Säuberungen seit 1990 bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs. Kaum bekannt ist die Geschichte des Protestes und Widerstandes gegen diesen Geschichtsrevisionismus.
Der Kampf gegen Geschichtsrevisionismus gehört auf die Tagesordnung
Für die deutsche Kriegsmaschinerie, die aktuell mit 1,7 Billionen Euro geölt werden soll, ist der Geschichtsrevisionismus ein entscheidender Hebel. Mit Geschichtsrevisionismus werden Krieg und Aufrüstung legitimiert. Deutschland habe aus seiner Vergangenheit gelernt und dürfe genau deswegen Atombomben besitzen, Panzer in die Ukraine schicken oder Bomben nach Israel liefern. Mit diesem Geschichtsrevisionismus wird außerdem neofaschistischen Tendenzen Vorschub geleistet. Wir müssen also genau hinschauen, wenn heute von deutscher Verantwortung und Lehren aus der Geschichte gesprochen wird. Und umso besser müssen wir die Geschichte des Faschismus und des antifaschistischen Widerstandes studieren. Es ist unsere Geschichte und wir müssen sie kennen! Wer die Erfahrungen und Klassenkämpfe der Vergangenheit nur schablonenhaft und identitär behandelt, ist zum Scheitern verurteilt – das gilt auch für die Gefahr der Ritualisierung des Gedenkens durch uns Kommunisten.
Das Ziel liegt darin, die Reinwaschung und Verleumdung der faschistischen Verbrechen so weit zu betreiben, dass man imstande ist, im Namen dieser Verbrechen neue Verbrechen begehen zu können. Oder wie es die Bourgeoisie nennt: Verantwortung. Konkret drückt sich diese Politik in der Täter-Opfer-Umkehr im Zweiten Weltkrieg aus, die notwendig wird, um den Krieg gegen Russland vorzubereiten. Das geschieht erstens durch das Ausblenden deutscher Verbrechen in Osteuropa und zweitens durch eine Dämonisierung der Sowjetunion, die man nicht mehr als Befreierin akzeptieren will. Drittens wird die Rolle deutscher Monopole unterschlagen, um davon ausgehend Kontinuitäten des Faschismus, die bis heute in der DNA der BRD stecken, zur Spinnerei zu erklären.
»Die Blutspur führt von Buchenwald nach Bonn.«
So brachte es das Lagermuseum in Buchenwald bis 1990 auf den Punkt. Im selben Jahr wurden weite Teile der Ausstellung abgebaut. 1995 entledigte man sich der Ausstellung komplett.[4] In dieser Zeit betrieb die BRD eine regelrechte Inquisition: Überall in Ostdeutschland wurden Ausstellungen politisch gesäubert und kleinere KZ-Gedenkstätten sogar komplett plattgemacht.
Warum musste die Ausstellung Buchenwald weichen? Weil die neue Gedenkstättenleitung weder Kontinuitäten in der BRD noch die Rolle der Monopole und der Finanziers hinter Hitler sehen wollte. Auch die Selbstbefreiung des Lagers und sein internationaler Widerstand passten nicht ins Bild. Die neue Gedenkstättenleitung war voll auf Linie des BRD-Geschichtsrevisionismus. Der Staat, der selbst nie eine ordentliche Aufarbeitung des Faschismus betrieb, hatte für den Antifaschismus, der von der KZ-Gedenkstätte ausging, nichts übrig. Während in der BRD bis zu diesem Zeitpunkt keine Gedenkstättenarbeit und –forschung existierte, hatte sie nun die Vormundschaft über die breit gefüllten Archive und Forschungen der DDR-Geschichtswissenschaft. In der BRD mussten ehemalige Häftlinge jahrelang für die Errichtung und Erhaltung von Gedenkstätten kämpfen – oft erfolglos. Den Freiwilligen, die sich für die Erhaltung der Gedenkstätte Dachau einsetzten, wurde mehrmals mit Schließung gedroht.[5] Die Forschung zum Faschismus war in der BRD völlig unterfinanziert und hatte einen Außenseiterstatus. Die breite Aufarbeitung und Forschung der DDR beweist hingegen bis heute, dass es auch anders gehen kann. Der Großteil der Historiker wurde 1990 auf die Straße gesetzt und aus den Universitäten Ostdeutschlands verbannt. Ihr Protest und Einspruch gegen diese Maßnahmen gingen im nationalistischen Freudentaumel der DDR-Eingliederung unter. Ein neues Geschichtsbild wurde von oben aufgezwungen. Das Schicksal der Gedenkstätte Buchenwald ist seitdem ein Paradebeispiel des Geschichtsrevisionismus.
Die Abwicklung der Gedenkstätte Buchenwald
1990 wurde auch die Gedenkstättenleitung umgehend abgewickelt und eine westdeutsche Historikerkommission eingesetzt. Es folgten dutzende Entlassungen und Denunziationen des alten Personals. Der neue Gedenkstättenleiter hielt sich nur 5 Tage im Amt. Als die DKP-Vergangenheit des Historikers bekannt wurde, musste er sofort wieder weichen.[6]
Die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald neben dem Lager, geplant und errichtet von ehemaligen Häftlingen, wird seitdem verunglimpft als Zeugnis der heuchlerischen und diktatorischen DDR-Staatspropaganda.[7] Das größte KZ-Mahnmal Europas wird seit 35 Jahren den Witterungsbedingungen des Ettersberges überlassen.
Stattdessen fokussierte man sich nun auf die Nutzung von Buchenwald als Internierungslager für Nazifunktionäre, SS-Angehörige und Wehrmachtssoldaten zwischen 1945 und 1950. Gefundenes Fressen für die Reaktion: den Mythos vom Sowjet-KZ Buchenwald verbreiteten bereits viele Altnazis in der jungen BRD. Fakt ist: Solche Internierungslager wurden in allen vier Besatzungszonen genutzt und basierten auf Listen des britisch-amerikanischen Oberkommandos. Der Beschluss dazu wurde 1943 auf der Alliierten Konferenz in Teheran getroffen.[8]
Die Häftlinge des Internierungslagers Buchenwald erhielten schon früh Entschädigungen als „stalinistisch Verfolgte“. Was schon in der BRD der 1950er auf antifaschistischen Widerstand stieß, wurde in den 1990ern mit einer Gedenkstätte, die Nazis als Opfer präsentiert, weiter auf die Spitze getrieben. Während ein Monat Haft in der DDR/SBZ 550 Mark Entschädigung bedeutete, wurden Insassen der Konzentrationslager mit 150 Mark abgespeist. Kommunisten gingen leer aus und sahen sich staatlichen Repressionen ausgesetzt.[9] Die 1990 errichtete Gedenkstätte für das Speziallager steht hinter der Effektenkammer und erstreckt sich über 250 Quadratmeter Wald. Sie ist seitdem eine Pilgerstätte für Rechte und Neofaschisten.[10]
Streit um das antifaschistische Erbe
Der erneute Protest von Antifaschisten und ehemaligen Häftlingen des Konzentrationslagers gegen diese Geschichtsklitterung wurde von der Springerpresse als Umtriebe kommunistischer Ideologen verunglimpft und von der Gedenkstätte abgeschmettert. Nichts sollte dem neuen Geschichtsbild im Weg stehen.[11]
Bis zuletzt protestierten die ehemaligen Häftlinge des Lagers gegen eine solche Umdeutung der Geschichte. Der Buchenwald-Häftling Emil Carlebach kritisiert, wie der Aufstand der jüdischen Häftlinge gegen die Todesmärsche und die Unterstützung durch den internationalen Widerstand im Lager behandelt werden: »Ich selbst wurde acht Tage lang unter dem Fußboden einer Baracke versteckt – bis zur Befreiung. Ich sollte erhängt werden, weil man mich nicht ganz zu Unrecht verdächtigte, mitbeteiligt zu sein an der Verhinderung des Abtransportes der Juden zum Todesmarsch. Ich trug ja selber den Judenstern und wir haben über 900 Kinder hier gerettet, die nach SS-Begriffen und nach Begriffen der Herren Krupp und IG-Farben unnütze Esser waren und in Gaskammern kommen sollten. Heute wird das alles von Politikern und Historikern als kommunistischer Mythos denunziert. (…) Na gut, Lügen konnte nicht nur Göbbels, er hatte auch Nachfolger.«[12]
Seit dem erinnerungspolitischen Kahlschlag der Neunziger ist die Marschrichtung klar: »Es geht auch in Buchenwald darum, wie man mit Geschichte öffentlich umgeht und wie man auch mit dem Antifaschismus-Mythos der DDR umgeht und solche Dinge. Und da brauchen sie einen mit Erfahrung im öffentlichen Umgang mit Geschichte, die nicht nur sozusagen wissenschaftliche Brillanz allein erfordert.« So der neue Gedenkstättenleiter Hofmann in der taz vom 15.6.1992. Für historische Fakten scheint kein Platz zu sein, wenn es um die Dämonisierung des Antifaschismus der DDR geht.
Auch die nicht enden wollenden Versuche der DDR – und damit der politischen Linken – Antisemitismus zu unterstellen, gehen an Buchenwald nicht spurlos vorbei. Und das, obwohl der 1958 eingerichtete Gedenkort an der Stelle des jüdischen Sonderlagers sowie zahlreiche Reden und Artikel aus der Zeit das Gegenteil beweisen. Umso perfider ist es, dass der Aufruf der illegalen KPD »Gegen die Schmach der Judenpogrome« und die Verweise auf den gemeinsamen Widerstand von Juden und Kommunisten aus der Ausstellung gestrichen wurden. Selbst die Gedenkplakette für Jerzy Zweig, dem geretteten polnisch-jüdischen Kind aus Nackt unter Wölfen, wurde entfernt. Zweig selbst zog wegen der wiederholten Diffamierungen als „Tauschkind“ und „Legende“ gegen die Gedenkstättenleitung vor Gericht.
2012 schaltete sich das Auschwitz-Komitee ein. In einem offenen Brief an die Regierenden forderte Esther Bejarano: »Schluss mit der Überwachung von Überlebenden des Holocaust und der Diskreditierung ihrer Zeitzeugenarbeit! « Sie kritisiert die Gesinnungsschnüffelei der Geheimdienste und den Generalverdacht gegenüber Überlebendenorganisationen und antifaschistischen Initiativen, während »die Regierenden eine Mitverantwortung an den ‚deutschen Zuständen‘ heute tragen: An der Ökonomisierung des Denkens, an der Entsolidarisierung der Gesellschaft, und, daraus folgend, an der sozialen Spaltung, die Ängste schürt. Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit haben heute wieder Konjunktur in Deutschland. «[13]
Muff von 1000 Jahren
Mit der BRD zog nicht nur ein neues Geschichtsbild ein, sondern auch hunderte Neonazis konnten sich nun wieder breitmachen. Sie greifen bis heute die Gedenkstätte und Besuchergruppen an: Hitlergrüße, Hakenkreuzschmierereien, Verhöhnung der Opfer, verbale Angriffe und Sabotageaktionen. Viel zu oft kommen die Neofaschisten mit viel zu geringen Strafen oder völlig ungestraft davon. Die neue Gedenkstätte für das sowjetische Internierungslager ist hingegen ein beliebter Pilgerort der Neofaschisten. 1996 besuchte eine Neonazigruppe, darunter das NSU-Trio, die Gedenkstätte in SA-ähnlichen Uniformen, um zu provozieren.[14] In der DDR hätte das ihre Verhaftung bedeutet und 10 Menschen das Leben gerettet. In der BRD konnte die geheimdienstfinanzierte Truppe weiter ihr Unwesen treiben.
Mit der Zeit fand außerdem das Vorhaben, Opfer und Täter „differenzierter“ darzustellen, immer stärkere Unterstützung aus Wissenschaft und Politik. Die Darstellung der SS als diabolische Gewalttäter sei undifferenziert – die Teilschuld „roter Kapos“ müsse einbezogen werden. Auch die rein positive Darstellung des Lagerwiderstands sei problematisch und beweise die Einseitigkeit des DDR-Antifaschismus. Auch hier ging die Bild-Zeitung wieder als Vorreiterin in die Startlöcher: Mit der Artikelserie „Wie Kommunisten den Nazis beim Töten halfen“ hetzten sie in übelster Weise gegen Buchenwald-Häftlinge.
Im Schwur von Buchenwald heißt es: »Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht!« In Westdeutschland bauten diese Schuldigen einen neuen Staat auf. Die Kriegstreiber und Revanchisten, die heute zum Krieg gegen Russland trommeln, treten ihr Erbe an. Drei Ziele zeugen bis heute davon, wessen Geistes Kind diese Bundesrepublik ist: Rache an der Sowjetunion, Unterwerfung Osteuropas und Abschüttelung der historischen Verbrechen.
[1] Gedenkstätte Buchenwald (2025): Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.
[2] Website der Gedenkstätte Buchenwald (2022): 77. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora.
[3] Ebd.
[4] Zorn, Monika (1993): Hitlers Zweimal getötete Opfer.
[5] Daniela Dahn (2021): Der Schnee von Gestern ist die Sintflut von heute. Die Einheit, eine Abrechnung.
[6] Zorn, Monika (1993): Hitlers Zweimal getötete Opfer.
[7] Dutzende Artikel von BPB bis zur Website der Gedenkstätte zeugen davon.
[8] Dahn (2021), S.102.
[9] Daniela Dahn (2021): Der Schnee von Gestern ist die Sintflut von heute. Die Einheit, eine Abrechnung.
[10] Ebd.
[11] Daniela (2021)
[12] Thomas Knecht (2010): Carlebach 1. (YouTube Video ab Min. 6:46)
[13] Esther Bejarano (2012): Offener Brief des Auschwitz Komitees an die Regierenden (Glocke vom Ettersberg Nr. 205)
[14] Stiftung Gedenkstätten (2021): Besucher*innen, die nicht willkommen sind. (Eine Auswahl neofaschistischer Angriffe und Provokationen).