von Jona Textor
„Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird“ – Karl Marx
Inhalt
I. Positionen und Theorien der „postmodernen Identitätslinken“
II. Marx und Engels über Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus
III. Zur Kritik des Antimarxismus der postcolonial studies
IV. Zur Kritik der postmodernen Identitätspolitik
Fazit: „class struggle, not race struggle”
Die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten am 25. Mai 2020 in Minneapolis hat eine Protestbewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst, wie sie die Welt seit den internationalen Solidaritätskampagnen gegen das südafrikanische Apartheid-Regime nicht mehr gesehen hat. Die USA erleben derzeit einen politischen Ausnahmezustand, wie es ihn zuletzt auf dem Höhepunkt der Anti-Vietnamkriegs-Proteste und der Hochzeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gegeben hat.
Anders als in den 1960er und 1970er Jahren sind in der Bewegung heute allerdings kaum mehr politische Organisationen und ideologische Anführerinnen und Anführer[1] vertreten, die den Rassismus aus einer materialistischen Perspektive analysieren und ihren Anti-Rassismus ausgehend von einem marxistischen Kapitalismusverständnis formulieren. Für die Black Panther Party war es in den 1960er und 1970er Jahren noch eine Selbstverständlichkeit, die rassistische Unterdrückung als Bestandteil des kapitalistischen Ausbeutersystems zu verstehen. Von Bobby Seale, einem der Gründungsmitglieder der Panthers, stammt das Zitat: „Arbeiter aller Hautfarben müssen sich vereinigen gegen die ausbeuterische und unterdrückerische herrschende Klasse. Lasst mich erneut betonen – wir glauben, unser Kampf ist ein Klassenkampf, kein Rassenkampf.“[2] Von diesem theoretischen Erbe ist heute leider kaum mehr etwas übrig. Natürlich werden im Rahmen der Black-Lives-Matter (#BLM) Proteste auch heute noch einzelne Stimmen linker Aktivisten oder Gruppen laut, die klassenkämpferische Positionen vertreten oder sich sogar positiv auf die Tradition der Black Panthers berufen[3], diese sind derzeit aber weit davon entfernt, die Breite der Bewegung zu repräsentieren.
Dies ist unter den gegebenen Verhältnissen auch nicht verwunderlich. Die Arbeiterbewegung und die kommunistischen Kräfte liegen seit 1989/91 weltweit am Boden. Nicht nur an den Universitäten und im kulturellen Mainstream in den USA und Europa, sondern auch in großen Teilen der Linken haben sich seit den 1990er Jahren die Theorien der postcolonial studies und die verschiedenen Spielarten der postmodernen „Identitätspolitik“ durchgesetzt. Der rasante Aufstieg der Identitätspolitik in den 1990ern vollzog sich nicht etwa im Zuge einer Erneuerung oder Modernisierung des Marxismus, sondern – obwohl einige der Vordenkerinnen der Postmoderne selbst aus marxistischen Strömungen kamen – explizit in Abgrenzung, teilweise in offener Feindschaft zu diesem. Das äußert sich bis heute darin, dass die Vertreter dieser Theorien nicht nur die wichtigsten Grundannahmen der marxistischen Theorie verwerfen, sondern auch eine Reihe an Falschbehauptungen, Lügen und Vorurteilen über den Marxismus verbreiten, die ihn als möglichen Erklärungsansatz für die herrschenden Unterdrückungsverhältnisse von vornherein diskreditieren sollen. Eine Aufarbeitung der idealistischen und explizit anti-materialistischen philosophischen und erkenntnistheoretischen Grundannahmen der Postmoderne würden hier den Rahmen sprengen, es würde sich aber lohnen, diesem Thema irgendwann einen eigenen Artikel zu widmen. Im Gegensatz zu vielen Linken hatte der US-Geheimdienst CIA die zersetzende Wirkung der postmodernen Philosophie auf den Marxismus und die Linke insgesamt bereits 1985 richtig erkannt und eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der politischen Nutzbarmachung der aus ihrer Sicht positiven Potentiale der Theorien von Foucault und Kollegen beschäftigte.[4]
In den USA sind die identitätspolitischen Lobbys heute vor allem innerhalb der Demokratischen Partei stark vertreten. In Deutschland ist der Einfluss dieser Strömung hauptsächlich in der Szene-Linken, insbesondere in den Reihen der interventionistischen Linken (iL), aber auch in der Linkspartei und bei den Grünen stark. Er reicht aber auch bis weit hinein in die Gewerkschaftsjugenden, die SPD und den breiteren popkulturellen Mainstream. Alle Spielarten dieser Strömung – aus Mangel an einem besseren Begriff fassen ich sie in diesem Artikel als „postmoderne Identitätslinke“[5]zusammen – haben gemeinsam, dass sie nicht mehr die Analyse der ökonomischen Ausbeutungsstrukturen und der Klassenherrschaft in den Mittelpunkt stellen, sondern ihre Gesellschaftskritik auf das Gebiet der Kultur und des „Diskurses“ verlagern. Dabei werden nicht mehr Verhältnisse zwischen gesellschaftlichen Klassen, sondern zwischen Individuen bzw. zwischen „Mehrheitsgesellschaft“ und diskriminierten „communities“ in den Blick genommen. An die Stelle der ökonomischen Ausbeutung als Kern der gesellschaftlichen Machtverhältnisse tritt die individuelle und strukturelle Diskriminierung aufgrund bestimmter Identitätsmerkmale.
Der Einfluss dieser Theorien macht sich auch in den Reihen der anti-rassistischen #BLM-Bewegung bemerkbar. Zugespitzte identitätspolitische Debatten, die sonst auf die „Bubble“ einer relativ überschaubaren Politszene beschränkt bleiben, dringen im Kontext der neu entstandenen Massenbewegung nun auch verstärkt in eine breitere Öffentlichkeit. Plötzlich gehen in den sozialen Netzwerken Inhalte zu Alltagsrassismus, Diskriminierung und „Privilegien“ viral und werden auch in den etablierten Mainstream-Medien verstärkt aufgegriffen. In den Reihen der Bewegung selbst wurde schon in den ersten Tagen des Protests eine ganze Reihe grundsätzlicher politischer Fragen aufgeworfen und zum Teil leidenschaftlich diskutiert: Dürfen sich weiße Menschen überhaupt an den anti-rassistischen Protesten beteiligen? Sollten sich Weiße öffentlich in Diskussionen über Rassismus zu Wort melden oder sollte das ausschließlich den direkt Betroffenen vorbehalten bleiben? Profitieren alle Weißen von Rassismus, ob sie wollen oder nicht? Ist wirkliche Solidarität zwischen Unterdrückten und „Privilegierten“ überhaupt möglich? Und wie kann eine wirksame Strategie und Taktik im Kampf gegen Rassismus eigentlich aussehen?
Wie in diesem Artikel argumentiert werden soll tragen viele der identitätspolitischen Positionen vor allem dazu bei, das radikale Potential der spontanen Empörung in Bahnen zu lenken, die für das herrschende System insgesamt ungefährlich sind. Sie bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte für Reformvorstellungen und Illusionen in den bürgerlichen Staat und den Kapitalismus und sie stehen durch die Betonung der Spaltungslinien entlang von Identitätsgrenzen der Formulierung eines gemeinsamen Klasseninteresses, das sich gegen den Rassismus im Besonderen, gleichzeitig aber gegen die kapitalistische Ausbeutung im Allgemeinen richten müsste, letztlich entgegen. Mit einer marxistischen Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse sind die meisten Positionen der postmodernen Identitätslinken nicht vereinbar.
Eine kurze Vorbemerkung sei diesem Text vorangestellt: Es geht mir nicht darum, Menschen, die sich über identitätspolitische Themen politisiert haben als politisch verloren abzutun, ihnen eine ehrliche Motivation abzusprechen oder ihnen pauschal irgendwelche schädlichen Motive zu unterstellen. Mein Anliegen ist es, eine Diskussion zu eröffnen und auch unter Leuten, die sich bisher vor allem als Anti-Rassistinnen verstanden haben, Interesse an marxistischen Standpunkten zu wecken. Ich möchte einen Beitrag dazu zu leisten, dem Kampf gegen Rassismus wieder eine materialistische Analysegrundlage und eine revolutionäre Stoßrichtung zu geben. Es liegt mir aber fern mit meiner Kritik pauschal die antirassistische Protestbewegung auf der Straße anzugreifen oder zu diskreditieren. Ganz im Gegenteil: Seit der Ermordung von George Floyd sind weltweit Millionen Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt aufgestanden und haben dabei angesichts der brutalen Repression vielerorts ihre Gesundheit, ihre Freiheit oder sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Jeder, der sich selbst als Marxist versteht, sollte gegenüber dieser Bewegung nicht nur seine Solidarität bekunden, sondern sich aktiv an ihrem Kampf beteiligen. Jede, die die grundlegenden Ziele dieser Bewegung teilt, sollte aber auch ein Interesse daran haben, den Einfluss von Ideologien und Politikvorstellungen in ihren Reihen zurückzudrängen, die dem Erreichen dieser Ziele letzten Endes im Wege stehen.
Dieser Artikel verfolgt daher drei wesentliche Ziele: (1) Einige der gängigsten Falschbehauptungen und Kritikpunkte, die von Vertretern der postcolonial studies gegen den Marxismus vorgebracht werden, sollen anhand der Originaltexte überprüft und widerlegt werden. (2) Gleichzeitig sollen dabei die wirklichen Positionen von Marx und Engels gegenüber Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus dargestellt und als weiterhin gewinnbringende Analysen für die heutigen Kämpfe fruchtbar gemacht werden. (3) Davon ausgehend sollen abschließend einige der gängigsten Positionen und Behauptungen der postmodernen Identitätslinken einer marxistischen Kritik unterzogen werden.
Wer nicht den ganzen Artikel lesen möchte und sich nur für einzelne Punkte interessiert, kann von hier aus direkt in eins der Unterkapitel springen. In Abschnitt I. gebe ich einen kurzen Überblick über die häufigsten anti-marxistischen Behauptungen der postcolonial studies und die wichtigsten Positionen der postmodernen Identitätslinken. In Abschnitt II. stellen ich anhand einiger Beispiele Marx‘ und Engels‘ Analysen und Positionen zu Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus dar. In Abschnitt III. versuche ich davon ausgehend die antimarxistischen Behauptungen der postcolonial studies zu widerlegen. Abschnitt IV. widmet sich schließlich ausführlich einer marxistischen Kritik der postmodernen Identitätspolitik. Die einzelnen in Abschnitt I. dargestellten Positionen werden unten wieder unter den jeweiligen Buchstaben in Klammern (a-m) aufgegriffen.
I. Positionen und Theorien der „postmodernen Identitätslinken“
Es ist nicht mein Anliegen, hier alle nicht-marxistischen Ansätze der Rassismus- und Diskriminierungskritik in einen Topf zu werfen und diese pauschal als schädlich oder reaktionär abzutun. Gleichzeitig kann und will dieser Artikel aber auch keine differenzierte Detailstudie zu den verschiedenen akademischen Theorieansätzen vorlegen, die jeder Strömung innerhalb dieses Spektrums gerecht werden könnte. Der Artikel konzentriert sich vielmehr auf jene identitätspolitischen Positionen, die mittlerweile so weit verbreitet sind, dass sie sich in Teilen der Popkultur und der linken Szene, aber auch im liberalen Lager der bürgerlichen Parteien quasi als Allgemeinplätze etabliert haben. Es geht mir also um jene popularisierten Erscheinungsformen dieser Ideologie, in denen sie wirkliche Massenwirksamkeit und mediale Reichweite entfaltet. In Diskussionen auf Facebook, Twitter-Statements oder Demoparolen wird eher selten explizit auf akademische Theorien Bezug genommen, und doch begegnen einem dort immer wieder dieselben Positionen und Behauptungen, die letztlich auf die Grundannahmen der postmodernen Identitätspolitik zurückgehen.
An dieser Stelle mag von manchen eingewandt werden, dass ein solches methodisches Vorgehen nur eine „Strohpuppe“ oder eine „Karikatur“ der postmodernen Identitätspolitik abbildet und nicht auf das eingeht, was ihre ideologischen Urheber „wirklich geschrieben“ oder „wirklich gemeint“ haben. Trotzdem sind die hier beschriebenen popularisierten und vulgarisierten Formen der Identitätspolitik nunmal die wirklichen Formen, in denen diese Eingang in die Alltagskultur gefunden hat. Für die Analyse größerer ideologischer Entwicklungen ist zweitrangig, was sich in den akademischen Elfenbeintürmen abspielt, wichtig ist, wie bestimmte Ideologieformen sozusagen „vergesellschaftet“ werden, denn „allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.“[6]
Zunächst werfen wir also einen Blick auf die häufigsten anti-marxistischen Vorurteile und Falschbehauptungen aus dem Spektrum der postmodernen Identitätslinken. Dabei tun sich besonders die Vertreterinnen und Vertreter der postcolonial studies hervor, die bei der Entstehung und theoretischen Ausformulierung der Identitätspolitik vom Ende der 1970er bis in die 1990er Jahre hinein eine zentrale Rolle gespielt haben. An Universitäten, im akademischen rassismus- und diskriminierungskritischen Kontext sowie in der linken Szene gehören zumindest Versatzstücke dieser Theorien auch heute noch zum ideologischen Mainstream. Dem Marxismus wird aus diesem Spektrum (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) häufig vorgeworfen:
(a) Er betrachte die Klassenzugehörigkeit als einzig relevantes Identitätsmerkmal (Stichwort: „Klassenreduktionismus“).[7] Unter dem „Proletariat“ stelle sich der „Traditionsmarxismus“ außerdem vor allem männliche, weiße Industriearbeiter vor – erst die postcolonial studies hätten die wirkliche Vielfalt der „Subalternen“ sichtbar gemacht.[8]
(b) Außerdem „idealisiere“ und „heroisiere“ Marx die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt und unterstelle ihr ausschließlich gute und revolutionäre Eigenschaften. Dieselbe Idealisierung weiderhole sich im Antiimperialismus in der Identifikation mit den antikolonialen und nationalen Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt.[9]
(c) Der Marxismus behandle alle Fragen nach Rassismus, Sexismus und anderen Identitätsmerkmalen, aufgrund derer Menschen diskriminiert werden, ausschließlich als „Nebenwidersprüche“ neben dem „Hauptwiderspruch“ zwischen Kapital und Arbeit.
(d) Der Marxismus sei „eurozentrisch“ und reproduziere damit in letzter Konsequenz rassistische und koloniale Denkmuster. Die Menschen des „globalen Südens“ kämen bei Marx und Engels ausschließlich als passive Opfer der von Europäern gemachten Geschichte vor. Aufgrund seines Eurozentrismus projiziere der Marxismus die universellen Werte der Aufklärung auf die ganze Menschheit, anstatt die jeweils kulturell unterschiedlichen „partikularen“ Identitäten der „Subalternen“ im globalen Süden anzuerkennen. Damit reproduziere der Marxismus – schließlich selbst eine Theorie weißer europäischer Männer – koloniale und paternalistische Denkweisen.[10]
(e) Marx und Engels als „üble Rassisten“ zu diffamieren – etwa wegen ihrer aus heutiger Sicht teilweise rassistischen Wortwahl oder dem derben Humor in ihren privaten Briefwechseln – ist dabei kein spezifisches Merkmal der Vertreter der postcolonial studies, sondern gehört unter bürgerlichen Antikommunisten allgemein zum guten Ton.[11] Muss deshalb also der ganze Marxismus als rassistisch abgetan werden?
Noch sehr viel stärker als diese explizit anti-marxistischen Positionen sind die allgemeinen identitätspolitischen Vorstellungen von „Privilegien“ und „Diskriminierung“ in der Alltagskultur verankert. Identitätspolitik ist in der Regel eine Reaktion auf Diskriminierungserfahrungen und kann allgemein definiert werden als „Kampf einer Minderheit um die Anerkennung des eigenen Selbstverständnisses […] verbunden mit dem Anspruch auf Anerkennung der eigenen Leistungen für die Gesellschaft [und] dem Kampf um gleiche Rechte und gleiche Chancen der Selbstverwirklichung.“ Kennzeichnend für die Identitätspolitik ist „das Bemühen um öffentliche Aufmerksamkeit, […] ihr Hauptfeld ist daher der öffentliche Diskurs.“[12]
Hier also in aller Kürze die wichtigsten Erklärungsmodelle, Argumentationsmuster und Praxisvorstellungen der postmodernen Identitätspolitik (natürlich auch hier wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
(f) Privilegientheorie: Die Privilegientheorie ist keine wissenschaftlich fundierte Theorie, bildet aber dennoch den impliziten Kern der postmodernen Identitätspolitik und gehört zu ihren populärsten Allgemeinplätzen. Wichtigste Grundannahmen dieser Theorie ist, dass sich der Platz den Menschen in der gesellschaftlichen Hierarchie einnehmen vor allem aus ihren Identitätsmerkmalen und deren jeweiliger Kombination ergibt. Bestimmte Identitätsmerkmale sind demnach mit bestimmten „Privilegien“ ausgestattet. Privileg bedeutet in diesem Zusammenhang die „Abwesenheit der negativen Folgen von Diskriminierung“. Während sich also zum Beispiel ein weißer, heterosexueller Mann über einen Platz an der Spitze der sozialen Pyramide freuen darf, findet sich eine schwarze Transfrau unter den am meisten Unterdrückten am unteren Ende wieder. Durch diesen Ansatz wird also impliziert, dass „privilegierte“ Individuen direkt oder indirekt von der Diskriminierung anderer profitieren. „Klasse“ wird auf der Privilegienskala typischerweise gleichwertig neben alle anderen Identitätsmerkmale gestellt (wie z.B. weiß oder heterosexuell sein) und, wenn überhaupt, dann nicht anhand der Stellung zu den Produktionsmitteln, sondern nur gemessen am Einkommen definiert.[13]
(g) Identitätspolitik und Anti-Diskriminierung: Ein mit der Privilegientheorie eng verwandtes Modell, nur spiegelverkehrt gedacht und stärker akademisch verankert, vertreten die verschiedenen Spielarten der Diskriminierungskritik. Zum Gradmesser des sozialen Status werden hier nicht Privilegien, sondern umgekehrt das Betroffensein von Diskriminierung, also die individuelle oder strukturelle Abwertung, Schlechterbehandlung und Benachteiligung von Individuen aufgrund bestimmter Gruppenmerkmale (Hautfarbe, Geschlecht, etc.).[14]Diese Mechanismen werden als wichtige Ursachen von Unterdrückung und sozialer Ungleichheit identifiziert. Theorien, die die Überschneidung und Wechselwirkung zwischen verschiedenen Diskriminierungsdimensionen untersuchen, werden als „Intersektionalismus“-Ansätze zusammengefasst.[15] Die Frage der Klassenzugehörigkeit wird auch hier meist nur als ein Faktor neben anderen behandelt, und zwar oft nicht einmal im Sinne einer objektiven ökonomischen Kategorie, sondern nur als weiteres „gesellschaftlich konstruiertes“ Identitätsmerkmal, das Diskriminierung nach sich zieht (Stichwort: „Klassismus“).[16]
(h) „Wir alle sind Teil des Problems“: Eng mit den Diskriminierungs- bzw. Privilegien-Modellen verbunden ist die Vorstellung, dass „wir alle“ gleichermaßen in dieses System von Privilegien und Diskriminierung „verstrickt“ und durch unser alltägliches Verhalten, z.B. durch ständige „Mikroaggressionen“, auch aktiv an dessen Reproduktion beteiligt sind – die „Privilegierten“ natürlich mehr als die „Diskriminierten“.[17] Die ganze Gesellschaft ist demnach von komplexen „Machtverhältnissen“ zwischen Individuen, Diskursen, Strukturen und Institutionen durchzogen und niemand steht außerhalb derselben. Alle Weißen, so die zentrale Schlussfolgerung, „profitieren“ von Rassismus. Von großer Bedeutung ist diese These zum Beispiel für die akademische Theorieschule der „Rassismuskritik“.[18]
(i) „Check your privilege“: Wenn der Kern des Problems im individuellen Verhalten von „uns allen“ liegt, dann ist es nur naheliegend, dessen Lösung auch dort zu suchen. Als politische Praxis, die zur Überwindung der Ungleichheit beitragen soll, ergibt sich daraus zum Beispiel die Forderung, die eigenen Privilegien zu reflektieren, sich gegenüber Minderheiten „achtsam“ zu verhalten und an seiner eigenen „Awareness“ (Bewusstheit) für die Situation der Betroffenen zu arbeiten. Dadurch soll der alltäglichen Reproduktion von Rassismus und Diskriminierung entgegengewirkt werden. Diese Politik der Aufklärung und Sensibilisierung wird in Deutschland seit Jahren auch von staatlich finanzierten Anti-Diskriminierungs-Stellen und Gleichstellungsbeauftragten verfolgt.[19] In der linken Szene wird „Selbstreflexion“ mit Blick auf Rassismus vor allem unter den Schlagwörtern „critical whiteness“ und „white privilege“ diskutiert und praktiziert.[20]
(j) „Anerkennung“ und „Repräsentation“: Ein Bereich, auf den sich viele Forderungen der Identitätspolitik konzentrieren, ist der der Anerkennung, und Repräsentation. Dabei geht es um die offizielle Anerkennung und Wertschätzung bestimmter Identitätsmerkmale, z.B. durch die Einführung einer dritten Geschlechtskategorie auf Personalausweisen, genderneutralen Toiletten und dergleichen. Mit Repräsentation ist in der Regel gemeint, dass gesellschaftliche Minderheiten auch im öffentlichen „Diskurs“ repräsentiert sein sollen. In Schulbüchern sollen auch Kinder mit dunkler Haut oder Eltern mit Kopftüchern abgebildet und in Netflix-Serien homosexuelle Paare und Transpersonen als teil der gesellschaftlichen Normalität dargestellt werden. Außerdem wird die Repräsentation von Minderheiten in „Machtpositionen“ gefordert, vor allem in Politik und Wirtschaft. Diese Forderungen treten oft auch unter dem Label „Diversity“-Politik auf. Dadurch soll einerseits eine gesellschaftliche „Normalisierung“ von „Vielfalt“ gefördert und andererseits Kindern und Jugendlichen aus Minderheitengruppen Vorbilder an der Spitze der sozialen Pyramide zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie sich identifizieren können.[21]
(k) „Sprache erzeugt und verändert Wirklichkeit“: Ein Großteil der politischen Diskussion der postmodernen Identitätslinken dreht sich um Sprache. Wie soll z.B. richtig gegendert werden (mit *_ oder Binnen „I“), so dass alle Geschlechtsidentitäten mitgedacht sind und sich repräsentiert fühlen? Diskriminierungskategorien wie „Rasse“ oder „Gender“ und die mit diesen jeweils zusammenhängenden „Rollenbilder“ werden als „Konstruktionen“ bezeichnet, die „dekonstruiert“ werden müssten. Hinter all diesen Diskussionen steht die Grundannahme, dass gesellschaftliche Wirklichkeit durch Sprache bzw. Ideologie erzeugt wird und demnach auch durch Veränderung der Sprache bzw. des Denkens verändert werden kann.
(l) „Wer darf sprechen? Wer kann sich solidarisieren?“: Weit verbreitet ist in der postmodernen Identitätslinken auch der Standpunkt, nur Menschen, die selbst von einer bestimmten Form der Diskriminierung betroffen sind, könnten diese auch beurteilen und sich sinnvoll an öffentlichen Debatten darüber beteiligen. Wer sich als Weißer trotzdem zu Rassismus äußert, der handelt sich schnell den Vorwurf des „Paternalismus“ ein oder wird dafür kritisiert, Schwarze Stimmen aus dem Diskurs zu verdrängen. Außerdem wird in Zweifel gezogen, ob wirkliche antirassistische Solidarität zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen überhaupt möglich ist.[22] Anstatt von Solidarität spricht die identitätspolitische Szene mittlerweile vor allem von „Allyship“.
(m) Minderheiten statt Mehrheiten: All diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie zu den „Unterdrückten“, die ein unmittelbares Interesse an der Veränderung der Gesellschaft haben, nur noch Minderheiten und „marginalisierte“ Randgruppen zählen, nicht die Mehrheit der Menschen (also die „Mittelschichts-Christen-Weißbrot-Heten“[23]). Die Mehrheit ist aufgrund ihrer „Privilegien“ und ihrer Beteiligung an der Reproduktion der Verhältnisse aus dieser Sicht grundsätzlich mehr Teil des Problems als Teil der Lösung.
Wer sich ein lebendiges Bild davon machen möchte, wie all diese identitätspolitischen Erklärungsmodelle und Argumentationsmuster sozusagen in Aktion funktionieren, der muss sich nicht unbedingt in ein Uniseminar setzen. Es reicht vollkommen, sich einmal eine Stunde Zeit zu nehmen und auf den Webseiten des Missy Magazins oder der verschiedenen VICE-Ableger (sowas wie das internationale Zentralorgan der postmodernen Identitätslinken) durch die Artikel mit Stichwörtern wie „Identität“, „Privileg“ oder „Diskriminierung“ zu scrollen.[24]
II. Marx und Engels über Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus
Der moderne Rassismus hat seinen Ursprung in der Geschichte des Kolonialismus und der Sklaverei. Ohne eine Theorie des Kapitalismus lässt sich weder diese Geschichte noch die Funktion des Rassismus in heutigen kapitalistischen Gesellschaften verstehen. Es gehört zu den Verdiensten von Karl Marx und Friedrich Engels, eine historisch-materialistische Analyse vorgelegt zu haben, die dieses blutige Kapitel der Menschheitsgeschichte nicht in die Vorgeschichte der modernen Zivilisation oder in die „barbarische“ Welt außerhalb Europas auslagert, wie die bürgerliche Geschichtsschreibung es bis heute teilweise versucht, sondern Kolonialismus und Sklaverei als untrennbar mit der Entstehung und Expansion des europäischen Kapitalismus verbundene Phänomene beschreibt. Und nicht nur das, auf Grundlage der marxistischen Theorie lässt sich auch erklären, warum die damals entstandenen Ungleichheiten innerhalb des kapitalistischen Weltsystems – heute meistens mit den unscharfen Begriffen „globaler Norden“ und „globaler Süden“[25] bezeichnet – bis heute fortwirken und innerhalb des Kapitalismus nicht überwunden werden können. Schauen wir uns nun also anhand einiger längerer Passagen aus den Originaltexten genauer an, was Marx und Engels zu diesem Thema wirklich zu sagen hatten.
Schon in einer seiner ersten politischen Schriften, Das Elend der Philosophie (1847), betont Marx die zentrale Rolle, die die Sklaverei für die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise gespielt hat. Sie war demnach nicht etwa ein bloßer Nebeneffekt der europäischen Industrialisierung, sondern gehörte zu ihren wichtigsten Katalysatoren:
Die direkte Sklaverei ist der Angelpunkt der bürgerlichen Industrie, ebenso wie die Maschinen etc. Ohne Sklaverei keine Baumwolle; ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Nur die Sklaverei hat den Kolonien ihren Wert gegeben; die Kolonien haben den Welthandel geschaffen; und der Welthandel ist die Bedingung der Großindustrie. So ist die Sklaverei eine ökonomische Kategorie von der höchsten Wichtigkeit. (MEW 4, S. 132)[26]
Im Manifest der kommunistischen Partei (1848) beschreiben Marx und Engels die Expansion des Kapitalismus über den gesamten Globus und die Funktion von Kolonialismus und Sklaverei in diesem Prozess. Die Hauptrolle spielten dabei die europäischen Kapitalisten:
Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt gaben dem Handel, der Schiffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung […]
Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen.
[…] Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. […]
Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehn wollen; sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. (MEW 4, S. 463-466)
Aus heutiger Sicht kann man sich leicht an der Sprache und Wortwahl dieses über 170 Jahre alten Textes stören. Das ist eine Ebene, an der postmoderne Kritikerinnen mit Vorliebe ansetzen, wenn sie dem Marxismus ein rassistisches Weltbild unterstellen. Auf der einen Seite stehen die „zivilisierten“ Europäer, auf der anderen Seite die nicht-europäischen „Barbaren“, denen die weiße Bourgeoisie den Fortschritt bringt. Dass Marx und Engels in Wirklichkeit weit davon entfernt waren, ein so schematisches Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen, ist hier schon dadurch angedeutet, dass die bürgerliche Gesellschaft nur als „sogenannte“ Zivilisation bezeichnet wird. Darauf, was genau hinter dieser Ausdrucksweise steckt, werde ich weiter unten zurückkommen, wenn ich näher auf Marx‘ Analyse der britischen Kolonialherrschaft in Indien eingehe.
Die weltweite Expansion des Kapitalismus, die im Kommunistischen Manifest beschrieben wird, beruhte keineswegs auf Freiwilligkeit und gegenseitigem Einverständnis, sondern die „sogenannte Zivilisation“ der Bourgeoisie wurde fast überall mit Hilfe offener Gewalt eingeführt. Auch führte dieser Prozess nicht etwa dazu, dass sich auf kurz oder lang alle Länder gleichermaßen industrialisierten, um schließlich das Entwicklungsniveau der kapitalistischen Zentren zu erreichen. Marx und Engels betonen, dass der Kapitalismus notwendig auf einem Machtgefälle beruht und dauerhaft Ungleichheits- und Abhängigkeitsverhältnisse im globalen Maßstab hervorbringt:
Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. […] Wie sie das Land von der Stadt, hat sie die barbarischen und halbbarbarischen Länder von den zivilisierten, die Bauernvölker von den Bourgeoisvölkern, den Orient vom Okzident abhängig gemacht. (MEW 4, S. 466)
In seinem theoretischen Hauptwerk Das Kapital (1867) unterzieht Marx die Geschichte der kapitalistischen Expansion einer genaueren Analyse. Er beschreibt Kolonialismus und Sklaverei dort als „Hauptelemente der ursprünglichen Akkumulation“, also der gewaltsamen Trennung der Masse der Bauern von ihren Produktionsmitteln und der Anhäufung der ersten großen Kapitalien durch weltweite Plünderung und Raub. Es war dieser Prozess, der die historischen Voraussetzungen für die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt erst herstellte:
Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingebornen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Diese idyllischen Prozesse sind Hauptmomente der ursprünglichen Akkumulation. Auf dem Fuß folgt der Handelskrieg der europäischen Nationen, mit dem Erdrund als Schauplatz. […]
Die verschiednen Momente der ursprünglichen Akkumulation verteilen sich nun, mehr oder minder in zeitlicher Reihenfolge, namentlich auf Spanien, Portugal, Holland, Frankreich und England. In England werden sie Ende des 17. Jahrhunderts systematisch zusammengefaßt im Kolonialsystem, Staatsschuldensystem, modernen Steuersystem und Protektionssystem. Diese Methoden beruhn zum Teil auf brutalster Gewalt, z. B. das Kolonialsystem. Alle aber benutzten die Staatsmacht, die konzentrierte und organisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozeß der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäßig zu fördern und die Übergänge abzukürzen. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz. (MEW 23, S. 779)
Wie man sieht beschreiben Marx und Engels diese „Zivilisierung“ der Welt keineswegs in einem rosigen Licht, wie es unter bürgerlichen Politikern und Ideologen in Europa damals durchaus üblich war, sondern sie schildern die wirkliche Geschichte des Kapitalismus in all ihrer schonungslosen Brutalität. An anderer Stelle schreibt Marx, das Kapital sei „von Kopf bis Zeh, aus allen Poren blut- und schmutztriefend“ zur Welt gekommen. (MEW 23, S. 788)
Das historische Ergebnis der ursprünglichen Akkumulation war schließlich eine „internationalen Arbeitsteilung“, die das kapitalistische Weltsystem in die Machtzentren in Europa und die unterdrückten und abhängigen Regionen in Lateinamerika, Afrika und Asien gliederte:
Wohlfeilheit des Maschinenprodukts und das umgewälzte Transport- und Kommunikationswesen [sind] Waffen zur Eroberung fremder Märkte. Durch den Ruin ihres handwerksmäßigen Produkts verwandelt der Maschinenbetrieb sie zwangsweise in Produktionsfelder seines Rohmaterials. So wurde Ostindien zur Produktion von Baumwolle, Wolle, Hanf, Jute, Indigo usw. für Großbritannien gezwungen. Die beständige „Überzähligmachung” der Arbeiter in den Ländern der großen Industrie befördert treibhausmäßige Auswandrung und Kolonisation fremder Länder, die sich in Pflanzstätten für das Rohmaterial des Mutterlands verwandeln, wie Australien z.B. in eine Pflanzstätte von Wolle. Es wird eine neue, den Hauptsitzen des Maschinenbetriebs entsprechende internationale Teilung der Arbeit geschaffen, die einen Teil des Erdballs in vorzugsweis agrikoles Produktionsfeld für den andern als vorzugsweis industrielles Produktionsfeld umwandelt. (MEW 23, S. 474-475)
Die Welt gliederte sich von nun an also in eine koloniale und halb-koloniale Zone, in der schwarze und indigene Sklaven sowie unter quasi-feudalen Verhältnissen lebende Kleinbauern Rohstoffe produzierten, und in kapitalistische Länder, in denen die „doppelt freien“ weißen Lohnarbeiter (frei von Leibeigenschaft, aber auch gewaltsam „befreit“ von ihren Produktionsmitteln) diese Rohmaterialien zu Industrieprodukten verarbeiteten. Der größte Teil der Profite konzentrierte sich in den Händen der weißen Bourgeoisie in den europäischen Metropolen, was sowohl die Ungleichheit im globalen Maßstab als auch zwischen Arbeitern und Kapitalisten in den Industrieländern stetig vergrößerte.
Die internationale Arbeitsteilung verlief also objektiv entlang der „Rassengrenzen“, das heißt entlang unterschiedlicher Phänotypen und Hautfarben. Der „Rassenunterschied“, der es den Europäern möglich machte sich den Großteil der Weltbevölkerung zu unterwerfen, war allerdings weder in deren biologischer Überlegenheit begründet, wie es die damaligen rassistischen Ideologien behaupteten, noch war er einfach „diskursiv konstruiert“, wie es die idealistischsten Spielarten der postcolonial studies nahelegen.[27] Er hatte seine materielle Grundlage in der überlegenen Produktionsweise und Bewaffnung der europäischen Eroberer und Kolonialherren. Trotzdem ist das holzschnittartige identitätspolitische Geschichtsbild, das in allen Weißen die Gewinner von Kolonialismus und Sklaverei sehen will, angesichts der historischen Tatsachen nicht haltbar. Wie Marx im Kapital akribisch nachweist, war die Kehrseite der ursprünglichen Akkumulation in den Kolonien das Massenelend der Arbeiterklasse in den großen Industriestädten, wo Männer, Frauen und Kinder für einen sprichwörtlichen Hungerlohn täglich Schichten von bis zu 18 Stunden arbeiteten und im Durchschnitt kaum älter als 30 Jahre wurden. Der Lebensstandard der Arbeiter in den Industriezentren begann sich nur deshalb allmählich zu verbessern, weil es ihnen gelang die Bourgeoisie im Klassenkampf schrittweise zu Zugeständnissen zu zwingen. Erst mit dem Übergang des Kapitalismus in sein imperialistisches Stadium (also kurz vor dem Ersten Weltkrieg) begann die Bourgeoisie ihre Extraprofite dazu zu nutzen, einen Teil der Arbeiter zu „bestechen“, wodurch eine neue Schicht von „Arbeiteraristokraten“ entstand.[28] Nochmals einige Jahrzehnte später, unter den besonderen Bedingungen des Nachkriegsbooms und der Systemkonkurrenz nach 1945, erreichte ein größerer Teil der weißen Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern einen materiellen Lebensstandard, der spürbar über dem nackten Existenzminimum lag und sich deutlich von dem der Mehrheit der Menschen in der Dritten Welt unterschied.
Das Kommunistische Manifest betont ausdrücklich und mit großem Pathos die revolutionäre und fortschrittliche Rolle, die die Bourgeoisie im Kampf gegen den Feudalismus und den Absolutismus spielte. Es waren die bürgerlichen Revolutionen, die die Masse der arbeitenden Menschen aus der Leibeigenschaft befreit, erste demokratische Rechte und Freiheiten etabliert (wenn auch zunächst nur für die besitzenden Klassen) und den Boden für eine organisierte Arbeiterbewegung und eine allmähliche Verbesserung der Lebensbedingungen überhaupt erst geebnet hatten. Nun war die Bourgeoisie aber selbst zur herrschenden Klasse geworden, meist im Bündnis mit den Resten der feudalen Grundbesitzer und des Adels, und damit ins Lager der Reaktion übergelaufen. Ihr Klasseninteresse stand dem Menschheitsfortschritt von nun an entgegen, und dieser konnte nun nur noch gegen und nicht mehr mit oder durch die Bourgeoisie erkämpft werden. Sie benutzte die Staatsmacht von nun an, um die Arbeiterklasse zu unterdrücken, die zahlenmäßig immer weiter anwuchs und in allen kapitalistischen Ländern begann, sich zu organisieren.
Als neue herrschende Klasse war die Bourgeoisie allerdings in ein ideologisches Dilemma geraten. Hatte sie in ihrer fortschrittlichen Phase im Kampf gegen Absolutismus und Feudalismus noch die Ideale von „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ auf ihr Banner geschrieben, um die armen Volksschichten als ihre revolutionären Fußtruppen auf die Barrikaden zu rufen, so setzte sich mit ihrer Klassenherrschaft nun auf dem ganzen Erdball eine Produktionsweise durch, die die Arbeiter in den Fabriken Europas zu bloßen Arbeitstieren und die Sklaven auf den Plantagen in Lateinamerika und den nordamerikanischen Südstaaten zu vollkommen rechtlosen Produktionsinstrumenten im Privateigentum ihrer weißen „Meister“ degradierten. Diese millionenfache Entmenschlichung unter dem Deckmantel von „Fortschritt“ und „Zivilisation“ bedurfte einer Legitimation. Die alten Herrschaftsideologien der feudalen Ständegesellschaften, die vor allem auf religiösen Vorstellungen einer „göttlichen Ordnung“ beruht hatten, waren durch die Aufklärung und die bürgerlichen Revolutionen zerstört worden und konnten diesen Zweck nicht mehr erfüllen. Die Ideologen der Bourgeoise mussten also eine scheinbar „rationale“ Erklärung dafür liefern, warum sich in der Herrschaft des Kapitals zwar angeblich immer noch „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ verwirklichten, warum aber nur besitzende weiße Bürger zum exklusiven Kreis dieser freien „Menschheit“ gehörten. Mit Blick auf die Sklaven und unterdrückten Kolonialvölker erfüllte der zunächst philosophisch und später auch „naturwissenschaftlich“ begründete moderne Rassismus genau diesen Zweck der Entmenschlichung.[29] Er formulierte eine scheinbar plausible Begründung für die weltweite Hierarchie zwischen den „Rassen“, indem er aus bestimmten äußeren Merkmalen großer Menschengruppen, allen voran der Hautfarbe, angeblich überhistorische „natürliche“ Charaktereigenschaften ableitete. Der Rassismus naturalisiert also von Menschen gemachte gesellschaftliche Verhältnisse und erklärt sie damit zu unveränderbaren „biologischen“ Tatsachen.[30]
Anknüpfend an Marx und Engels kann also festgehalten werden, dass der moderne Rassismus nicht deshalb in die Welt kam, weil weißen Männern in Europa eines Tages die Idee dazu kam oder weil es in irgend einer abstrakten Natur des Menschen liegt, sich auf Grundlage äußerer Merkmale gegenseitig abzuwerten und auszubeuten. Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein, nicht umgekehrt. Die ökonomische Grundlage für den Rassismus wurde durch die weltweite Expansion der kapitalistischen Produktionsweise geschaffen. Diese ökonomische Basis hatte eine neue herrschende Klasse an die Macht gebracht und damit die Notwendigkeit eines neuen politisch-ideologischen Überbaus erzeugt.[31] Ein Kernelement dieses neuen Überbaus war der Rassismus und die Lehre von der „weißen Überlegenheit“ und „Vorherrschaft“. Diese Ideologien waren eine Folge, nicht die Ursache der kapitalistischen Expansion, des Kolonialismus und der Sklaverei.
Marx und Engels belassen es in ihren Schriften nicht dabei, die Grausamkeiten anzuprangern, die der Kapitalismus über die Welt gebracht hat, sondern sie betonen auch die Potentiale der Befreiung, die sich in seinem Schoß notwendig entwickeln. Der Kapitalismus bringt nicht nur riesige neue Produktivkräfte hervor, sondern er produziert in Gestalt des Proletariats auch seine eigenen „Totengräber“ (MEW 4, S. 474) – eine Klasse, deren historische Mission darin besteht, die Herrschaft der Bourgeoisie zu stürzen und eine Welt ohne Privateigentum an den Produktionsmitteln, ohne Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und letztlich ohne Klassen zu errichten. Als „revolutionäres Subjekt“, das diese historische Mission erfüllen sollte, kam für Marx und Engels zu der Zeit, als sie das Kommunistische Manifest verfassten, noch ausschließlich die Arbeiterklasse in den Metropolen in Frage. Dass sie diese Sichtweise, die von Vertretern der postcolonial studies häufig als „eurozentristisch“ kritisiert wird, später deutlich relativierten, soll weiter unten belegt werden.
Da der Kapitalismus den ganzen Globus umspannt, so argumentieren Marx und Engels, können die Arbeiter den Klassenkampf gegen die Bourgeoisie nur dann gewinnen, wenn sie sich, genau wie ihre Feinde, über alle nationalen Grenzen hinweg als Klasse organisieren. Seit dem Kommunistischen Manifest gehört die „internationale Solidarität“ zu den wichtigsten Grundprinzipien der Arbeiterbewegung:
“Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. […] In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere aufgehoben.
Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander. […] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!” (MEW 4, S. 479, 493)
Erst in der klassenlosen Gesellschaft, so also die Argumentation, kann die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander – und dazu zählt auch das Ausbeutungsverhältnis zwischen imperialistischen Zentren und unterdrückten Ländern – die der Kapitalismus durch die Konkurrenz notwendig hervorbringt, endgültig überwunden werden. Eine wenig bekannte Tatsache ist, dass Marx in diesem Zusammenhang die Aufhebung der Sklaverei explizit als ein wesentliches Moment der Emanzipation der Arbeiterklasse insgesamt betrachtete. Aus dem Kapital stammt dazu folgende Formulierung:
“In den Vereinigten Staaten von Nordamerika blieb jede selbständige Arbeiterbewegung gelähmt, solange die Sklaverei einen Teil der Republik verunstaltete. Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Aber aus dem Tod der Sklaverei entsproß sofort ein neu verjüngtes Leben. Die erste Frucht des Bürgerkriegs war die Achtstundenagitation, mit den Siebenmeilenstiefeln der Lokomotive vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean ausschreitend, von Neuengland bis nach Kalifornien.” (MEW 23, S. 316-318)
Solange die Sklaverei existierte bildete diese eine mächtige Waffe in der Hand der Bourgeoise gegen die Arbeiterbewegung, da sie den offen versklavten Teil der Arbeiterschaft aus allen ökonomischen und politischen Kämpfen ausschloss und es dem Kapital dadurch dauerhaft ermöglichte, die Löhne auf ein Existenzminimum zu drücken und jede effektive Klassensolidarität zu unterbinden. Die freien weißen Arbeiter, so sehr sie subjektiv sogar den Rassismus der Sklavenhalter und die Ideologie der „white supremacy“ verinnerlicht haben mochten, profitierten letztlich nicht von der Sklaverei, sondern sie hinderte sie daran, sich selbständig als Klasse zu organisieren und für ihre Interessen zu kämpfen.
Wie positionierten sich Marx und Engels zu den konkreten antikolonialen Befreiungskämpfen ihrer Zeit? Diese Frage lässt sich am besten anhand einer Artikelserie über die britische Herrschaft in Indien und die aufkeimende Widerstandsbewegung untersuchen, die Marx 1853 für die Zeitung New York Daily Tribune verfasste. Dort argumentiert Marx zunächst, dass die britische Kolonialmacht, anders als von den damaligen Ideologen der britischen Bourgeoisie unermüdlich behauptet, den Menschen in Indien keineswegs vor allem sozialen Fortschritt und Zivilisation brachten:
“Alle Maßnahmen, zu denen die englische Bourgeoisie möglicherweise genötigt sein wird, werden der Masse des [indischen] Volkes weder die Freiheit bringen noch seine soziale Lage wesentlich verbessern, denn das eine wie das andere hängt nicht nur von der Entwicklung der Produktivkräfte ab, sondern auch davon, daß das Volk sie selbst in Besitz nimmt. Auf alle Fälle aber wird die Bourgeoisie die materiellen Voraussetzungen für beides schaffen. Hat die Bourgeoisie jemals mehr geleistet? Hat sie je einen Fortschritt zuwege gebracht, ohne Individuen wie ganze Völker durch Blut und Schmutz, durch Elend und Erniedrigung zu schleifen?
Die Inder werden die Früchte der neuen Gesellschaftselemente, die die britische Bourgeoisie in ihrem Lande ausgestreut, nicht eher ernten, bis in Großbritannien selbst die heute herrschenden Klassen durch das Industrieproletariat verdrängt oder die Inder selbst stark genug geworden sind, um das englische Joch ein für allemal abzuwerfen.” (MEW 9, S. 224)
Der Kolonialismus selbst bringt also nur die Produktivkräfte. Unter kapitalistischen Verhältnissen und innerhalb der kolonialen Abhängigkeit sind diese aber Mittel der Ausbeutung, nicht der Befreiung. Ihr befreiendes Potential können diese Produktivkräfte, genau wie in den kapitalistischen Metropolen auch, erst dann entfalten, wenn eine Revolution die sozialen Verhältnisse erneut grundsätzlich umwälzt und die Produktionsmittel aus dem Privateigentum der Bourgeoisie befreit um sie zum Eigentum des ganzen Volkes zu machen. Ein mögliches Szenario dafür wäre eine sozialistische Revolution in Großbritannien, die der Kolonialherrschaft in Indien ein Ende setzen würde – gleichzeitig zieht Marx hier aber auch ein Szenario in Betracht, in dem es den Kolonisierten zuerst gelingt, die Kolonialmacht zu schlagen und sich selbst zu befreien.
Marx Sichtweise auf die „sogenannte“ Zivilisation der weißen Kapitalbesitzer, die uns bereits im Kommunistischen Manifest begegnet ist, wird aus dem folgenden längeren Abschnitt ersichtlich:
“Die tiefe Heuchelei der bürgerlichen Zivilisation und die von ihr nicht zu trennende Barbarei liegen unverschleiert vor unseren Augen, sobald wir den Blick von ihrer Heimat, in der sie unter respektablen Formen auftreten, nach den Kolonien wenden, wo sie sich in ihrer ganzen Nacktheit zeigen. […]
Die verheerenden Wirkungen der englischen Industrie auf Indien, ein Land von der Größe Europas, mit einer Fläche von 150 Millionen Acres, treten erschütternd zutage. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, daß sie nur das organische Ergebnis des gesamten Produktionssystems sind, so wie es heute besteht. Grundlage dieser Produktion ist die absolute Herrschaft des Kapitals. Wesentlich für die Existenz des Kapitals als einer unabhängigen Macht ist die Zentralisation des Kapitals. Der zerstörende Einfluß dieser Zentralisation auf die Märkte der Welt enthüllt nur in gigantischem Ausmaß die immanenten organischen Gesetze der politischen Ökonomie, die heute in jedem zivilisierten Gemeinwesen wirksam sind. Die bürgerliche Periode der Geschichte hat die materielle Grundlage einer neuen Welt zu schaffen: einerseits den auf der gegenseitigen Abhängigkeit der Völker beruhenden Weltverkehr und die hierfür erforderlichen Verkehrsmittel, andererseits die Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte und die Umwandlung der materiellen Produktion in wissenschaftliche Beherrschung der Naturkräfte.
Bürgerliche Industrie und bürgerlicher Handel schaffen diese materiellen Bedingungen einer neuen Welt in der gleichen Weise, wie geologische Revolutionen die Oberfläche der Erde geschaffen haben. Erst wenn eine große soziale Revolution die Ergebnisse der bürgerlichen Epoche, den Weltmarkt und die modernen Produktivkräfte, gemeistert und sie der gemeinsamen Kontrolle der am weitesten fortgeschrittenen Völker unterworfen hat, erst dann wird der menschliche Fortschritt nicht mehr jenem scheußlichen heidnischen Götzen gleichen, der den Nektar nur aus den Schädeln Erschlagener trinken wollte.” (MEW 9, S. 224-226)
Marx war also weit davon entfernt, die kapitalistischen Länder und ihre weißen Bewohner als die Träger der Zivilisation zu sehen, deren historische Mission es war, den „barbarischen Völkern“ dunkler Haut den Fortschritt zu bringen. Marx sah den kapitalistischen Fortschritt selbst als einen zutiefst widersprüchlichen Prozess, mit dem die grausamsten Formen der Barbarei untrennbar verbunden waren. Den Opfern dieser Barbarei standen Marx und Engels keineswegs gleichgültig gegenüber, sondern sie widmeten ihr ganzes Leben der Aufgabe, in praktisch-politischen und theoretisch-ideologischen Kämpfen für sie Partei zu ergreifen und am Umsturz der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu arbeiten.
Mit dem wesentlichen Ziel des Marxismus, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“ (MEW 1, S. 385), waren nie nur weiße Menschen gemeint, sondern die gesamte arbeitende Menschheit. Ihre eigene Aufgabe versteht die marxistische Theorie darin, die „Bewegungsgesetze“ der gesellschaftlichen Entwicklung aufzudecken. Der Zweck dieser wissenschaftlichen Analyse ist es, der Menschheit zu ermöglichen bewusst in die Geschichte eingreifen und so die notwendige Barbarei des Fortschritts auf ein Minimum zu reduzieren. Im Kapital schreibt Marx:
Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur gekommen ist – und es ist der letzte Endzweck dieses Werks, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen –, kann sie naturgemäße Entwicklungsphasen weder überspringen noch wegdekretieren. Aber sie kann die Geburtswehenabkürzen und mildern. (MEW 23, S. 15-16)
Es sind jedoch nicht die vernünftige Einsicht und das Mitgefühl der herrschenden Klasse, sondern allein die konkreten Kämpfe der Ausgebeuteten und Unterdrückten auf der ganzen Welt, die mit diesen philosophischen Waffen gerüstet die Geburtswehen der Geschichte abkürzen können. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es vor allem die nationalen und antikolonialen Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die in diesem Sinne an das theoretische Erbe des Marxismus anknüpften und von Kuba bis Vietnam, von Angola bis El Salvador dem Imperialismus den Kampf ansagten. Keine andere politische Theorie hat für die realen Befreiungskämpfe der nicht-weißen Weltbevölkerung eine wichtigere Rolle gespielt als der angeblich „eurozentristische“ und „rassistische“ Marxismus.
Entwickelten Marx und Engels zu ihren Lebzeiten auch schon einen expliziten Standpunkt zur Rolle und Funktion der rassistischen Unterdrückung im Kapitalismus? Der Begriff Rassismus, wie er heute verwendet wird, war zu Marx und Engels Lebzeiten noch nicht gebräuchlich, folglich wird man dazu in ihren Schriften auch nicht fündig. Das heißt allerdings nicht, dass sie sich nicht mit dem Problem der Spaltung der Arbeiterklasse durch rassistische und nationale Vorurteile und die Funktion solcher Spaltungsmechanismen für den Kapitalismus beschäftigt hätten. Besonders interessant und aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang ihre Texte über den „Antagonismus zwischen irischen und englischen Proletariern“.
Kurz zum historischen Hintergrund: Irland war von 1801 bis 1922 de facto eine Kolonie Großbritanniens. Der Großteil der irischen Bevölkerung lebte in bitterer Armut und ohne politische Rechte. Mitte des 19. Jahrhunderts führte eine große Hungersnot dazu, dass Millionen von Iren verhungerten oder gezwungen waren, nach England oder in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einem starken Anwachsen der irischen Widerstandsbewegung, die durch die britische Besatzungsmacht blutig unterdrückt wurde. Aus heutiger Sicht mag das sehr befremdlich erscheinen, da Menschen irischer Abstammung heute in der Regel einfach als „Weiße“ wahrgenommen werden, aber in England grassierte damals ein aggressiver anti-irischer Rassismus, der genau wie der Rassismus gegen Schwarze in den USA auf äußerliche Merkmale („Physiognomie“), sozialdarwinistische Argumentationsmuster und eine Reihe tradierter kultureller und religiöser Vorurteile zurückgriff.
1870 kam es in der Internationalen Arbeiter-Assoziation zu scharfen Auseinandersetzungen, da die Vertreter der britischen Sektion gefordert hatten, die irische Sektion solle ihnen organisatorisch untergeordnet werden. Damit war zugleich die Vorstellung verbunden, der nationale Unabhängigkeitskampf der Iren solle dem Klassenkampf des britischen Proletariats hintenangestellt werden, da die Emanzipation Irlands ohnehin nur durch den Sieg der Arbeiter in Großbritannien zu erreichen sei. Marx und Engels vertraten dagegen den Standpunkt, die Unabhängigkeit der irischen Sektion müsse unbedingt bewahrt bleiben und die Internationale solle alles dafür tun, um den Befreiungskampf des irischen Volkes zu unterstützen. In einem geheimen Rundschreiben, das an alle Sektionen der Internationale verschickt wurde, erläuterten Marx und Engels ihre Position zu Irland und analysierten dabei vor allem die Funktion, die die rassistische Spaltung der Arbeiterklasse für die Herrschaft der englischen Bourgeoisie erfüllte:
[…] die englische Bourgeoisie [hat] das irische Elend nicht nur ausgenutzt, um durch die erzwungene Einwanderung der armen Iren die Lage der Arbeiterklasse in England zu verschlechtern, sondern sie hat überdies das Proletariat in zwei feindliche Lager gespalten. Das revolutionäre Feuer des keltischen [d.h. irischen] Arbeiters vereinigt sich nicht mit der soliden, aber langsamen Natur des angelsächsischen Arbeiters. Im Gegenteil, es herrscht in allen großen Industriezentren Englands ein tiefer Antagonismus zwischen dem irischen und englischen Proletarier. Der gewöhnliche englische Arbeiter haßt den irischen als einen Konkurrenten, der die Löhne und den Standard of life herabdrückt. Er empfindet ihm gegenüber nationale und religiöse Antipathien. Er betrachtet ihn fast mit denselben Augen, wie die poor whites der Südstaaten Nordamerikas die schwarzen Sklaven betrachteten.Dieser Antagonismus zwischen den Proletariern in England selbst wird von der Bourgeoisie künstlich geschürt und wachgehalten. Sie weiß, daß diese Spaltung das wahre Geheimnis der Erhaltung ihrer Macht ist. (MEW 16, S. 416)
Die Spaltung der Arbeiterklasse verläuft hier also entlang von zwei deckungsgleichen Linien: Einerseits sind die irischen Arbeiter objektiv ökonomisch und politisch schlechter gestellt und können aufgrund ihrer Armut durch die Bourgeoisie dazu gezwungen werden, die Konkurrenz zu verschärfen, als Streikbrecher zu fungieren und den Lohndruck zu erhöhen, was sich negativ auf die Lebensverhältnisse der englischen Arbeiter auswirkt. Gleichzeitig wird diese objektive Trennungslinie durch die subjektive Abneigung der beiden Gruppen gegeneinander (kulturelle und religiöse Vorurteile etc.) noch verstärkt. Die englischen sehen die irischen Arbeiter als Ursache ihres Elends, die irischen Arbeiter sehen ihre englischen Kollegen als ihnen gegenüber privilegiert. Diese subjektive Spaltung muss nicht erst durch Manipulation erzeugt werden, da sie ihre Grundlage in der ökonomischen Basis und den historisch tradierten kulturellen Differenzen selbst hat, sie wird durch die Bourgeoisie aber bewusst ausgenutzt und von außen künstlich angeheizt. Der einzige Weg zur Überwindung der objektiven Spaltung liegt im gemeinsamen Kampf für die ökonomische Gleichstellung und damit die Verbesserung der Position aller Arbeiter – diese hat allerdings zuerst die Überwindung der subjektiven Spaltung als Voraussetzung. Marx und Engels schreiben weiter:
“Dieser Antagonismus wiederholt sich auch jenseits des Atlantik. Die von ihrem heimatlichen Boden durch Ochsen und Hammel vertriebenen Iren finden sich in den Vereinigten Staaten wieder, wo sie einen ansehnlichen und ständig wachsenden Teil der Bevölkerung bilden. Ihr einziger Gedanke, ihre einzige Leidenschaft ist der Haß gegen England. Die englische und die amerikanische Regierung, das heißt die Klassen, welche sie repräsentieren, nähren diese Leidenschaften, um den Kampf zwischen den Nationen zu verewigen, der jede ernsthafte und aufrichtige Allianz zwischen den Arbeiterklassen zu beiden Seiten des Atlantik und folglich deren gemeinsame Emanzipation behindert.
Irland ist der einzige Vorwand der englischen Regierung, um eine große stehende Armee zu unterhalten, die im Bedarfsfalle, wie es sich gezeigt hat, auf die englischen Arbeiter losgelassen wird, nachdem sie in Irland zur Soldateska ausgebildet wurde. Schließlich wiederholt sich im England unserer Tage das, was uns das Alte Rom in ungeheurem Maßstab zeigte. Das Volk, das ein anderes Volk unterjocht, schmiedet seine eigenen Ketten.
Der Standpunkt der Internationalen [Arbeiter-] Assoziation in der irischen Frage ist also völlig klar. Ihre erste Aufgabe ist es, die soziale Revolution in England zu beschleunigen. Zu diesem Zwecke muß man den entscheidenden Schlag in Irland führen.
[Es ist,] abgesehen von jeglicher internationaler Gerechtigkeit, eine Vorbedingung für die Emanzipation der englischen Arbeiterklasse, die bestehende Zwangsunion – das heißt der Versklavung Irlands – in eine gleiche und freie Konföderation umzuwandeln, wenn das möglich ist, oder die völlige Trennung zu erzwingen, wenn es sein muß.” (MEW 16, S. 416-417)
Die rassistische Spaltung der Arbeiterklasse innerhalb einer Nation hat also auch eine außenpolitische Dimension und wird von der Bourgeoisie dazu genutzt, einerseits die feindliche Haltung der konkurrierenden Kapitale und Nationen gegeneinander auch in den Massen zu schüren und im selben Zuge die internationale Solidarität der Arbeiter im Kampf gegen ihre jeweils einheimische Bourgeoisie zu untergraben.
Der entscheidende Punkt, den Marx und Engels hier machen, ist der, dass der „privilegierte“ Teil der Arbeiterklasse letztlich weder von der rassistischen Diskriminierung eines Teils seiner Klassenbrüder und -schwestern im eigenen Land, noch von der kolonialen Unterdrückung anderer Völker profitiert (von der oben bereits erwähnten Arbeiteraristokratie vielleicht abgesehen). Lässt sich das einheimische Proletariat für diese Spaltungspolitik instrumentalisieren, so hilft es damit nur der Bourgeoisie, seine „eigenen Ketten“ zu schmieden. Interessant ist an der zitierten Textstelle zum irischen Widerstand außerdem, dass Marx und Engels hier die Selbstbefreiung der Kolonisierten explizit als Voraussetzung für die Befreiung der Arbeiterklasse im kolonialen Mutterland sehen. Hier wartet die Peripherie also nicht auf die heroische Tat des weißen Proletariats in der Metropole, sondern die rassistisch Unterdrückten sind umgekehrt der Schlüssel für dessen Befreiung.
Marx und Engels Analyse lässt sich sehr gut auf die Gegenwart übertragen. In Israel und Palästina herrscht heute zum Beispiel in sehr zugespitzter Form ein ähnlich widersprüchliches Spaltungsverhältnis. Viele jüdisch-israelische Arbeiter mögen den anti-arabischen Rassismus tief verinnerlicht haben und sind vielleicht selbst glühende Zionisten. Von vielen besonderen Unterdrückungsformen, die für palästinensische Arbeiter zum Alltag gehören, sind sie nicht betroffen. Sie müssen nicht täglich Checkpoints passieren, sind nicht dem ständigen „racial profiling“ von Militär und Polizei ausgesetzt, werden nicht von Siedlern und Armee aus ihren Häusern vertrieben und haben offenen Zugang zum israelischen Arbeits- und Wohnungsmarkt. Im Rahmen der Siedlungsprogramme haben sie als Siedler sogar die Möglichkeit, auf Kosten der Palästinenser unmittelbar von einer Reihe staatlich vermittelter Vorteile zu profitieren. Gleichzeitig haben die israelischen Arbeiter allen Grund, ihre palästinensischen Kollegen als Lohndrücker zu hassen. Armut und Verzweiflung zwingen sie dazu, jede Arbeit zu noch so schlechten Bedingungen anzunehmen. Überwinden ließe sich dieser Zustand aber nur durch die gemeinsame Aktion der ganzen Klasse und durch die ökonomische Gleichstellung und politische Emanzipation der Palästinenser. Die israelische Armee nutzt die rassistische Spaltung der Arbeiterklasse auf allen innen- und außenpolitischen Ebenen. Der autoritär zugerichtete israelische Staat und seine militärisch-polizeilichen Repressionsapparate beziehen ihre Legitimität aus dem ständigen Kriegszustand und der Besatzungspolitik, die gleichzeitig eine nicht versiegende Quelle kampferfahrener, ideologisch gefestigter und verrohter Kämpfer darstellt. Diese Truppen stehen jederzeit bereit auch Streiks und Proteste der israelischen Arbeiterklasse innerhalb der eigenen Staatsgrenzen zu unterdrücken.
III. Zur Kritik des Antimarxismus der postcolonial studies
Fassen wir nun also die wichtigsten Punkte einer marxistischen Analyse zum Zusammenhang von Rassismus und Kapitalismus zusammen: (1) Die Sklaverei und der Kolonialismus standen nicht außerhalb der kapitalistischen „Zivilisation“, sondern waren selbst Momente ihrer Entstehung. Der Rassismus ist vor dem Hintergrund dieser ökonomischen Basis als neue Legitimationsideologie, also als Element des Überbaus entstanden. Er ist nicht die Ursache, sondern ein Symptom der gesellschaftlichen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse, die den Wesenskern des Kapitalismus ausmachen. (2) Es ist diese ökonomische Basis, die die Arbeiterklasse in ständige Konkurrenz untereinander zwingt und damit den Nährboden bereitet, auf dem sich die Spaltungsmechanismen reproduzieren können. Die Bourgeoisie schürt diese Konflikte und nutzt sie systematisch für ihre eigene Herrschaftssicherung. (3) Auch der jeweils „privilegierte“ Teil der Arbeiterklasse profitiert letztlich nicht von kolonialer Unterdrückung und rassistischer Spaltung, sondern er hat ein objektives Interesse an deren Überwindung. Der Rassismus ist ein Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie, sie hat ein aktives Interesse an der Aufrechterhaltung und künstlichen Befeuerung seiner Spaltungspotentiale. Der weiße Prolet, der Rassismus reproduziert, schmiedet damit seine eigenen Ketten.
Davon ausgehend komme ich nun also zurück zu den anti-marxistischen Positionen und Vorurteile der postmodernen Identitätslinken.
(a-b) Ist der Marxismus „klassenreduktionistisch?
Stellten sich Marx und Engels das Proletariat wirklich als eine homogene Masse weißer Industriearbeiter in den europäischen Metropolen vor, deren einzig relevantes Identitätsmerkmal ihre Klassenzugehörigkeit war? Und „idealisierten“ und „heroisierten“ sie dieses revolutionäre Subjekt wirklich, wie von post-kolonialen Theoretikerinnen oft behauptet? Wie wir gesehen haben und wie sich an unzähligen weiteren Texten belegen ließe, sind diese Behauptungen völlig aus der Luft gegriffen. Marx und Engels analysierten das konkrete historische Proletariat ihrer Zeit in all seiner Vielfalt und ohne seine inneren Widersprüche auszublenden. Sie zählten zur Arbeiterklasse nicht nur weiße männliche Industriearbeiter, sondern auch Frauen, Kinder, Arbeitsmigranten, Land- und Wanderarbeiteinnen, Tagelöhner sowie die verschiedenen ethnischen Gruppen, aus denen sich das wirkliche Proletariat ihrer Zeit weltweit zusammensetzte.[32]
Besonders der hier zitierte Text zum Antagonismus zwischen irischen und englischen Arbeitern zeigt zudem, dass Marx und Engels der Tatsache gegenüber keineswegs blind waren, dass reaktionäre Ideologien wie Rassismus und nationalistische Vorurteile auch in der Arbeiterklasse auf fruchtbaren Boden fielen. Diese Bewusstseinsformen entstehen aufgrund der gegebenen ökonomischen Basis sogar notwendig und müssen innerhalb der Arbeiterklasse ständig bekämpft werden – wie es Marx und Engels in der Internationale mit Blick auf die chauvinistische Haltung der englischen Sektion zur irischen Frage ja auch konkret taten. Von einer „Idealisierung“ oder „Heroisierung“ kann also kaum die Rede sein. Im Gegensatz zu allen identitätspolitischen Ansätzen, die ihren Hauptfokus auf die verschiedenen Spaltungslinien richten, betont der Marxismus allerdings immer das objektive gemeinsame Klasseninteresse des ganzen Proletariats und damit die historische Möglichkeit und Notwendigkeit seiner Einheit.
(c) Behandelten Marx und Engels Identitätsfragen nur als „Nebenwidersprüche“?
Wie wir gesehen haben entspricht es nicht Marx‘ und Engels‘ Sichtweise, die Spaltungen innerhalb der Arbeiterklasse als bloße „Nebenwidersprüche“ abzutun, die dem „Hauptwiderspruch“ nachgeordnet sind oder unvermittelt neben diesem stehen. Dieses Verständnis von Haupt- und Nebenwidersprüchen geht ursprünglich auf Mao Tse-Tungs Schrift Über den Widerspruch (1937) zurück und wurde zum Beispiel von einigen der sogenannten K-Gruppen der 1970er Jahre tatsächlich im Zusammenhang mit der Frauenfrage vertreten. Marx bezeichnet den Widerspruch zwischen dem „gesellschaftlichen Charakter der Produktion“ und der „privaten/kapitalistischen Aneignung des Produkts“ als den „Grundwiderspruch“ der kapitalistischen Produktionsweise. Keine einzige der fast 150 Fundstellen zum Begriff „Widerspruch“ im Register der Marx-Engels-Werke lässt sich jedoch im Sinne des maoistischen Verständnisses von „Haupt- und Nebenwiderspruch“ interpretieren. Dennoch wird diese Sichtweise dem Marxismus aus postmoderner und identitätspolitischer Richtung permanent unterstellt, ohne dass sich die Mühe gemacht würde, dies anhand der Originaltexte zu belegen.[33]
Ganz im Gegensatz zur postmodernen Identitätslinken, die verschiedene Identitätsmerkmale willkürlich und gleichwertig nebeneinanderstellt, betrachten Marx und Engels die rassistische Spaltung des Proletariats nie als von der Klassenfrage losgelöstes oder unabhängig von ihr existierendes Phänomen. Wenn es stimmt, dass sich „die Arbeit in der weißen Haut nicht dort befreien kann, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird“, dass „ein Volk, das ein anderes versklavt, seine eigenen Ketten schmiedet“ und dass die Arbeiterklasse die Bourgeoisie nur dann schlagen kann, wenn sie ihre innere Gespaltenheit überwindet, dann steht der „Rassenwiderspruch“ nicht unvermittelt neben dem Klassenwiderspruch, sondern er ist ein Aspekt desselben.
Die Ablehnung der schematischen Lehre von Haupt- und Nebenwidersprüchen bedeutet allerdings nicht, dass im Umkehrschluss alle gesellschaftlichen Widersprüche für den Klassenkampf gleich wichtig sind. Kommunistinnen muss klar sein, dass jede revolutionäre Strategie und Taktik immer notwendige Priorisierungen vornehmen muss. Es ist objektiv unmöglich zu jedem Zeitpunkt alle Kämpfe gleichwertig zu behandeln. Dieser Anspruch führt unweigerlich in die Zersplitterung der Kräfte und letztlich in die Handlungsunfähigkeit. Der Klassenkampf macht es notwendig, den Großteil der Kapazitäten auf jene Kampffelder zu konzentrieren, auf denen sich in einer gegebenen historischen Situation die Kämpfe am stärksten gegen das Kapital und die Herrschaft der Bourgeoisie zuspitzen, auf denen das größte Mobilisierungspotenzial besteht und die daher die voraussichtlich größte revolutionäre Sprengkraft entfalten werden. Welche Kampffelder das jeweils sein werden lässt sich nicht mechanisch vorhersagen und hängt sowohl von den historisch gewachsenen Strukturen jeder Gesellschaft (Klassenstruktur, kulturelle Zusammensetzung, geopolitische Stellung etc.) als auch von vielen dynamischen Faktoren der gesellschaftlichen Entwicklung ab (Imperialismus, Krieg, Krise, etc.).
Es wäre zum Beispiel absurd gewesen, auf dem Höhepunkt der Kämpfe gegen die Apartheid in Südafrika plötzlich alle Kräfte darauf zu konzentrieren, den Kampf für LGBTQ-Rechte auf die gleiche Ebene zu heben. Die rassistische Unterdrückung war von strategischer Bedeutung für die weiße Bourgeoisie, von ihr waren Millionen unmittelbar betroffen, an ihr entzündete sich überall spontaner Widerstand – und eine Befreiung der Arbeiterklasse als ganzer hatte die Aufhebung der Apartheid zur notwendigen Bedingung. Heute existiert in Deutschland ein Niedriglohnsektor, der für die deutschen Monopole eine zentrale strategische Rolle spielt. Dieser Niedriglohnsektor ist mehrheitlich migrantisch und weiblich geprägt, nicht „queer“. Es gibt also offensichtlich Unterdrückungsformen, die für die gegenwärtigen kapitalistischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse wichtiger sind als andere. Damit ist noch nicht gesagt, dass mit der Abschaffung dieser besonderen Unterdrückungsformen notwendig auch die Herrschaft der Bourgeoisie insgesamt stürzen muss – schließlich hat der südafrikanische Kapitalismus die Abschaffung der Apartheid überlebt – aber dennoch steckt in diesen Kämpfen ein besonders großes Mobilisierungs- und Radikalisierungspotenzial und es besteht immerhin die Möglichkeit ihrer revolutionären Zuspitzung.
Anders als dem Marxismus von der postmodernen Identitätslinken oft unterstellt wird, geht dieser auch nicht davon aus, dass sich alle gesellschaftlichen „Nebenwidersprüche“ sozusagen von allein auflösen, sobald der Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit aufgehoben ist und der Aufbau des Sozialismus begonnen hat.[34] Marx und Engels gingen stattdessen davon aus, dass die neue Gesellschaft notwendig mit den „Muttermalen der alten“ (MEW 19, S. 20) auf die Welt kommen wird und dass auch nach der Revolution noch lange Kämpfe notwendig sein werden, um diese endgültig zu überwinden. Aber erst die Zerstörung der ökonomischen Basis des Kapitalismus entzieht den alten Ideologien endgültig ihren Nährboden und eröffnet die historische Möglichkeit, einen neuen politischen, ideologischen und kulturellen Überbau zu errichten. Erst im Sozialismus wird es historisch möglich, Freiheit, Gleichheit und Solidarität nicht nur als abstrakte Ideale, die nur die wirkliche Ungleichheit und Ausbeutung verschleiern, sondern als reale Grundlage der menschlichen Beziehungen zu verwirklichen.
(d) Ist der Marxismus „eurozentristisch“? Ist das weiße Industrieproletariat das alleinige revolutionäre Subjekt und gesteht der Marxismus den „Subalternen“ im „globalen Süden“ keine historische Handlungsmacht zu?
Marx‘ theoretisches Lebenswerk war die Analyse der Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise. Diese entstand in ihrer „klassischen“[35] Form zunächst in England, dann in anderen europäischen Ländern, von dort aus dehnte er seinen Einfluss auf die ganze Welt aus. Es lag also in der Natur seines Untersuchungsgegenstands, dass Marx sich vor allem mit Europa beschäftigte. Das hatte allerdings rein gar nichts damit zu tun, dass er den gesellschaftlichen Fortschritt ausschließlich in Europa verortete und sich für andere Erdteile nicht interessierte oder diese gar aus rassistischer Geringschätzung für ihre Bewohner für historisch unwichtig gehalten hätte. Seine zahlreichen Regionalstudien und Artikel über Länder des „globalen Südens“ beweisen das Gegenteil.
Die Analyse der kapitalistischen Bewegungsgesetze war auch der Schlüssel für das theoretische Verständnis der Dynamik ihrer weltweiten Expansion. Wie ich oben anhand der Textstellen zur „ursprünglichen Akkumulation“ und zur „internationalen Arbeitsteilung“ gezeigt habe, widmete Marx der Frage nach dem Verhältnis zwischen kapitalistischen Zentren und Peripherie große Aufmerksamkeit. Nicht zufällig bezogen sich im 20. Jahrhundert fast alle Theoretiker der Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt auf diese Analysen. Ich beschränke mich in diesem Artikel aus pragmatischen Gründen auf Marx und Engels, aber die Frage nach der Rolle, die der Marxismus für die antiimperialistischen Kämpfe während des gesamten 20. Jahrhunderts gespielt hat und weiterhin spielt, müsste man sich natürlich ausführlich die Geschichte der Imperialismustheorie, der Sowjetunion, der Kommunistischen Internationale und vieles mehr anschauen.
Es ist richtig, dass Marx und Engels im Kommunistischen Manifest offensichtlich noch davon ausgingen, dass die Revolution gegen die Bourgeoisie von den Arbeitern in den kapitalistischen Zentren ausgehen würde. Bis zum Sieg der Oktoberrevolution 1917 am östlichsten und am wenigsten kapitalistisch entwickelten Rand Europas war das auch das Szenario gewesen, das in der marxistischen Arbeiterbewegung insgesamt für das wahrscheinlichste gehalten worden war. Dennoch trifft es nicht zu, dass Marx und Engels die unterdrückten Völker der Peripherie nur als passive Opfer betrachteten, die nur auf ihre Befreiung durch das weiße Proletariat hoffen konnten. Wie ich anhand der Beispiele Indien und Irland gezeigt habe, hielten Marx und Engels zu ihren Lebzeiten durchaus auch ein Szenario für möglich, in dem die Herrschaft der Bourgeoisie zuerst in den Kolonien gebrochen werden würde. Sie sahen in den unterdrückten Völkern die natürlichen Verbündeten und Kampfgefährten des Proletariats. Ihre Selbstbefreiung war auch ein Schlag gegen die Herrschaft der Bourgeoisie in den kapitalistischen Kernländern.
(e) Waren Marx und Engels selbst Rassisten?
Marx spricht, wie wir gesehen haben, mit Blick auf die kapitalistische Peripherie immer wieder von „Barbarei“, während er den europäischen Kapitalismus immerhin als „sogenannte Zivilisation“ bezeichnet. Was hinter dieser häufig fehlinterpretierten Gegenüberstellung wirklich steckt habe ich oben bereits klar gemacht. In anderen Texten schreiben Marx und Engels über „geschichtslose Völker“, eine „asiatische Produktionsweise“ und die „orientalische Despotie“, um die Zustände in den (noch) nicht kapitalistischen Teilen der Welt zu charakterisieren.[36] Dies ist häufig als rassistisches Weltbild ausgelegt worden. Allerdings beschreibt Marx mit diesen Begriffen an keiner Stelle die scheinbar unveränderbaren „rassischen“ oder kulturellen Eigenschaften von Völkern, wie die „Rassetheorien“ das tun, sondern es geht ihm immer um historisch gewachsene, von Menschen geschaffene und daher auch von Menschen veränderbare gesellschaftliche Verhältnisse – und zwar solche, in denen der Mensch ein „erniedrigtes“ und „geknechtetes Wesen“ ist und die es daher umzustürzen gilt. Im Mittelpunkt des marxistischen Denkens steht also, im scharfen Kontrast zu allen rassistischen „Theorien“, die Emanzipation des Menschen, nicht seine Ausbeutung und Unterdrückung.
Aber ist so eine universalistische Sichtweise, die alle Menschen im Sinne der europäischen Aufklärung gleichermaßen als vernunftbegabte Wesen sieht, die gleiche Rechte und ein Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung haben, nicht erst Recht eurozentristisch und paternalistisch? Muss eine anti-eurozentristische Perspektive, wie die postcolonial studies sie für sich in Anspruch nehmen, nicht die Vielfalt aller kulturellen Eigenheiten respektieren, auch wenn diese feudale Leibeigenschaft, Sklaverei und religiösen Aberglauben beinhalten? Der Standpunkt des Marxismus gegenüber solchen Positionen ist eindeutig: Marx und Engels gingen von einer universellen menschlichen Natur aus, und zwar in dem Sinne, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Kultur oder sonstigen Identitätsmerkmalen, dieselben grundlegenden Bedürfnisse haben. Dazu gehört das Bedürfnis nach physischer Unversehrtheit (also nach Sicherheit, Nahrung, Kleidung, Wohnung, etc.) sowie nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung (also nicht unterdrückt und ausgebeutet zu werden).[37] Diese Bedürfnisse sind zweifellos stark kulturell geprägt und können unzählige konkrete Formen annehmen, aber sie werden nicht durch die Kultur geschaffen. Der wichtigste Schlüssel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse ist eine zumindest grundlegende rationale und wissenschaftliche Einsicht in die Bewegungsgesetze der Natur und der gesellschaftlichen Entwicklung. Diese Vernunft ist keine europäische Erfindung, sondern auf jeweils verschiedenen Entwicklungsstufen (entsprechend der Produktivkraftentwicklung) allen menschlichen Zivilisationen und Kulturen eigen. Antiimperialisten haben immer auch dafür gekämpft, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und technologischen Entwicklungen nicht in den kapitalistischen Zentren zu monopolisieren, sondern der ganzen Menschheit zur Verfügung zu stellen – eine Realität, von der wir heute weit entfernt sind. Eine Position, die den humanistischen Universalismus im hier kurz skizzierten Sinne ablehnt, läuft Gefahr umgekehrt in eine Essenzialisierung kultureller Unterschiede und im schlimmsten Fall eine Romantisierung von Armut und „barbarischen“ gesellschaftlichen Verhältnissen zu verfallen.
Aber beweist die Tatsache, dass Marx und Engels immer wieder rassistische Sprache benutzten, nicht trotz allem, dass sie in Wirklichkeit Rassisten waren? Es lässt sich nicht leugnen, dass die beiden Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus besonders in ihren privaten Briefwechseln bisweilen heftige rassistische und antisemitische Beschimpfungen gegen ihre politischen Gegner richteten (die vom Institut für Marxismus-Leninismus herausgegebenen Marx-Engels-Werke, in denen die Briefe abgedruckt sind, machen daraus übrigens kein Geheimnis). Auch das N-Wort, das bis vor nicht allzu langer noch zum selbstverständlichen Sprachgebrauch gehörte, findet sich natürlich vielfach in ihren Texten. Als Marxist muss man das weder sympathisch finden noch irgendwie rechtfertigen. Aber man sollte es zumindest in seinem historischen Kontext sehen und Marx und Engels nicht nur anhand ihrer Sprache, sondern ihrer Taten messen.
Die oft aus dem Kontext gerissenen Zitate werden von bürgerlichen Antikommunisten mit Vorliebe zu einer scheinbar erdrückenden Beweislast aufgehäuft, die Marx und Engels ein für alle Mal als Rassisten brandmarken und damit als Vorkämpfer der Freiheit diskreditieren soll. Aber welches Gewicht haben diese oberflächlichen „Beweise“ gegenüber den historischen Tatsachen? Im Gegensatz zur überwältigenden Mehrheit der liberalen Philosophen und Politiker ihrer Epoche waren Marx und Engels nicht Verbündete und Apologeten der bürgerlichen Herrschaft und all ihrer blutigen Auswüchse, sondern ihre konsequentesten und erbittertsten Feinde. Sie widmeten ihr gesamtes Leben der Revolution und nahmen dafür Repressionen, Verfolgung und Exil in Kauf. Wie wir gesehen haben bekämpften sie nicht nur unermüdlich die kapitalistische Ausbeutung der „Arbeit in der weißen haut“, sondern sie waren auch glühende Gegner der Sklaverei, stellten sich auf die Seite der unterdrückten Völker und Nationen und gehörten im Europa ihrer Zeit zu den schärfsten Kritikern des Kolonialsystems. Wiegt all das nicht sehr viel schwerer als ein Paar sprachliche Entgleisungen?
IV. Zur Kritik der postmodernen Identitätspolitik
Bevor wir nun die Positionen der postmodernen Identitätspolitik genauer unter die Lupe nehmen, vergegenwärtigen wir uns kurz die „Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft“ (MEW 13, S. 8), also ihre ökonomische Struktur. Der Kapitalismus basiert darauf, dass sich die Produktionsmittel (Fabriken, Maschinen, etc.) im Privateigentum einer relativ kleinen Klasse befinden, der Bourgeoisie oder Kapitalistenklasse. Dieser steht das zahlenmäßig viel größere Proletariat bzw. die Arbeiterklasse gegenüber, deren Lage dadurch bestimmt ist, dass sie keinerlei eigene Produktionsmittel besitzt und dazu gezwungen ist, ihre Arbeitskraft für einen Lohn an die Produktionsmittelbesitzer zu verkaufen. Zentral für jede marxistische Analyse der gesellschaftlichen Strukturen im Kapitalismus ist also der Klassenbegriff. Lenin gibt dazu folgende Kurzdefinition:
Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich voneinander unterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem (größtenteils in Gesetzen fixierten und formulierten) Verhältnis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Art der Erlangung und der Größe des Anteils am gesellschaftlichen Reichtum, über den sie verfügen. Klassen sind Gruppen von Menschen, von denen die eine sich die Arbeit der andern aneignen kann infolge der Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten System der gesellschaftlichen Wirtschaft.[38]
Der Platz der Menschen in der gesellschaftlichen Hierarchie, ihr Anteil am gesellschaftlichen Reichtum, ihre Lebens- und Arbeitsrealität, ihre Wohnverhältnisse, ihr Bildungsstand etc. hängt aus marxistischer Sicht also hauptsächlich von ihrer Klassenlage ab. An der Spitze der sozialen Pyramide steht die Bourgeoisie, als „Mittelschicht“ zwischen Bourgeoisie und Proletariat steht das Kleinbürgertum, und an der Basis der Pyramide befinden sich als bei Weitem größte Gesellschaftsklasse die Arbeiterinnen und Arbeiter, die in sich nochmals anhand verschiedener Einkommensschichten und Stellungen im Produktionsprozess aufgegliedert sind.[39]
(f/g) Zur Kritik der Privilegien- und Diskriminierungstheorie:
Recht haben die Vertreter dieser Theorien immerhin mit ihrer Grundannahme, dass die Gesellschaft hierarchisch aufgebaut ist und dass die Verteilung der Individuen auf der sozialen Pyramide nicht einfach zufällig erfolgt. Sie verwechseln dabei in der Regel aber entweder Ursache und Wirkung oder machen sich gar nicht erst die Mühe, überhaupt systematisch nach den Ursachen der sozialen Ungleichheit zu fragen. Die Schichtung der kapitalistischen Gesellschaft wird in Wirklichkeit nicht durch Privilegien oder Diskriminierung erzeugt, sondern durch die Klassenspaltung. Diese würde auch nicht verschwinden, falls es tatsächlich gelänge, durch genug Aufklärungsarbeit und gesetzliche Regelungen alle Formen von Diskriminierung abzuschaffen. Was dann übrig bliebe wäre höchstens ein Kapitalismus, dessen „menschliches Antlitz“ darin bestünde, dass er Menschen unabhängig von ihren sonstigen Identitätsmerkmalen nur noch anhand ihrer nackten ökonomischen Leistungsfähigkeit sortiert. An der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, dem Privateigentum an den Produktionsmitteln, der daraus resultierenden ungleichen Reichtumsverteilung und allem, was den Kapitalismus sonst noch zu einem Problem für die Menschheit macht, hätte sich dadurch nichts geändert.
Dieses (unrealistische) Gedankenexperiment zeigt, wie wenig gesellschaftskritisch diese Ansätze in Wirklichkeit sind. Sie problematisieren im Grunde überhaupt nicht, dass der Kapitalismus die Gesellschaft notwendig in Ausbeuter und Ausgebeutete spaltet, sondern nur, dass der Wettbewerb um die besseren Plätze in der sozialen Hierarchie durch Privilegien und Diskriminierung unfair verzerrt wird. Sie wollen nicht Gleichheit erreichen, sondern höchstens Chancengleichheit in der allgemeinen Konkurrenz, sozusagen einen farbenblinden Kapitalismus. „Emanzipation“ wäre demnach dann erreicht, wenn es wenigstens einer Handvoll der ehemals Unterdrückten gelingt, selbst in die Liga der Unterdrücker an der Spitze der Pyramide aufzusteigen. Wenn Beyoncé zum Beispiel singt, „I’m a black Bill Gates in the making” („Ich bin dabei, ein schwarzer Bill Gates zu werden“), dann wird das von Vertretern der Identitätspolitik als quasi-revolutionäres „Empowerment“ gefeiert.[40]
Trotz dieser grundsätzlichen Mängel des theoretischen Ansatzes macht vor allem die soziologische Diskriminierungsforschung durchaus auch wahre und interessante Aussagen über die gesellschaftliche Wirklichkeit im Kapitalismus. So zeigen zum Beispiel Jahr für Jahr zahlreiche empirische Studien, dass Identitätsmerkmale wie Migrations- oder Fluchthintergrund bedeutende statistische Auswirkungen auf die sozialen Aufstiegschancen, die Erfolgschancen im Bildungssystem, bei der Ausbildungsplatzsuche sowie auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt haben. Diese Gruppen sind deutlich stärker als weiße Deutsche von Arbeitslosigkeit, Leiharbeit und anderen prekären Erwerbsformen betroffen, arbeiten also mit höherer Wahrscheinlichkeit im Niedriglohnsektor und bilden damit mehrheitlich die untere Schicht der Arbeiterklasse. Rassismus ist also ein real wirkmächtiger Faktor, der dazu beiträgt, die bestehende soziale Hierarchie und die Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse aufrecht zu erhalten und zu reproduzieren – eine theoretische Erklärung dafür, warum es überhaupt eine soziale Hierarchie gibt, liefert diese Beobachtung für sich genommen aber noch nicht.
Vor allem die identitätspolitische Privilegientheorie trägt deutlich mehr zu einer stark verzerrten Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wirklichkeit bei als zu deren Erklärung. Schon der Kernbegriff dieser Theorie ist sehr problematisch. Ursprünglich bezeichnet „Privileg“ ein Vorrecht, dass nur einer kleinen gesellschaftlichen Minderheit zugestanden wird. Im Mittelalter war zum Beispiel das Recht, Land zu besitzen und darauf Leibeigene arbeiten zu lassen, das alleinige Recht des Adels und des Klerus. Dieses Privileg trennte die herrschende von der beherrschten Klasse, die gesellschaftliche Mehrheit von der privilegierten Minderheit. Die Privilegientheorie stellt dieses Verständnis auf den Kopf, wenn sie schon das Nicht-Betroffensein von Diskriminierung als Privileg bezeichnet. Damit erscheint nun die (weiße, heterosexuelle, etc.) Mehrheit als privilegiert und nur noch einige Minderheitengruppen gelten als unterdrückt. Diese Sichtweise unterstellt also indirekt, dass die Mehrheit der Menschen im Kapitalismus von den gesellschaftlichen Verhältnissen profitiert und ein aktives Interesse daran hat, diese aufrecht zu erhalten – schließlich hat sie aus dieser Sicht ja Privilegien zu verteidigen.
Ein zweites Grundproblem besteht darin, dass die Privilegientheorie die verschiedenen Identitätsmerkmale unvermittelt und gleichwertig nebeneinanderstellt. Ein eindrückliches Beispiel für die Funktionsweise dieser Weltsicht liefert ein Beitrag auf der Internetplattform Buzzfeed mit mittlerweile über 20 Millionen (!) Views. Dort kann man sich auf Grundlage eines Fragebogens, der Merkmale wie ethnische Herkunft, Geschlecht oder soziale Stellung eins zu eins und ohne irgendeine Gewichtung nebeneinanderstellt, sprichwörtlich seinen eigenen Privilegien-„Score“ auf einer Skala von 1 bis 100 ausrechnen lassen.[41] Tatsächlich wird der Faktor Klasse in diesen popkulturellen Aneignungen der Privilegientheorie oft ganz in den Hintergrund gedrängt. Gruppenidentitäten haben aus dieser Sicht letzten Endes mehr Gewicht als die wirkliche soziale Stellung ihrer Mitglieder. Dieser Identitätsreduktionismus treibt dann die absurdesten Blüten, so dass zum Beispiel afroamerikanische Arbeiterinnen und eine Millionärin wie Beyoncé zur selben „community“ gezählt werden, während ein weißer Arbeiter angeblich selbst der nicht-weißen Millionärin gegenüber noch mit „weißen Privilegien“ ausgestattet ist. Der „straight white male“[42] („heterosexuelle weiße Mann“) ist in der US-amerikanischen Popkultur schon längst zur allgemeinen Metapher für die Spitze der identitätspolitischen Nahrungskette geworden – und das obwohl die weiße Arbeiterklasse in den USA in Wirklichkeit mit zu den Volksschichten gehört, die in den letzten Jahrzehnten den extremsten sozialen Abstieg hinnehmen mussten.[43] Die Tatsache, dass die Klassenspaltung in Wirklichkeit quer durch alle vermeintlichen Identitätsgemeinschaften verläuft und dass es auch Ausbeuter gibt, die selbst Minderheiten angehören, wird in der Privilegientheorie weitgehend ausgeblendet. Fakt ist aber, dass zwei schwarze Transfrauen im Kapitalismus grundverschiedene Erfahrungen machen, je nachdem, ob sie zur Bourgeoisie oder zur Arbeiterklasse gehören.
Wie problematisch diese Theorien selbst dann noch bleiben, wenn sie Klasse explizit in ihre Erklärungsmodelle einbeziehen, lässt sich am besten anhand der „Klassismus“-Ansätze veranschaulichen. Diese verstehen unter Klasse nicht eine reale ökonomische Kategorie, sondern nur ein weiteres „gesellschaftlich konstruiertes“ Diskriminierungsmerkmal. Kritisiert wird nicht, dass Menschen ausgebeutet werden, sondern dass sie aufgrund ihrer sozialen Lage Diskriminierungserfahrungen machen und mit Vorurteilen konfrontiert sind. Um es überspitzt zu formulieren: Das Problem ist nicht, dass sich Kevin vom Hartz-IV-Satz seiner Eltern den Schulausflug nicht leisten kann, sondern dass seine Lehrerin so „unsensibel“ ist, ihn vor der ganzen Klasse darauf anzusprechen. Natürlich ist es legitim sich über das Verhalten der Lehrerin zu ärgern, aber wäre Kevin durch eine Anhebung der Grundsicherung nicht mehr geholfen als durch ein Antidiskriminierungstraining für seine Lehrerin?
(h) Sind wir wirklich alle „Teil des Problems“ und profitieren „alle Weißen“ von Rassismus?
So banal und spontan einleuchtend die Einsicht sein mag, dass wir alle irgendwie in die gesellschaftlichen Machtverhältnisse „verstrickt“ sind und sie alltäglich reproduzieren, so falsch sind gleichzeitig die Schlüsse, die in der Regel aus ihr gezogen werden. Natürlich ist jeder, der sich im Alltag manchmal rassistisch äußert, sich unsensibel verhält, im Bus nicht neben einer Frau mit Kopftuch sitzen will, bewusst oder unbewusst Vorurteile gegen Migranten hegt etc. irgendwie an der Reproduktion von Rassismus beteiligt. Für die unmittelbar Betroffenen kann der rassistische Spruch von einer weißen Obdachlosen genauso verletzend sein wie der von einem anzugtragenden Banker. Ja, selbst das passive oder sogar völlig unbewusste Genießen eines Konkurrenzvorteils, der einem daraus entsteht, dass jemand anders rassistisch diskriminiert wurde (z.B. bei einem Vorstellungsgespräch oder bei der Wohnungssuche), ist ein Aspekt von strukturellem Rassismus.
Trotzdem läuft das rassismuskritische Mantra von der „Verstricktheit Aller“ Gefahr, den grundlegenden Unterschied zwischen jenen auszublenden, die die rassistischen Verhältnisse aus einer Position der Machtlosigkeit heraus reproduzieren und jenen, die dies aus einer Position der Herrschaft heraus tun. Erstere versuchen vielleicht, hier und da einen Vorteil für sich herauszuschlagen oder nehmen die Ungerechtigkeit zumindest passiv hin, anstatt sich über sie zu empören. Letztere haben dagegen nicht nur ein aktives Interesse daran, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind, sondern sie haben auch die Macht, um dafür zu sorgen, dass sie es tun. Ein rassistischer Arbeiter mag sich beleidigend verhalten, auf die Ausländer schimpfen, die ihm angeblich den Arbeitsplatz oder die Steuergelder wegnehmen wollen, usw. Im Gegensatz zum Kapitalisten verfügt er aber über keine Arbeitsplätze und keine leerstehenden Wohnungen, die er diesen Menschen vorenthalten könnte. Auch auf rassistische Gesetzgebungen, Flüchtlings- und Kriegspolitik hat er im bürgerlichen Staat keinen nennenswerten Einfluss.
Das gleiche gilt umgekehrt auch für den Grad der Betroffenheit von Rassismus und Diskriminierung. Nicht alle Weißen „profitieren“ vom Rassismus, genauso wenig wie alle Schwarzen gleich stark von ihm betroffen sind. Natürlich stimmt es, dass die Hautfarbe auch heute noch den Unterschied zwischen Leben und Tod markieren kann, und diese Tatsache soll hier keineswegs heruntergespielt werden. Wer zum Beispiel in den USA in eine Polizeikontrolle gerät, dessen Überlebenschancen hängen stark von den rassistischen Zuschreibungen der Polizisten ab. Trotzdem ist innerhalb der Arbeiterklasse der Unterschied zwischen den weißen und den von Rassismus betroffenen Bevölkerungsgruppen nicht einer zwischen „privilegierten“ und „nicht-privilegierten“, sondern eher einer zwischen Regen und Traufe. Aus der Tatsache, dass Migrantinnen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt diskriminiert werden, ergibt sich für die weiße Arbeiterklasse schließlich noch lange nicht das „Privileg“, jederzeit Zugang zu einer bezahlbaren Wohnung und einem sicheren Job zu haben. Dass es in den ohnehin beschissenen Verhältnissen manchen noch schlechter geht macht die eigene Lage noch lange nicht gut. Allem Rassismus zum Trotz wird sich die alleinerziehende deutsche Mutter, die von Hartz IV leben muss, bei der Wohnungssuche nicht gegen das gutsituierte Akademikerehepaar aus Indien durchsetzen – wahrscheinlich suchen beide nicht einmal im selben Stadtteil. Wirklichen Schutz vor Armut, Obdachlosigkeit und Jobverlust bietet im Kapitalismus nicht die weiße Haut, sondern der eigene Immobilien- und Kapitalbesitz. Im eigentlichen Wortsinn privilegiert ist im Kapitalismus nur die Klasse, die die Produktionsmittel besitzt, sich also unbezahlt einen Teil der Arbeit anderer Menschen aneignen kann. Der Faktor Klasse steht nicht einfach unvermittelt neben allen anderen Identitätsmerkmalen, sondern er ist der Trumpf, der alle anderen sticht.
Die Unterschiede innerhalb der Arbeiterklasse sind graduell, die zwischen Arbeitern und Bourgeoisie dagegen qualitativ.Die graduellen Unterschiede innerhalb der Klasse erzeugen kein Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis und deshalb auch keinen grundsätzlichen Interessengegensatz wie den zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Die weiße Arbeiterin eignet sich nicht den von ihrem schwarzen Kollegen produzierten Mehrwert an. Das Ende der Ausbeutung der Arbeiterklasse hat nicht etwa die Aufhebung der vermeintlichen „Privilegien“ der weißen Mehrheit der Arbeiter, sondern der wirklichen Privilegien der Bourgeoisie zur Voraussetzung, also die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Indem die Identitätspolitik unermüdlich die Beteiligung von „uns allen“ an der Reproduktion der rassistischen Verhältnisse betont, verschleiert sie den Klassengegensatz und die wirklichen Machtverhältnisse mehr, als dass sie sie zu Bewusstsein bringt. Die Annahme, alle Weißen profitierten vom Rassismus und hätten ein Interesse an dessen Aufrechterhaltung, steht im direkten Gegensatz zu Marx‘ Analyse, dieser sei ein Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie und verschlechtere durch die Spaltung der Klasse letztlich die Lebens- und Kampfbedingungen des gesamten Proletariats.
(i) „Check your privilege“: Kann Rassismus durch „Selbstreflexion“ bekämpft werden?
Tatsache ist, dass es innerhalb der Arbeiterklasse große Unterschiede im Lebensstandard gibt und dass diese bei weitem nicht nur entlang von Identitätsgrenzen verlaufen. Der Lohn eines festangestellten türkischstämmigen Facharbeiters bei Daimler oder Bosch kann das Vielfache von dem betragen, was zum Beispiel ein deutscher Paketbote, eine rumänische Erntehelferin oder eine alleinerziehende Reinigungskraft verdient. Jede politische Bewegung, die diese Gruppen auf Grundlage ihres gemeinsamen Klasseninteresses organisieren will, muss diese Unterschiede berücksichtigen und sehr ernst nehmen.
Kommunistinnen und Kommunisten tun in jedem Fall gut daran, die Spaltungslinien, die durch die ganze Klasse verlaufen, auch in ihren eigenen Reihen zu reflektieren. Schließlich hängt davon Vieles ab: Welche Genossinnen haben welchen Erfahrungshintergrund und damit Zugang zu welchen Teilen der Klasse? Wer kommt aus einem akademischen Elternhaus und bringt damit einen Bildungsvorsprung mit? Wer hat welche Sprachkenntnisse? Wer ist aufgrund seiner finanziellen Lage besonders eingeschränkt? Wer ist zum Beispiel aufgrund von Hautfarbe oder Aufenthaltsstatus einem besonderen Repressionsrisiko ausgesetzt? etc. Um diese Unterschiede offenzulegen und einen politischen Umgang mit ihnen zu entwickeln ist Selbstreflexion nötig, allerdings als kollektive und nicht als individuelle Praxis. Eine offene Kultur von solidarischer Kritik und Selbstkritik, die durch Fehlertoleranz und gegenseitige Lernbereitschaft geprägt ist, sowie eine gemeinsame politische Praxis sind notwendige Voraussetzungen, um wirkliche Klassensolidarität über die Spaltungslinien hinweg zu organisieren. Selbstreflexion kann also durchaus ein nützliches Instrument sein und sollte nicht an sich zur Zielscheibe unnötiger Polemik werden. Dabei kann das „Checken“ der eigenen „Privilegien“ aber nie Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck sein. Das Ziel dabei ist die größtmögliche Einigkeit für den gemeinsamen Klassenkampf herzustellen. Jede Methode, die dabei hilfreich sein kann, sollte in der Praxis erprobt und gegebenenfalls übernommen werden.
Die postmoderne Identitätslinke geht allerdings davon aus, dass die Praxis der „Selbstreflexion“ und der „Awareness“ selbst schon dazu beiträgt, Diskriminierung, Ausgrenzungsmechanismen und Machtverhältnisse abzubauen, wenn schon nicht in der ganzen Gesellschaft dann wenigstens in den eigenen Szene-„Freiräumen“. Denkt man, dass die sozialen Machtgefälle ihren Ursprung im individuellen Verhalten und den „Privilegien“ von „uns allen“ haben, dann ist es nur konsequent, sie auch auf dieser Ebene bekämpfen zu wollen. Warum sind all diese Ansätze aber letzten Endes zum Scheitern verurteilt? Wie wir gesehen haben ist der Ursprung der verschiedenen Ideologien der Entmenschlichung nicht einfach in den zufälligen Ideen oder der Ignoranz der Menschen zu suchen, sondern in der ökonomischen Basis der Gesellschaft. Solange wir also in einem System leben, das auf Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und der Konkurrenz aller gegen alle beruht, werden auf diesem Nährboden auch immer wieder neue Spaltungsideologien entstehen. Folglich ist es nicht möglich, diese Phänomene nur durch Selbstreflexion, Aufklärung und Sensibilisierung aus der Welt zu schaffen. Diese idealistische Praxis läuft auf einen Kampf gegen Windmühlen hinaus, da sie ausschließlich auf den politisch-ideologischen Überbau abzielt. Dauerhaft und gesamtgesellschaftlich kann sich das Bewusstsein nur ändern, wenn sich auch das Sein ändert. Der gut bezahlte Facharbeiter kann lange seine eigenen „Privilegien“ reflektieren, dadurch allein ist seinem migrantischen Leiharbeiterkollegen noch lange nicht geholfen. Erst der gemeinsame und solidarische Kampf beider für ein Verbot der Leiharbeit und die Durchsetzung des Prinzips „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ beendet ihre reale ökonomische Spaltung, entzieht den subjektiven Vorurteilen ihre materielle Basis und nimmt ihnen dadurch ihre gesellschaftliche Wirkmacht. Der „check your privilege“-Ansatz lenkt den Blick aber weg von der Ausbeuterklasse und sucht die Verantwortung bei den einzelnen „privilegierten“ Individuen.
Am Marxismus wird immer wieder kritisiert, er interessiere sich angeblich nur für die ökonomische Seite von Rassismus und nicht für unmittelbaren emotionalen und psychischen Leiden, die er hervorbringt. Diese sind aber ein reales gesellschaftliches Problem und äußern sich zum Beispiel darin, dass von Rassismus betroffene Menschen häufiger unter Depressionen und anderen psychischen Krankheiten leiden und eine höhere Suizidrate aufweisen als andere Bevölkerungsgruppen. Aus der Perspektive der unmittelbaren Betroffenheit mögen ökonomische Kämpfe gegenüber den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen vielleicht unwichtig erscheinen (obwohl auch Armut und der ganz alltägliche Arbeitsstress zentrale Faktoren für psychische Erkrankungen sind). Aus marxistischer Perspektive muss uns aber klar sein, dass wir, wenn es uns ernst damit ist, diesem individuellen Leid ein Ende setzen zu wollen, an der ökonomischen Basis ansetzen und langfristig für eine andere Gesellschaft kämpfen müssen. Wie ungefährlich und zahnlos dagegen die allgemeinen Appelle an „uns alle“, unsere Privilegien zu reflektieren und an unserem alltäglichen Verhalten zu arbeiten, für den Kapitalismus letztlich sind, zeigt sich schon allein daran, wer dabei alles problemlos mit einstimmen kann. Nicht nur der Großteil der bürgerlichen Politiker quer durch das Parteienspektrum, sondern selbst die BILD-Zeitung[44], die sonst skrupellos gegen Geflüchtete und Migranten hetzt, kann sich dem Chor gegen Alltagsrassismus und für mehr „Achtsamkeit“ ohne Probleme anschließen.
(j) Was bewirkt der Kampf um identitätspolitische „Anerkennung“ und „Repräsentation“?
Im Folgenden geht es mir nicht darum, die Kämpfe unterdrückter Gruppen um ökonomische, politische und juristische Gleichberechtigung als postmoderne Identitätspolitik zu verwerfen. In diesen Kämpfen standen Kommunistinnen auf der ganzen Welt immer mit in der ersten Reihe, so z.B. beim Kampf um das Frauenwahlrecht, der Entkriminalisierung von Homosexualität oder der Abschaffung von Sklaverei und erzwungener Rassentrennung. Es geht mir hier um identitätspolitische Diskussionen, die sich vor allem auf das Gebiet der Kultur, des Diskurses und der bürgerlichen Politik beziehen. Das subjektive Bedürfnis ausgegrenzter und diskriminierter Gruppen nach Anerkennung und Repräsentation im kulturellen und politischen Mainstream ist an sich legitim und nachvollziehbar. Politische Kämpfe, die sich nur auf Überbauphänomene beschränken, können aber nichts an der ökonomischen Spaltung der Klasse oder an den kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen ändern.
Die Konzentration auf das Problem der Repräsentation macht es dem kapitalistischen System zudem extrem leicht, identitätspolitische Scheinzugeständnisse zu machen, die sich oft sogar lukrativ vermarkten lassen.[45] Der Sportartikelhersteller Nike richtet seine Werbekampagnen zum Beispiel schon seit Jahren an „Diversity“-Richtlinien und „Empowerment“ (Ermächtigung) aus und hat sich damit erfolgreich ein Image als Marke der Minderheiten und Außenseiter aufgebaut. Während in den Werbespots People of Color als Heldinnen gefeiert werden, sitzen sie gleichzeitig zu Tausenden für einen Hungerlohn in den südostasiatischen Sweatshops, in denen Nike seine Produkte herstellen lässt. Marvel hat den Film Black Panther bewusst identitätspolitisch aufgeladen und damit 2018 nicht nur Rekordgewinne gemacht, sondern auch gezielt sein Standing auf dem afroamerikanischen Marktsegment ausgebaut. Das Geschäftsmodell von Netflix basiert zu einem Großteil auf „Diversity“-Marketing und richtet sich nicht nur an ein liberal-identitätspolitisches Publikum, sondern auch gezielt an Minderheiten, die sich nun endlich in Serien repräsentiert fühlen dürfen, in denen obligatorisch eine der Hauptfiguren queer, trans oder schwarz ist. Die Firma Uncle Ben’s hat in Reaktion auf die #BLM-Proteste ihr altes rassistisches Logo abgeschafft und neu designed. Der Wundpflasterhersteller Band Aidproduziert seit dem Mord an George Floyd Pflaster in allen Hautfarben. In den USA wurde für die nächste Staffel des Trash-TV Formats Bachelor pünktlich zum Aufkommen von #BLM verkündet, diesmal ginge es um einen schwarzen Junggesellen. Die Liste ließe sich noch lange fortführen. Das Problem an all diesen Beispielen ist, dass sie die Illusion von gesellschaftlichem Fortschritt erzeugen, ohne dass damit irgendeine reale ökonomische oder politische Errungenschaft durchgesetzt wäre. Die Bourgeoisie, die für die rassistischen Verhältnisse direkt verantwortlich ist und von ihnen profitiert, inszeniert sich dabei auch noch als Verbündete der Betroffenen.
Kommunistinnen sollten sich grundsätzlich keinerlei Illusionen über den demokratischen Charakter des bürgerlichen Staats machen. Dieser verkörpert als „ideeller Gesamtkapitalist“ nicht das Durchschnittsinteresse der Mehrheit, sondern nur das der herrschenden Klasse. Aber in der liberalen Demokratie gibt es immerhin die Möglichkeit, in einem gewissen Rahmen politische Positionen aus einer Klassen- oder sogar revolutionären Perspektive zu beziehen und in die öffentliche Diskussion einzubringen. Kommunisten haben also kein Interesse daran, dass die bürgerlich-liberale Demokratie noch weiter degeneriert. Die Forderung nach Anerkennung und Repräsentation spielt in den letzten Jahren aber auch im bürgerlichen Politikbetrieb eine immer größere Rolle und befördert eine zunehmende Verschiebung der Debatten weg von ökonomischen Interessen und in Richtung rein identitätspolitischer Themen. Diskussionen über die ethnische, kulturelle oder sexuelle Identität von Politikerinnen nimmt beispielsweise bei Wahlen in den USA mittlerweile oft eine größere Rolle ein als die politischen Inhalte, für die sie jeweils stehen. Wichtig ist, dass Kandidatenlisten „divers“ aufgestellt sind, nicht dass sie ein bestimmtes Klasseninteresse vertreten. Damit verbunden ist oft die Illusion, dass Menschen aus einer bestimmten „community“ auch deren politische Interessen vertreten. Der bürgerliche Politikbetrieb ist dann nicht einmal mehr die Illusion des Kampfes konkurrierender politischer Programme um gesellschaftlichen Einfluss, sondern nur noch der Kampf verschiedener ethnischer, kultureller und sonstiger Identitäts-„communities“ um ein möglichst großes Stück vom Repräsentationskuchen.
Dabei wird außerdem verschleiert, dass auch schwarze, lesbische oder transsexuelle bürgerliche Politikerinnen am Ende das Kapital repräsentieren. Entscheidend ist im Kapitalismus nicht die Hautfarbe oder die sexuelle Orientierung des politischen Personals, sondern der Klassencharakter des Staats. Während Obamas Präsidentschaft haben sich die Lebensverhältnisse für Schwarze und Latinos in den USA nicht verbessert, trotzdem hat seine Präsidentschaft in diesen Teilen der Arbeiterklasse große Illusionen in die Reformierbarkeit des Kapitalismus geschürt und sie für einige Zeit erfolgreich ruhiggestellt. Durch die Tendenz, politische Inhalte durch „Identitäten“ zu ersetzen, trägt die postmoderne Identitätspolitik nicht nur dazu bei, den Klassengegensatz weiter zu verschleiern, sondern liefert dem Kapitalismus auch immer neue Integrationsmechanismen.
(k) Verändert Sprache tatsächlich die Wirklichkeit?
Ein erstaunlich großer Teil der identitätspolitischen Diskussionen dreht sich seit je her um Sprache. Welche Begriffe sind rassistisch, sexistisch oder homophob und sollten aus Kinderbüchern und überhaupt aus dem öffentlichen Sprachgebrauch entfernt werden? Wo reproduziert Sprache Vorurteile und Stereotype? Wie kann „kultursensibel“ und „diskriminierungsfrei“ kommuniziert werden? In welchen Begriffen fühlen sich Minderheiten am ehesten repräsentiert und wertgeschätzt? Sollten wir „Schwarze“, „Farbige“, „People of Color“ oder „BIPoC“ (Black, Indigenous, People of Color) sagen? Hinter all diesen Debatten steckt die idealistische Grundannahme, dass Sprache Wirklichkeit konstituiert und diese folglich durch die Veränderung von Sprache verändert werden kann.
Es ist eine Binsenweisheit, dass Menschen die Wirklichkeit mit Hilfe von Sprache verstehen, dass sie also auch Begriffe benötigen, um sich ein Bild von gesellschaftlichen Zusammenhängen zu machen. Ohne einen einigermaßen wirklichkeitsgetreuen Begriff von Klasse wird es kaum möglich sein, die sozialen Beziehungen zu verstehen, die dem Kapitalismus zugrunde liegen. Natürlich brauch man einen Begriff von „Rasse“ bzw. eine stereotype Vorstellung ethnisch oder kulturell definierter Menschengruppen, um rassistisch denken zu können. Der Begriff an sich erzeugt aber nicht das soziale Verhältnis oder die Diskriminierung der betroffenen Gruppe, er spiegelt sie wider und trägt zu ihrer Reproduktion bei. Folglich werden die gesellschaftlichen Verhältnisse durch das bloße Austauschen der Begriffe auch nicht aufgehoben. Eine Gesellschaft wird zwar vielleicht ein kleines bisschen weniger rassistisch, wenn sie das N-Wort durch eine freundlichere Alternative ersetzt, aber wirkliche und dauerhafte Verbesserungen lassen sich für die Unterdrückten letztlich nur dadurch erreichen, dass sie gemeinsam für die ökonomische und politische Gleichstellung aller Arbeiter kämpfen.
Eine bestehende ökonomische Basis, in der Ungleichheit und Diskriminierung verankert sind, wird also immer wieder einen Überbau hervorbringen, der diese Ungleichheit in Form von Ideologien widerspiegelt. Dies beweist zum Beispiel ein Phänomen, das Sprachwissenschaftler als „Euphemismustretmühle“ bezeichnen. Ein Euphemismus ist ein Begriff, der eine unschöne Wirklichkeit beschönigen soll. Historisch lässt sich beobachten, dass in der bürgerlichen Gesellschaft, die ja auf dem Mythos von „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ beruht, offen abwertende und beleidigende Begriffe in regelmäßigen Abständen aus dem offiziellen Sprachgebrauch entfernt und durch scheinbar neutrale ersetzt werden. So wurde z.B. „Krüppel“ durch „Behinderter“ ersetzt, „behindert“ aber schon sehr bald wieder als Schimpfwort benutzt und daraufhin wiederum durch „handicapped“, „anders begabt“, „besonders befähigt“ und dergleichen ausgetauscht. Aber was ändern diese immer wiederkehrenden Sprachreformen an der gesellschaftlichen Wirklichkeit? Solange wir in einer Gesellschaft leben, die den Wert der Individuen de facto an ihrer ökonomischen Verwertbarkeit misst, so lange werden auch immer neue Ideologien und Begriffe entstehen, die diese Tatsache widerspiegeln und Menschen mit Behinderung abwerten. Jede Politik, die nur auf Ebene der Sprache ansetzt, ist ein Scheinkampf, der unmöglich gewonnen werden kann.
In der identitätspolitischen Ideologie spielt außerdem die Vorstellung, die Wirklichkeit sei sprachlich „konstruiert“ und könne daher auch „dekonstruiert“ werden, eine zentrale Rolle. Das reicht so weit, dass zum Beispiel die philosophische Begründerin des „queer Feminismus“ Judith Butler die biologische Zweigeschlechtlichkeit als bloße ideologische Konstruktion verwirft und damit letztlich jeder materialistischen Erkenntnistheorie eine Absage erteilt.[46] Andere Spielarten dieses identitätspolitischen Konstruktivismus gehen weniger weit, sind mit einer marxistischen Analyse aber trotzdem nicht vereinbar. So ist die Vorstellung, dass Diskriminierung immer auch auf „konstruierten“ Bildern und stereotypen Gruppenkonstruktionen beruht, an sich natürlich nicht falsch. Allerdings greifen die identitätspolitischen Erklärungsansätze meistens zu kurz und verharren in idealistischen Denkmustern, anstatt auf Grundlage einer materialistischen Ideologietheorie die Entstehung und Reproduktion diskriminierender Gruppenkonstruktionen zu erklären. Rassistische und sexistische Rollenzuschreibungen, etwa das Schwarze aufgrund ihrer Gene oder ihrer Kultur angeblich besonders zu Kriminalität und Gewalt neigen oder dass Frauen von Natur aus besonders fürsorglich seien, entstehen nicht im luftleeren Raum und sind auch nicht einfach das Produkt ideologischer Manipulation durch die Herrschenden, sondern sie knüpfen an die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse an und werden durch diese ständig scheinbar bestätigt. Solange in den USA ein Großteil der jungen Schwarzen in Ghettos lebt und keinen Zugang zu höherer Bildung, Gesundheitsversorgung und sicheren Jobs hat, solange wird es in dieser Bevölkerungsgruppe auch eine erhöhte Kriminalitätsrate geben. Solange Schwangerschaften weiterhin ein objektives ökonomisches Risiko darstellen, Männer durchschnittlich mehr verdienen als Frauen und es keine flächendeckende kostenlose Kinderbetreuung gibt, solange werden auch weiterhin mehrheitlich Frauen gezwungen sein, zuhause zu bleiben und sich unbezahlt um ihre Kinder zu kümmern. Diese Rollenbilder werden also einerseits ständig durch die ökonomische Basis erzeugt und reproduziert, andererseits aber natürlich auch im Interesse der herrschenden Klasse auf Ebene des Überbaus durch Erziehung, kulturelle Prägung und institutionelle Zwänge verstärkt. All das hat nichts mit irgendwelchen unveränderlichen genetischen oder kulturellen Eigenschaften zu tun, sondern ist das Ergebnis der von Menschen gemachten und veränderbaren gesellschaftlichen Verhältnisse – die ideologiekritische „Dekonstruktion“ von Rollenbildern allein wird an diesen Verhältnissen aber nichts ändern.
Meine Position sollte dennoch nicht als allgemeine Ablehnung der Ideologiekritik missverstanden werden. Der Kampf gegen herrschende Ideologien und falsches Bewusstsein ist ein notwendiger Bestandteil des Klassenkampfs. Es genügt aber nicht, die Vorstellungen in den Köpfen der Menschen zu „dekonstruieren“, sondern der Kampf muss um die Veränderung der Verhältnisse selbst geführt werden. Genau wie die oben diskutierte Praxis der Selbstreflexion ist der ideologische Klassenkampf dabei eine Waffe, ein Mittel zum Zweck, nicht ein Selbstzweck. Wenn die gezielte Ansprache besonders unterdrückter Teile der Arbeiterklasse diesem zweck dient, dann ist sie nützlich. Wenn damit aber die Illusion verbreitet wird, durch Sprache allein ließe sich die gesellschaftliche Wirklichkeit verändern, dann schadet das der Arbeiterbewegung.
(l) Wer darf über Rassismus sprechen? Und ist antirassistische Solidarität überhaupt möglich?
In der „critical whiteness“-Szene gehört es zu den weit verbreiteten Annahmen, dass nur selbst Betroffene Rassismus in der Gesellschaft sinnvoll thematisieren und bekämpfen, ja das nur diese ihn überhaupt wirklich verstehen können. Persönliche Betroffenheit wird also zum „alleinigen Kriterium für legitimes sprechen“ über Rassismus, Sexismus und alle anderen Formen der Diskriminierung.[47] Wer seine politische Haltung nicht durch die eigene Identität und Betroffenheit legitimieren kann, der oder die kann weder wirklich Teil der Diskussion noch Teil der Bewegung sein. Die dogmatischsten Varianten dieser Ideologie gehen soweit allen Weißen die Fähigkeit zu einer wirklichen Empathie mit den rassistisch Unterdrückten abzusprechen und unterstellen „absolute Grenzen des Verstehens“. Eine weiße Person wird sich demnach niemals wirklich in das Leiden der von Rassismus Betroffenen hineinversetzen können.[48] Folgt man dieser Sichtweise dann wird Solidarität tatsächlich unmöglich, hat sie doch die Fähigkeit zur Empathie als notwendige Voraussetzung. In der Tradition der Arbeiterbewegung fußt das Prinzip der Solidarität gerade darauf, dass sich die ganze Klasse wehrt, auch wenn nur ein Teil von ihr von einem bestimmten Leiden betroffen ist. Es gehört zu den größten Herausforderungen im Klassenkampf, unter den Arbeiterinnen das Bewusstsein zu verbreiten, dass die Not ihrer Klassengeschwister auch ihre eigene ist, egal wie sehr sich ihre konkreten Lebens- und Arbeitsweisen voneinander unterscheiden mögen. Würde immer nur der Teil der Klasse kämpfen, der gerade selbst akut von Hungerlöhnen, Kündigung oder Repression betroffen ist, dann hätte die Bourgeoisie leichtes Spiel.
Eine mittlerweile fast schon in den kulturellen Mainstream eingegangene Variante der Vorstellung, dass „legitimes Sprechen“ von den Privilegien des Sprechers abhängt, ist der „feministische“ Vorwurf des „mansplaining“ – also die angebliche Angewohnheit aller Männer, Frauen die Welt zu erklären. Dabei spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob der Inhalt des Gesagten richtig oder falsch ist, es geht nur noch darum, wer aufgrund seiner „Privilegien“ angeblich ohnehin schon den „gesellschaftlichen Diskurs“ beherrscht und deshalb in bestimmten Kontexten nicht mehr sprechen darf.
Da die Ursache des Rassismus aus identitätspolitischer Sicht in der Regel nicht in den kapitalistischen Verhältnissen, sondern in der „weißen Mehrheitsgesellschaft“ gesucht wird, sind weiße Menschen mehr oder weniger automatisch Teil des Problems und taugen kaum als Verbündete. Ihr maximaler Beitrag besteht darin ihre „weißen Privilegien“ und ihren Alltagsrassismus zu reflektieren sowie die eigene Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Selbstreflexion macht also auch hier den Kern der politischen Praxis aus.
Wo Weiße ihre angeblichen Privilegien nicht aus eigener Einsicht reflektieren, da haben es sich „critical whiteness“-Aktivistinnen zur Aufgabe gemacht, mit ihren politischen Interventionen anzusetzen. Zum Beispiel, indem sie Weiße daran erinnern, dass sie sich keine Elemente schwarzer Kultur aneignen sollten, weil sie dadurch koloniale Machtverhältnisse reproduzieren („cultural appropriation“[49]). Dieser identitätspolitische Kampf gegen Rassismus kann dann beispielsweise so aussehen, dass auf linksalternativen Festivals Weiße aufgefordert werden, keine Dreadlocks und indigenen Federschmuck mehr zu tragen oder das Trommeln bitte ausschließlich Schwarzen und People of Color zu überlassen.[50]
Im Zusammenhang mit Black-Lives-Matter sind in einigen europäischen Großstädten verstärkt Gruppen unter Labels wie „Migrantifa“ oder „Panthifa“ aktiv geworden, die zumindest teilweise dem „critical whiteness“-Spektrum zuzuordnen sind. Diese Gruppen sind entstanden, weil es aus ihrer Sicht nicht weiter sinnvoll oder möglich ist, zusammen mit Weißen in gemischten Antifagruppen gegen Rassismus und Faschismus zu kämpfen. Sie erheben den Anspruch für die „BIPoC-community“ zu sprechen und damit die unmittelbar Betroffenen zu organisieren. In den Reihen der Protestbewegung und in den sozialen Netzwerken haben die Positionen der „Migrantifa“ teilweise sehr polemische identitätspolitische Debatten losgetreten.
Die zentrale Frage, an der sich dabei die Gemüter erhitzen, ist die, ob weiße Menschen sich überhaupt an den Protesten beteiligen sollten und wenn ja, was dann ihre Rolle dort sein kann. Auf den Facebook-Seiten der „Migrantifa“-Zürich werden Weiße, und zwar vor allem solche, die sich selbst als links verstehen und sich explizit solidarisieren wollen, primär als Problem und nur sekundär als potenzielle Verbündete behandelt. Die „Migrantifa“-Zürich hat deshalb einen Katalog von sieben Regeln aufgestellt, an die sich Weiße halten müssen, wenn sie als „Verbündete“ an #BLM-Demos teilnehmen wollen (hier gekürzt):
1. SCHREIE PAROLEN NUR NACH Fang nicht selbst an, Parolen zu schreien oder sie anzugeben. Deine Aufgabe ist es, diesen zu folgen und deine Stimme hinzuzufügen, wenn dazu aufgefordert wird. […]
2. MACH KEINE SELFIES […] Du bist nur als Zeuge hier. […]
3. SEI NÜTZLICH Verteile Wasser und Snacks. Schau, dass die Protestanführer*innen hydriert und satt sind. […]
4. FOLGE ANWEISUNGEN Wenn eine schwarze Person dir sagt, etwas zu tun, tu es. Respektiere die Autorität und Entscheidung von Schwarzen Protestieren [sic] zu allen Zeiten.
5. BLEIBE HINTEN BIS DU NACH VORNE GERUFEN WIRST Wenn du hörst „Weiße Menschen nach vorne“ oder „Allies nach vorne“, schreite voran und verschränke die Arme mit anderen Weissen [sic] Menschen als Schutzschild.
6. WENN DU VORNE BIST, SEI STILL Deine Aufgabe ist es, ein Körper zu sein. Du bist hier nur für die Unterstützung. Die einzigen Stimmen auf der Konfrontationslinie sollten Schwarze Stimmen sein.
7. BLEIB JEDER ZEIT RUHIG […] Spare dir deine Gefühle für zuhause. AGITIERE NICHT![51]
Das Politikverständnis, das sich in diesen Regeln ausdrückt, ist auf vielen Ebenen problematisch. Die Vorstellung, dass allein die eigene Betroffenheit Menschen politische Legitimität und Glaubwürdigkeit verleiht, kippt hier ins offen autoritäre, wenn daraus eine direkte Befehlsgewalt abgeleitet wird, der sich alle Nicht-Betroffenen unterordnen sollen, sofern sie sich als Verbündete qualifizieren wollen. Dem Versuch auf Augenhöhe und auf der Basis von Vernunftargumenten und Analysen eine gemeinsame politische Strategie und Taktik zu entwickeln, wird mit dieser Haltung jedenfalls von vornherein eine Absage erteilt. Nur solche Weißen, die bereit sind, ihre eigenen politischen Vorstellungen und Erfahrungen beim Betreten der Demo aufzugeben und sich als passiver „Körper“ und Snackverteiler der guten Sache zur Verfügung zu stellen, sind willkommen. In die gleiche Richtung geht auch die Politik der „Panthifa“, die zu ihrer Gründung im Juli 2020 ihre Position zu „Allies“ (Verbündete) twitterte: „Wir fordern weiße Allies dazu auf die Panthifa auf Aufforderung mit Räumlichkeiten, Geld, Reichweite und Logistik zu unterstützen. Eine sonstige und weitere Kooperation wird nur unter den Bedingungen der Panthifa stattfinden.“[52]
Hinter der seit einigen Jahren auch in der deutschen Identitätslinken üblichen Ersetzung der klassischen Begriffe Genossen und Solidarität durch „Allies“ und „Allyship“ steckt deutlich mehr als nur die Übernahme der neuesten amerikanischen Sprachmode.[53] Die fest in der Tradition der Arbeiterbewegung verwurzelte Anrede als Genosse impliziert einen gemeinsamen Klassenstandpunkt sowie die Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen politischen Kampf, und zwar auf Grundlage des Prinzips der Solidarität, also als Gleiche unter Gleichen, allen individuellen Unterschieden zum Trotz. Der identitätspolitische Begriff „Ally“ ist dagegen untrennbar mit der Privilegientheorie verbunden und bezeichnet nicht ein Bündnis auf Augenhöhe, sondern zwischen einer privilegierten und einer nicht-privilegierten Gruppe mit jeweils unterschiedlichen Interessen. Eine „Allianz“ entsteht, weil sich die Privilegierten über das Leid der Unterdrückten empören und ihnen aus ihrer privilegierten Position heraus helfen wollen. Diese Art der Solidarität beruht nicht auf Gegenseitigkeit, sondern auf dem gutem Willen der privilegierten Gruppe, sie verläuft also nur einseitig von den Starken in Richtung der Schwachen. Die Verbündeten führen ihren gemeinsamen Kampf also allenfalls zeitweise auf Basis einer vorübergehenden Interessenüberschneidung (so wie zum Beispiel die Alliierten im zweiten Weltkrieg), sie werden aber nie zu einem gemeinsam handelnden politischen Subjekt. Außerdem ist das Konzept des „Allyship“ grundsätzlich offen für die Vorstellung, die Unterdrückung könne auch im Bündnis mit der herrschenden Klasse bekämpft werden, anstatt im Kampf gegen diese. So akzeptieren zum Beispiel Teile der #BLM-Bewegung in den USA auch unkritisch Großspenden von Unternehmen an Charity-Organisationen für Afroamerikaner als einen Aspekt von „Allyship“.[54]
Im konkreten Fall der antirassistischen Bewegungen wird mit diesem Verständnis als „Allies“ und nicht als Genossinnen die weiße Arbeiterklasse von Anfang an außerhalb des Kreises der irgendwie selbst von Unterdrückung Betroffenen verortet. Als Außenstehende können sie sich allenfalls moralisch mit den „fremden“ Opfern von Rassismus identifizieren – oder eben auch nicht. Dass sie auf Grundlage ihrer Klassenlage auch als Weiße durchaus ein eigenes Interesse daran haben könnten, gegen Rassismus zu kämpfen, wird in dieser Sichtweise überhaupt nicht in Betracht gezogen. Eine Agitation, die darauf abzielt, auch in der weißen Arbeiterklasse ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass der Rassismus ein Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie gegen das ganze Proletariat ist und dass sich ein Angriff gegen einen Teil von uns indirekt immer auch gegen uns alle richtet, ist auf dieser Grundlage nicht möglich. Und nicht vergessen, wenn du weiß bist: „Agitiere nicht!“
Es mag sein, dass ein Teil der weißen identitätslinken Szene gerne dazu bereit ist, sich auch zum Preis der vollständigen politischen Entmündigung an der Bewegung zu beteiligen. Eine breitere Klassensolidarität, zum Beispiel unter Einbeziehung der Gewerkschaften, dürfte unter diesen Bedingungen aber kaum möglich sein. Diese wäre aber die notwendige Voraussetzung dafür, reale Verbesserungen dauerhaft erkämpfen zu können. Die Identitätspolitik der „Migrantifa“-Zürich und ähnlicher Gruppen wirkt hier also objektiv sektiererisch.
Das Prinzip politische Inhalte durch „Identitäten“ zu ersetzen funktioniert übrigens nicht nur als positive, sondern auch umgekehrt als negative Identifikation. Während PoCs und anderen diskriminierten Gruppen aufgrund ihres Status als Betroffene unter Identitätslinken mehr oder weniger automatisch politischer Kredit gegeben und ihnen ein „emanzipatorisches“ Bewusstsein unterstellt wird, führt das in der Szene derzeit besonders beliebte Label „Alman-Linker“ dazu, dass Menschen erstmal präventiv auf der anderen Seite der Barrikade, also als potentielle Täter verortet werden.
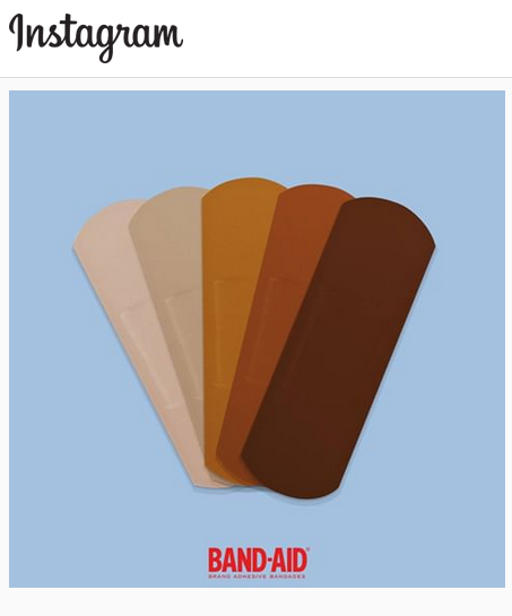
Der Beitrag des Wundpflasterherstellers Band-Aid gegen Rassismus – ein gutes Beispiel dafür, wie die Forderung nach Anerkennung und Repräsentation in „Diversity“-Imagekampagnen aufgegriffen wird. (Screenshot Instagram) 
Der neue Bachelor in den USA ist jetzt pünktlich zu #Black-Lives-Matter zum ersten mal „PoC“. 
„Black Bill Gates in the making” – Beyoncé als identitätspolitische „Empowerment”-Ikone. 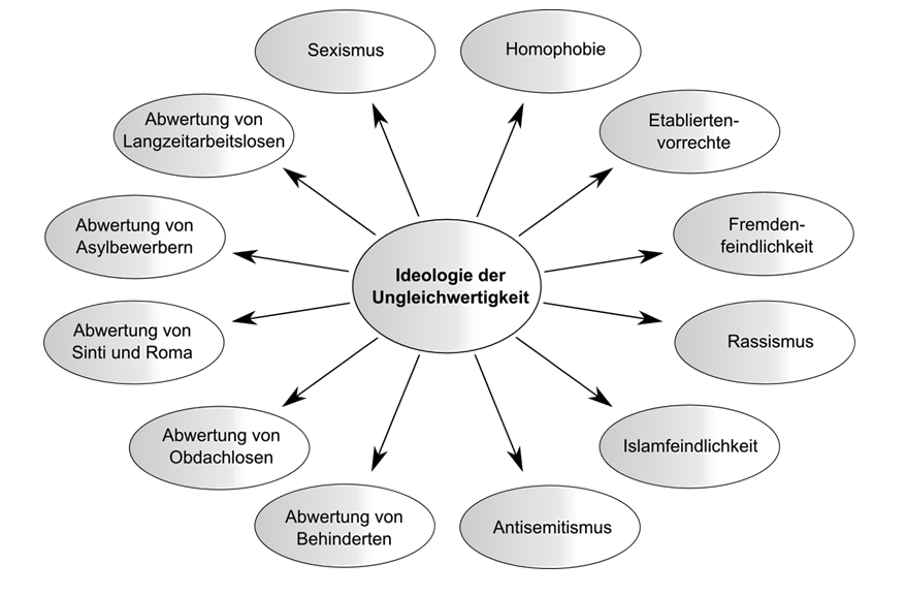
Die „GMF-Blume“ veranschaulicht, wie verschiedene Diskriminierungsmerkmale unvermittelt und beliebig als „gleichwertig“ nebeneinandergestellt werden. Klasse kommt hier nur versteckt in den Kategorien „Arbeitslos“ und „Obdachlos“ vor. 
So stellt sich die „Panthifa“ die Zusammenarbeit mit ihren weißen Verbündeten vor. 
Die Demo-„Leitlinien“ der „Migrantifa“-Zürich (Screenshot Facebook). 
Identitätspolitik in der linken Szene in Deutschland.
(m) „Minderheiten statt Mehrheiten“
Zu den Kernelementen des Marxismus gehört die Theorie des „revolutionären Subjekts“, also die Auffassung des Proletariats als einziger Klasse im Kapitalismus, die nicht nur die zahlenmäßige Stärke, das durch ihre Lebenslage bedingte Organisationspotential und durch ihre Stellung im Produktionsprozess die nötige Macht besitzt, um die Bourgeoisie als herrschende Klasse zu stürzen, sondern die gleichzeitig auch als erste Klasse in der Menschheitsgeschichte dazu in der Lage ist, die Klassenherrschaft überhaupt aufzuheben. Gegenüber dem Kapital verkörpert die Arbeiterbewegung „die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl“. (MEW 4, S. 473)
Charakteristisch für die postmoderne Identitätslinke ist, dass sie im Gegensatz zum Marxismus, der angesichts des gemeinsamen Gegners die Einheit trotz Vielfalt betont, einseitig die Differenz in den Mittelpunkt ihrer Politik stellt. Die scharfe Abgrenzung der postmodernen Linken vom Marxismus drückt sich am deutlichsten in ihrer grundsätzlichen Ablehnung der „großen Erzählungen“ und der historischen „Kollektivsubjekte“ aus. Aus Sicht der Identitätslinken existieren nur noch Individuen in einer fluide gewordenen, angeblich „post-industriellen“ Gesellschaft ohne feste Strukturen. Die Hoffnung auf emanzipatorische Veränderungen (nicht mehr Revolution) findet die Identitätslinke nur noch in einzelnen diskriminierten und ausgegrenzten „communities“, die für die Anerkennung ihrer Identität und ihrer damit verbundenen Rechte kämpfen. Das Potential für Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse geht demnach nur noch von den Rändern der „Mehrheitsgesellschaft“ aus, nicht mehr von der gesellschaftlichen Mehrheit selbst. Von der Arbeiterklasse als positivem Bezugspunkt hat sich die postmoderne Identitätslinke längst verabschiedet.
Die Debatten innerhalb der Identitätslinken drehen sich zu einem großen Teil um immer neue Abgrenzungen und „Differenzkategorien“ innerhalb und zwischen den verschiedenen Minderheiten. Ständig werden neue Identitäten konstruiert, die mit bisherigen Gruppenkonstruktionen nicht mehr vereinbar sind. Die Geschichte der Frauenbewegung bzw. des Feminismus liefert vielleicht das eindrücklichste Beispiel für die fortschreitende identitätspolitische Vereinzelung und Atomisierung einer Identitätskategorie. Die immer weitere Ausdifferenzierung von Frauen auf Frauen auf Lesben und schließlich die ganze LSBTQIA*-Alphabets-„community“ bis hin zum heutigen „queer Feminismus“, die ursprünglich den Zweck haben sollte, die Bewegung für bisher ausgegrenzte Gruppen zu öffnen, hat im Effekt keineswegs dazu geführt, dass diese dadurch wirklich breiter und schlagkräftiger geworden wäre. Im Gegenteil, sie ist durch innere Grabenkämpfe so sehr zersplittert, dass es selbst am 8. März kaum mehr in irgendeiner größeren Stadt in Deutschland gelingt, eine Demo mit gemeinsamen Inhalten und Kernforderungen auf die Beine zu stellen. Meistens spalten sich die Bündnisse schon an der Frage, wer an der Demo überhaupt teilnehmen darf (Männer ja oder nein? Transfrauen ja oder nein? Etc.). Die Auffassung, nur die unmittelbare Betroffenheit von möglichst identischen Diskriminierungserfahrungen schaffe die Grundlage für gegenseitiges Verständnis und gemeinsamen Kampf führt unweigerlich in eine immer tiefere Individualisierung. Schwarze und weiße Frauen, Heteras und Lesben, Cis- und Transfrauen, Bisexuelle und Asexuelle und – in der Szene nicht selten die Gretchenfrage mit dem größten Spaltungspotenzial – Frauen mit und ohne Kopftuch sowie alle denkbaren Kombinationen dieser Merkmale, sie alle machen demnach unterschiedliche Erfahrungen und kämpfen deshalb am besten nur für sich und unter sich.
Tendenziell führt die postmoderne Identitätspolitik also immer stärker dazu, dass die jeweiligen Minderheiten, anstatt als Unterdrückte ihre Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt zu stellen und sich gemeinsam gegen die herrschenden Verhältnisse zu stellen, jeweils auf eigene Faust und für ihre „community“ versuchen ihre jeweiligen Partikularinteressen durchzusetzen. Ihren realen ökonomischen Schauplatz findet diese Konkurrenz zwischen den diskriminierten Minderheiten dort, wo es um die Beantragung staatlicher und privater Fördermittel geht. Dabei ist jede Antragstellerin objektiv dazu gezwungen, jeweils zu begründen, warum gerade ihr Anliegen finanzierungswürdig ist und nicht das der anderen Gruppen. Ist das Beratungsangebot für „queere“ Jugendliche oder das für geflüchtete Mädchen wichtiger? Soll die Stadt das Frauenhaus oder den Schwulentreff bezuschussen? Was hat mehr gesellschaftliche Relevanz, Prävention gegen Antisemitismus oder gegen antimuslimischen Rassismus? Nicht selten setzt der bürgerliche Staat genau an dieser empfindlichen Stelle gezielt mit dem Hebel der weiteren Spaltung und den Mechanismen der Integration an.
Häufig läuft postmoderne Identitätspolitik zudem auf einen faktischen „Separatismus“ hinaus, also auf die Vorstellung Minderheiten müssten darauf hinarbeiten, sich möglichst von der Mehrheitsgesellschaft abzukapseln. Teile der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den USA vertraten zum Beispiel einen schwarzen Separatismus. In der Feministischen Bewegung gab es in den 1980er Jahren auch in Deutschland eine Strömung, die Homosexualität unter Frauen unter der Parole „Lesbainismus ist die Praxis“ als politischen Ausweg aus dem „Patriarchat“ propagierte – wer trotzdem mit dem „Feind“ ins Bett ging galt als Verräterin.[55] Verschiedene Spielarten des identitätspolitischen Separatismus werden heute z.B. von den oben bereits erwähnten „Migrantifa“- und „Panthifa“-Gruppen vertreten, aber auch von der sogenannten „Frauen*streik“-Kampagne, die jährlich am 8. März versucht einen „feministischen Streik“ nur von und für Frauen zu organisieren.[56] „Emanzipation“ wird aus separatistischer Sicht im schlechtesten Fall nicht mehr verstanden als Aufhebung der gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnisse, sondern als erfolgreicher Rückzug in die eigenen „Safe Spaces“, „Freiräume“ und Subkulturen, in denen die Angehörigen der jeweiligen Minderheiten unter sich sein und sich scheinbar den gesellschaftlichen Verhältnissen entziehen können, die ihr Leiden verursachen.
Auch in der Arbeiter- und kommunistischen Bewegung hat es, wenn man so will, immer wieder Formen von organisatorischem Separatismus gegeben, zum Beispiel in Form von reinen Frauenorganisationen. Im Gegensatz zum identitätspolitischen Separatismus waren diese aber nie als Selbstzweck gedacht, sondern als Mittel im Klassenkampf. Die Frauenorganisationen hatten nie das Ziel oder die Aufgabe, das Proletariat in Männer und Frauen zu spalten und den Kampf der Frauen gegen ihre Männer zu organisieren. Es ging darum die Frauen für die breitere Arbeiterbewegung zu mobilisieren und ihren konkreten Problemen und Erfahrungen eine Plattform und einen organisierten Ausdruck zu geben, so dass diese in den Klassenkampf insgesamt einfließen konnten. Organisatorischer Separatismus in der kommunistischen Tradition zielt also gerade nicht darauf ab, Minderheiten aus der Arbeiterbewegung abzusondern, sondern im Gegenteil als Mittel, um sie in diese zu integrieren.
In Theorie und Praxis der Identitätslinken dreht sich alles um den Anspruch, schon im hier und jetzt, also unter kapitalistischen Verhältnissen, Diskriminierungen und Ausgrenzungsmechanismen so weit wie möglich zu überwinden. Das ist die Kernidee hinter dem Konzept der „Freiräume“, der „Awareness-Teams“, der Antidiskriminierungsworkshops und vielem mehr. Dabei sind die Identitätslinken weitgehend blind dafür, dass sie durch genau dieses Politikverständnis ständig neue Ausschlüsse produzieren und als mehrheitlich kleinbürgerliche Akademiker in ihrer Szene weitgehend unter sich bleiben. Voraussetzung dafür, um sich im abgehobenen Sprachuniversum dieses sozialen Biotops zurechtzufinden und mitreden zu können, ist mindestens ein geisteswissenschaftlicher Hochschulabschluss – und letzteres ist genau das, was in unserer rassistischen Gesellschaft vor allem migrantischen Jugendlichen aus der Arbeiterklasse systematisch vorenthalten wird. Wer den Sprach- und Verhaltenskodex der Identitätslinken nicht verinnerlicht hat und z.B. als proletarischer Jugendlicher „behindert“ oder „schwul“ als Schimpfwort benutzt, wird kurzerhand aus dem autonomen Jugendzentrum entfernt. Die „Belehrung“ folgt in der Regel nicht durch ein wohlwollendes Gespräch auf Augenhöhe, sondern durch direkten Ausschluss oder einen Shitstorm in den sozialen Medien. Wer sich schonmal in einem der Szene-Treffpunkte aufgehalten hat kennt wahrscheinlich den Sticker: „No racism, no sexism“ und vor allem: „no discussion!“
Die fast vollständige Trendwende weg von klassen- und hin zu identitätspolitischen Themen in den 1990er Jahren ist kein unwesentlicher Faktor dafür, dass die breitere Linke ihre ehemalige Verankerung in der Arbeiterklasse so gut wie vollständig verloren hat. Der „Unterschicht“ tritt diese Linke allenfalls noch von oben herab und mit erhobenem identitätspolitischen Moralzeigefinger entgegen. Die harten sozialen Themen wie Hartz IV, Wohnungsnot und Altersarmut, von denen Millionen der politisch Abgehängten in Deutschland tagtäglich unmittelbar betroffen sind, werden mehr oder weniger kampflos den faschistischen Rattenfängern und ihrer sozialen Demagogie überlassen.
Abschließend drängt sich noch die Frage auf, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass die postmoderne Identitätspolitik innerhalb der reformistischen Linken und in Teilen des bürgerlich-liberalen Milieus so große Popularität gewinnen konnte. Als Kontext ist dafür sicherlich die Konterrevolution in den sozialistischen Ländern und die damit verbundene historische Niederlage der Arbeiterbewegung entscheidend. Die postmoderne Trendwende an den Universitäten und in der Bewegungslinken fand in den 1990er und 2000er Jahren vor dem Hintergrund massiver Angriffe auf die Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse statt. Während sich postmoderne Theoretiker und linke Aktivisten Fragen der Identitätspolitik, der Kultur und des Diskurses zuwandten, führte die Bourgeoisie auf dem Gebiet der Ökonomie und der Sozialpolitik einen Angriff nach dem anderen durch (wichtigste Stichworte in Deutschland: „Treuhand“ und „Agenda 2010“). Die Identitätspolitik konnte unter anderem auch deshalb so einflussreich werden, weil sie für das Kapital keinerlei Gefahr darstellt und staatlich nicht bekämpft, sondern sogar systematisch gefördert wird (durch Unilehrstühle, die Bundeszentrale für politische Bildung, Antidiskriminierungsstellen, etc.). Die meisten großen Konzerne integrieren identitätspolitisches „Diversity“-Management schon seit vielen Jahren in ihre Unternehmenspolitik. Dies hat unter anderem auch dazu geführt, dass in diesem Bereich ein wachsender Arbeitsmarkt entstanden ist, der für postmoderne Identitätslinke attraktive Karrieremöglichkeiten eröffnet. So kann man sich im Studium mit postcolonial studies oder queer theory beschäftigen und sich ein paar Jahre lang als radikale Gesellschaftskritikerin fühlen, um dann das gewonnene „kulturelle Kapital“ als Antirassismustrainerin, „Diversity consultant“ oder diskriminierungssensible Personalmanagerin in bare Münze umzusetzen. In den USA wurde dieses „Diversity Business“ schon 2003 auf ein Volumen von rund 8 Milliarden US-Dollar geschätzt. Seit der Wahl von Donald Trump, dem Aufkommen von #MeToo und jetzt mit der neuen #BLM Protestwelle erlebt die Branche einen regelrechten Boom.[57]
Fazit: „class struggle, not race struggle”
Aus marxistischer Sicht ist der Klassenkampf nie nur eine rein ökonomische Angelegenheit, sondern er findet notwendig immer auch auf dem Terrain des gesellschaftlichen Überbaus statt. Es sind, so schreiben Marx und Engels im Kommunistischen Manifest, die „juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz,ideologischen Formen, worin sich die Menschen“ der ökonomischen Konflikte und Widersprüche „bewußt werden“ und diese „ausfechten.“ (MEW 13, S. 9) Lenin betont in Was tun? in scharfer Abgrenzung von den „Ökonomisten“, dass sich der Klassenkampf nicht auf bloßen „Trade-Unionismus“, also rein ökonomische Kämpfe, beschränken darf, sondern dass „die wesentlichsten, entscheidenden Interessen der Klasse“ nur durch „radikale politische Umgestaltungen befriedigt werden“ können. (LW 5, S. 402)
Um aber politisch kämpfen zu können müssen sich die Arbeiter zunächst über ihre Lage als Klasse bewusst werden und, wenn man so will, eine kollektive Identität entwickeln. Es gibt keinen Automatismus, der den festangestellten deutschen Maschinenbauer, den muslimischen Erzieher und die aus Polen eingewanderte Bauzeichnerin dazu bringt, sich auf Grundlage ihrer jeweils unterschiedlichen konkreten Arbeits- und Lebensrealität als einer Klasse zugehörig zu fühlen. Die Arbeiterinnen müssen, in den Begriffen des Marxismus, von der „Klasse an sich“ zur „Klasse an und für sich“ werden. (MEW 4, S. 181) Die Einsicht in die Gemeinsamkeit ihrer Lage setzt aber gerade die Abstraktion von ihrer jeweils konkreten Situation voraus, nicht den typisch identitätspolitischen Fokus auf das jeweils Individuelle und Partikulare, dass sie voneinander unterscheidet. Praktisch gelingen kann diese Einsicht meist nur durch gemeinsame Kämpfe und durch die gezielte Agitation und Propaganda der Avantgarde des Proletariats. Unverzichtbar sind dabei nicht nur eigene Kampforganisationen, sondern auch eine eigene Kultur, die von der der Bourgeoisie unabhängig ist und in der sich die Lebensrealität, die Leidenschaften und die Interessen der Arbeiter widerspiegeln. Notwendige Voraussetzung dafür, dass die Klasse ideologisch unabhängig werden und sich selbst ein kohärentes Bild ihrer Situation machen kann, ist das, was Antonio Gramsci als „organische Intellektuelle“ bezeichnet, also Organisatoren und Theoretiker die in der Lage sind, den ideologischen Klassenkampf gegen die Bourgeoisie zu führen und die zersplitterten Erfahrungen der verschiedenen Teile des Proletariats zu einem einheitlichen Klassenbewusstsein zu integrieren.
In diesem Sinne betreiben gewissermaßen auch Kommunisten Identitätspolitik. Im scharfen Kontrast zur postmodernen Identitätslinken gehen Marxistinnen aber davon aus, dass der Klassenkampf erstens nicht nur auf der Ebene des Überbaus, und zweitens nicht durch kleine gesellschaftliche Minderheiten, sondern nur durch die möglichst einheitlich organisierte Arbeiterklasse als ganze erfolgreich geführt und gewonnen werden kann. Wirkliche Errungenschaften, selbst auf der Ebene bloßer Reformen, können nur dann gesichert werden, wenn das bewusste und organisierte Proletariat seine ökonomische Macht dazu benutzt, das Kapital zu Zugeständnissen auf Ebene des Staatsapparats und der ökonomischen Basis zu zwingen. Eine grundlegende Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist aber nicht durch Reformen, sondern nur durch eine Revolution möglich. Das Proletariat muss die Bourgeoisie als herrschende Klasse stürzen, selbst die politische Macht erobern und die gesamte ökonomische Basis umwälzen. Nur dann wird die Gesellschaft einen neuen politischen, kulturellen und ideologischen Überbau hervorbringen können, in dem die „Muttermale der alten Gesellschaft“ allmählich überwunden werden und schließlich absterben.
In der bereits zu Anfang kurz zitierten politischen Orientierung der Black Panther Party, die so zumindest von der Strömung um Fred Hampton und Bobby Seale vertreten wurde, spiegelt sich der dialektische Zusammenhang zwischen Basis und Überbau richtig wider. Den Panthers war einerseits klar, dass zunächst eine eigenständige Organisation notwendig war, die an den konkreten alltäglichen Problemen und Unterdrückungserfahrungen der schwarzen Arbeiterklasse in den Ghettos ansetzte, deren Lebensverhältnisse sich stark von denen der weißen Arbeiter unterschieden. Der politische Kampf hatte die Herausbildung einer kollektiven Identität und einer eigenen Kultur zur Voraussetzung, die sich positiv von der Kultur der weißen Unterdücker abgrenzen und nicht nur ein Bewusstsein für die ökonomische Lage, sondern auch für die eigenen kulturellen Wurzeln, den eigenen Wert („Black is beautiful!“) und die eigene Stärke („Black Power!“) verankern musste. Diese, wenn man so will, materialistische Identitätspolitik sah aber nie in „allen Weißen“ oder anderen ethnischen „communities“ den politischen Gegner, sondern in der Bourgeoisie – „class struggle, not race struggle“. Ihr Ziel war es, die ideologischen und organisatorischen Voraussetzungen für den gemeinsamen Klassenkampf aller Teile des Proletariats zu schaffen. Die Black Panthers versuchten dieses Ziel in der 1969 durch Hampton ins Leben gerufene „Rainbow Coalition“ zu verwirklichen, einem Bündnis aus kämpferischen Basisorganisationen, die die verschiedenen Ethnien innerhalb des amerikanischen Proletariats repräsentierten. Hampton machte seinen politischen Standpunk unmissverständlich klar, als er sagte: „Wir bekämpfen den weißen kapitalismus nicht mit schwarzem Kapitalismus, sondern mit Sozialismus.“[58] Kurz darauf wurde er in seinem eigenen Bett im Schlaf von der Polizei erschossen – die Bourgeoisie hatte die reale Gefahr erkannt, die von einem Zusammenschluss des amerikanischen Proletariats über die Rassengrenzen hinweg und einer vereinigten sozialistischen Bewegung ausging.
Fassen wir also abschließend die wichtigsten Kritikpunkte an der postmodernen Identitätspolitik zusammen. (1) Sie verschleiert die wirklichen Ursachen der sozialen Ungerechtigkeit im Kapitalismus, indem sie anstatt der Klassenspaltung und der ökonomischen Ausbeutung Mechanismen der Diskriminierung und der Ungleichverteilung von „Privilegien“ in den Mittelpunkt rückt. Anstatt also eine materialistische Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse vorzunehmen liefert sie nur idealistische und oberflächliche Erklärungen, die mehr Verwirrung als Klarheit stiften. Als politische Konsequenz aus dieser Analyse wird nicht mehr um die Aufhebung der Ausbeutung, sondern nur noch um ein Ende der Diskriminierung und „Chancengleichheit“ in der kapitalistischen Konkurrenz gekämpft. (2) So sehr die postmoderne Identitätspolitik mit dem Anspruch auftritt, bisher angeblich unsichtbare gesellschaftliche Ungleichheiten aufzuzeigen, so sehr ist sie dabei oft selbst de facto klassenblind. Anstatt den inneren Zusammenhang zwischen Rassismus und Klassenspaltung im Kapitalismus aufzudecken stellt die Identitätspolitik beide Phänomene – in Abgrenzung von der angeblich marxistischen Hierarchisierung zwischen „Haupt- und Nebenwidersprüchen“ – einfach „gleichberechtigt“, dadurch aber völlig unvermittelt und beliebig nebeneinander. Eine Strategie und Taktik, die den Rassismus als Aspekt der Klassenherrschaft bekämpft, ist auf dieser Grundlage unmöglich. (3) Sie trägt in der Praxis mehr zur Vertiefung der Spaltung der Arbeiterklasse entlang von Identitätslinien als zu deren Überwindung und der Formulierung eines gemeinsamen Klasseninteresses bei. Anstatt auf den Kampf gegen einen gemeinsamen Gegner zu fokussieren drehen sich identitätspolitische Diskussionen vor allem um Abgrenzungen von der „weißen Mehrheitsgesellschaft“ sowie von anderen Minderheiten, zu denen oft ein objektives Konkurrenzverhältnis besteht. Im schlechtesten Fall wird Identität ganz vor Klasse gestellt, so dass schwarze Arbeiter und schwarze Kapitalisten zu einer imaginären „community“ verschmelzen, während die Spaltungslinie zwischen schwarzen und weißen Arbeitern betont wird. Das Gemeinsame wird nur in der Identität, nicht in der Klassenzugehörigkeit gesucht. (4) Das Konzept des „Allyship“ als Bündnis zwischen „Privilegierten“ und Unterdrückten ersetzt die aus der Tradition der Arbeiterbewegung stammende Idee der Solidarität auf Augenhöhe zwischen Genossen mit gemeinsamen politischen Zielen und einem geteilten Klassenstandpunkt. Diese Denkweise steht einem klassenbewussten Antirassismus entgegen und ist gleichzeitig offen für die Vorstellung, die Unterdrückung könnte im Bündnis mit den Mächtigen anstatt im gemeinsamen Kampf gegen diese überwunden werden, sofern sie sich nur als „Allies“ gewinnen lassen. (5) Durch die ständige Wiederholung ihres Mantras, dass „wir alle“ in die Reproduktion der gesellschaftlichen Machtverhältnisse verstrickt sind und auf die ein oder andere Weise von Rassismus und anderen Diskriminierungsformen „profitieren“, verschiebt die Identitätspolitik das Problem auf die Ebene des individuellen Verhaltens und verschleiert dadurch die dahinter stehenden ökonomischen und politischen Strukturen. Die eigentliche Trennlinie verläuft aber nicht zwischen den Identitäten, sondern zwischen den Klassen. (6) Anstatt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Rassismus und andere Spaltungsideologien Herrschaftsinstrumente in den Händen der Bourgeoisie sind und der gesamten Arbeiterklasse schaden, erklärt sie die „Mehrheitsgesellschaft“ zum Problem und zum Ausgangspunkt der Unterdrückung. Anstatt in der gesellschaftlichen Mehrheit, also der Arbeiterklasse, das revolutionäre Subjekt zu sehen, findet sie emanzipatorische Potenziale nur noch bei Minderheiten und Randgruppen. Das ist die Grundlage der objektiv massenfeindlichen und sektiererischen Haltung und der fortschreitenden Atomisierung der Identitätslinken. (7) Die identitätspolitische Praxis der „Selbstreflexion“ ersetzt den kollektiven politischen Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung durch die vereinzelte Arbeit an der individuellen Selbstverbesserung. (8) Die Forderungen nach „Anerkennung“ und „Repräsentation“ sowie nach einer „diskriminierungsfreien“ Sprache und der „Dekonstruktion“ von Rollenbildern verschieben den Kampf gegen Unterdrückung von der Ebene des ökonomischen und politischen Klassenkampfs auf die Ebene der Kultur und des Diskurses, sie zielen also ausschließlich auf Veränderungen im ideologischen Überbau ab und müssen letztlich wirkungslos bleiben. (9) Auf Ebene des Überbaus kann der Kapitalismus problemlos scheinbare Zugeständnisse machen, die weder an den materiellen Lebensbedingungen der Arbeiter noch an der Macht der Bourgeoisie auch nur das Geringste ändern. Die Kämpfe um „Anerkennung“ und „Repräsentation“ schüren vor allem Illusionen in die Reformierbarkeit des Kapitalismus und des bürgerlichen Staats. Während sich die sozialen Verhältnisse weiter verschlechtern, wird auf Ebene der Kulturproduktion und der „Diversity“-Politik parallel dazu die Illusion gesellschaftlichen Fortschritts erzeugt. (10) Durch ihren extrem akademischen und bevormundenden Diskurs trägt die postmoderne Identitätslinke wesentlich zur immer weiteren Entfremdung „der Linken“ (d.h. von dem, was öffentlich als solche wahrgenommen wird) von den am meisten unterdrückten und abgehängten Teilen der Arbeiterklasse bei, die sich durch die Politik der postmodernen Identitätslinken in ihren realen Problemen nicht nur nicht ernst genommen, sondern angegriffen und verhöhnt fühlen.
[1] Anmerkung: Dieser Artikel verwendet aus Gründen der Lesbarkeit und Allgemeinverständlichkeit keine gegenderte Sprache. Stattdessen wechselt er zwischen männlichem und weiblichem Plural. Dabei sind natürlich unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität immer alle angesprochen.
[2] Im englischen Original lautet das Zitat: “Working class people of all colors must unite against the exploitative, oppressive ruling class. Let me emphasize again — we believe our fight is a class struggle, not a race struggle.” Bobby Seale war einer der Mitbegründer der Black Panther Party. Das Zitat stammt aus seinen Memoiren: Seize the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton, S. 72.
[3] Sehr positiv war zum Beispiel das Signal des Solidaritätsstreiks aller Hafenarbeiter der International Longshore and Warehouse Union (ILWU) entlang der amerikanischen Westküste an „Juneteenth“, also dem 19. Juni 2020. (Siehe: https://peoplesdispatch.org/2020/06/20/this-juneteenth-workers-strike-for-black-lives/ ) Zu den radikalsten Teilen der Bewegung gehört die Sektion Black Lives Matter Greater New York, die sich stark auf das Erbe der Black Panthers beziehen. Sie stellen nicht nur weitreichende soziale Forderung, wie z.B. eine kostenlose Gesundheitsversorgung für alle, sondern stellen sich auch klar gegen Reformillusionen und die Tendenz in Teilen von #BLM, sich vor den Wagen des Wahlkampfs der Demokratischen Partei spannen zu lassen. Für weiter Infos siehe die Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blmgreaterny/
[4] Gabriel Rockhill, The CIA Reads French Theory. On the Intellectual Labor of Dismantling the Cultural Left. Siehe:https://thephilosophicalsalon.com/the-cia-reads-french-theory-on-the-intellectual-labor-of-dismantling-the-cultural-left/?fbclid=IwAR0lRAMwWjdFGFKfRPdRO18gKej-jUZrjcEm6BD4FpoDwcJjuDk4ZcLKun8
[5] Mir ist klar, dass auch dieser provisorische Begriff nicht unproblematisch ist. Ich lege die Betonung hier auf das Adjektiv postmodern, da auch die neuen Sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er schon identitätspolitische Themen aufgriffen, diese aber in der Regel mit sozialpolitischen und ökonomischen Forderungen verbanden. Erst in den 1990er Jahren fand der fast vollständige Rückzug auf das Gebiet des Diskurses und der Kultur statt. Ein Großteil der in diesem Text als postmoderne Identitätslinke bezeichneten Gruppe identifiziert oder fühlt sich selbst als „links“. Nur wird genau dadurch die Bedeutung dieses ohnehin schwammigen Adjektiv stark verwässert. In Wirklichkeit, und das versucht dieser Artikel letztlich auch zu zeigen, steht diese Strömung der Tradition des bürgerlichen Liberalismus deutlich näher als der des Marxismus und der Arbeiterbewegung, also der klassischen „Linken“. Weiterführende Infos zu Positionen und Geschichte dieses politischen Spektrums geben folgende kürzlich erschienene Bücher (die allerdings selbst mit der identitätspolitischen Linken sympathisieren oder nur eine sehr moderate Kritik formulieren): Georg Auernheimer, Identität und Identitätspolitik, Köln 2020 (PapyRossa-Verlag); Lea Susemichel/Jens Kastner, Identitätspolitik. Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart, Münster 2018 (Unrast-Verlag).
[6] Marx in seiner Schrift Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: MEW 1, S. 385.
[7] Zu den Bestsellern innerhalb der linken Szene, die diese These in den frühen 2000ern populär gemacht haben, gehört zum Beispiel das Buch des den Zapatistas sehr nahe stehenden Soziologen John Holloway: „Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen“, Münster 2002.
[8] Den Begriff „Subalterne“ übernehmen die postcolonial studies von Gramsci, der damit alle unterdrückten und ausgebeuteten Schichten bezeichnet. In den postmodernen Theorien verliert der Begriff seinen Klasseninhalt fast vollständig und bezeichnet vor allem „marginalisierte“ Identitäten. Vgl. z.B.: Friederike Habermann, Mehrwert, Fetischismus, Hegemonie: Karl Marx‘ „Kapital“ und Antonio Gramscis „Gefängnishefte“, in: Reuter/Karentzos (Hrsg.), Schlüsselwerke der Postcolonial Studies, 2012, S. 25.
[9] Diese Diskussion wurde innerhalb der Linken Szene und der Dritte-Welt-Bewegung in den 1980er und 1990er Jahren so ausufernd geführt, dass sich eine Fußnote zu einem einzelnen Text erübrigt.
[10] Siehe dazu den Sammelband „Marx und der globale Süden“ (Felix Wemheuer, 2016), darin insbesondere die Beiträge von Vivek Chibber.
[11] Eines der dreistesten Beispiele aus jüngster Zeit lieferte Wolfram Weimer auf n-tv.de (16. Juni 2020), der sich in einem Kommentar darüber beschwert, dass die Black Lives Matter Bewegung Statuen von Rassisten und Sklavenhändlern stürzt, obwohl eigentlich Marx der übelste Rassist war: „Die Rassismus-Debatte wird zur Bilderstürmerei. Von linker Seite werden Denkmäler von Kolumbus, Churchill und Bismarck attackiert. Dabei war vor allem Karl Marx einer der übelsten Rassisten. Deutsche Schulen, Straßen und Plätze sollten seinen Namen nicht mehr tragen.“ Quelle: https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Karl-Marx-war-einer-der-uebelsten-Rassisten-article21848678.html. Ein an Dreistigkeit schwer zu überbietendes Beispiel dafür, wie strammer Antikommunismus, Geschichtsrevisionismus und Identitätspolitik problemlos Hand in Hand gehen können, liefert der Artikel „Kommt endlich über euren Stalinfetisch hinweg“ (16. Juni 2020) von der taz-Onlineredakteurin Julia Wasenmüller im Missy Magazin („Magazin für Pop, Politik und Feminismus“). Quelle: https://missy-magazine.de/blog/2020/06/16/kommt-endlich-ueber-euren-stalinfetisch-hinweg/.
[12] Auernheimer, Identitätspolitik, S. 41.
[13] Ein wunderbares Beispiel für die Popularisierung der Privilegientheorie liefert ein Beitrag auf der Nachrichtenplattform Buzzfeed unter dem Titel „How Privileged Are You? Check(list) Your Privilege“ mit mittlerweile mehr als 21 Millionen (!) Views. Dort kann man sich durch einen langen Fragebogen klicken und erfährt am Ende sprichwörtlich seinen „score“ auf einer Skala von 1 bis 100. Je nach Punktzahl wird man dann dazu aufgefordert, seine eigenen Privilegien zu reflektieren – oder man erhält eine „empowernde“ Nachricht, die einen dazu ermutigt, andere dazu aufzufordern, doch bitte ihre Privilegien zu reflektieren und sich durch den Fragebogen zu klicken. Hier der Link: https://www.buzzfeed.com/regajha/how-privileged-are-you?bfsource=bfocompareon Ähnliche „Privilege Charts“ oder „Privilege Bingos“ findet man im Internet in unzähligen Varianten.
[14] Das in Deutschland am weitesten Verbreitete Diskriminierungsmodell ist das der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (GMF) mit dem z.B. die Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet und das den meisten Lehr- und Fortbildungsmaterialien für Schüler und Lehrkräfte zugrunde liegt. Siehe zum GMF-Ansatz bei der Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/214192/gruppenbezogene-menschenfeindlichkeit; Eine Definition von Rassismus als Form von Diskriminierung mit einer individuellen, einer strukturellen und einer institutionellen Ebene gibt z.B. Birgit Rommelspacher: http://initiative-schluesselmensch.org/wp-content/uploads/2018/12/Rommelspacher-Was-ist-Rassismus.pdf Im englischen Sprachraum hatte in den letzten Jahren der Bestseller „White Fragility“ (2018) von der US-amerikanischen Antirassismus-Trainerin Robin DiAngelo große Reichweite.
[15] Eine ausführliche Darstellung dieser Theorie sowie ihrer Entstehungsgeschichte findet man in der englischsprachigen Wikipedia unter dem Stichwort „Intersectionality“.
[16] Zu „Klassismus“ als eine von vielen „Diskriminierungsformen“ siehe z.B. diese offizielle Definition der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2018/nl_04_2018/nl_04_gastkommentar.html; Im sehr einflussreichen Ansatz der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ wurde die Dimension Klasse nachträglich eingefügt, taucht neben den anderen Diskriminierungsformen aber nur als „Abwertung von Arbeitslosen bzw. Obdachlosen“ auf, beschränkt sich also auf die extremsten Ausprägungen von Armut und Verelendung, anstatt das Klassenverhältnis als solches in den Blick zu nehmen.
[17] Es lohnt sich bei Google einmal Suchbegriffe wie „white privilege“, „Alltagsrassismus“ oder „Rassismus Reproduktion“ einzugeben, um einen Überblick über diese Argumentationsmuster zu bekommen.
[18] Zur Einführung in die „Rassismuskritik“ siehe: Claus Melter/Paul Mecheril (Hrsg.), Rassismuskritik, 2 Bände, 2011. Die These, dass „alle Weißen“ von Rassismus profitieren und Teil des Problems sind, ist in der medialen Berichterstattung über die BLM-Bewegung schon fast zum Allgemeinplatz geworden. Susemichel und Kastner vertreten diese These z.B. mit Bezug auf den Begriff der „Dominnazkultur“ von Birgit Rommelspacher: „Mit Angehörigen der Dominanzkultur sind also all jene gemeint, die aufgrund der ethnischen Zuschreibung weiß von gesellschaftlichen Verhältnissen profitieren.“ (Identitätspolitiken, S. 90)
[19] Eine schnelle Googlesuche nach Begriffen wie „Awareness“ und „Achtsamkeit“ in Verbindung mit Rassismus ergibt eine lange Liste an Workshop- und Fortbildungsangeboten oder auch „Awareness-Teams“, die man für Parties und andere Großveranstaltungen anheuern kann, um dort auf den richtigen Umgang mit „Diversity“ zu achten.
[20] Siehe dazu zum Beispiel das analyse & kritik Sonderheft zu critical whiteness von 2013: https://www.akweb.de/ak_s/ak593/images/sonderbeilage_cw.pdf; Kurzdefinition: „white privilege ist die Abwesenheit der negativen Folgen von Rassismus […] White Privilege ist die Tatsache, dass deine Hautfarbe, wenn du weiß bist, den Verlauf deines Lebens mit großer Sicherheit positiv beeinflussen wird.“ (Reni Eddo-Lodge: Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, Tropenverlag 2020.) Im Zusammenhang mit den #BLM-Protesten veröffentlichte das VICE-Magazin eine Liste mit 50 Beispielen für das, was die Redaktion unter „white privilege“ versteht: https://www.vice.com/en_uk/article/4ayw8j/white-privilege-examples; Hier eine Liste aller Artikel zum Thema aus der englischsprachigen Ausgabe: https://www.vice.com/en_us/topic/white-privilege
[21] Gutes Anschauungsmaterial dafür, wie Firmen diese Konzepte in ihre Unternehmenspolitik und ihr Management integrieren, finden sich z.B. auf der Internetseite der „Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen“ Charta der Vielfalt – für Diversity in der Arbeitswelt, die natürlich auch ein Statement unter dem Hashtag #Black Lives Matter veröffentlicht hat: https://www.charta-der-vielfalt.de/ Im Missy Magazin und bei VICE erscheinen regelmäßig Listen mit Empfehlungen für Serien, in denen LGBTQs, Schwarze, POCs etc. repräsentiert sind, siehe z.B. Missy Magazin, „Binge Watching gegen das Patriarchat“: https://missy-magazine.de/blog/2020/06/05/binge-watching-gegen-das-patriarchat/; VICE Brasilien: https://www.vice.com/pt_br/article/8898×3/saudades-da-parada-gay-ne-minha-filha-assista-7-documentarios-e-lives-lgbtq-gratis.
[22] Ein aktuelles Beispiel für diese Art der Politik liefern die seit einiger Zeit verstärkt in Erscheinung tretenden „Migrantifa“-Gruppen, aber dazu weiter unten mehr.
[23] Ein schönes Beispiel für diese Sicht auf die Gesellschaft aus dem Missy Magazin: https://missy-magazine.de/blog/2020/06/30/bis-zur-letzten-patrone/
[24] In einem Artikel aus der deutschen Power and Privilege Sonderausgabe (25. Dezember 2018) heißt es z.B., dass „eine Weiße Person von der rassistischen Gesellschaftsordnung profitiert, auch wenn sie selbst Rassismus ablehnt.“ (https://www.vice.com/de/article/vbkxga/verschwende-deine-privilegien-nicht-nutze-sie); In der englischsprachigen Ausgabe von VICE erschien am 9. Juni 2020 der Artikel: „50 Examples of White Privilege to Show family Members Who Still Don’t Get It”; im Zusammenhang mit der aktuellen feministischen Protestwelle in Chile erschienen in der spanischsprachigen Ausgabe die Artikel: „No hay lugar para hombres en el feminismo“ (12. März 2019), „Cual es el lugar de los hombres en las manifestaciones der Día de la Mujer?” (8. März 2020).
[25] Der Begriff „globaler Süden“ hat nach 1989/90 sowohl im akademischen Diskurs als auch in den linken Solidaritätsbewegung den begriff „Dritte Welt“ und andere explizit antiimperialistische Begriffe abgelöst. Indem er scheinbar neutral eine geografische Weltregion beschreibt, anstatt explizit die Ungleichheits- und Abhängigkeitsverhältnisse im imperialistischen Weltsystem zu betonen, trägt er letztlich dazu bei, das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie zu entpolitisieren.
[26] Alle Zitate aus den Originaltexten stammen aus den Marx-Engels-Werken (MEW), angegeben wird jeweils die Bandnummer und die Seitenzahl.
[27] Susemichel und Kastner erwähnen in ihrem ganzen Kapitel zu den postcolonial studies z.B. mit keinem Wort die ökonomischen und militärischen Grundlagen des Kolonialismus, schreiben aber folgendes, so als wäre es die logischste Erklärung der Welt: „Ohne die konstruierte Unterlegenheit des Anderen gibt es keine eigene Überlegenheit. Hergestellt wird diese Hierarchie zunächst über Sprache, also wie über Andere/s gesprochen, geforscht, berichtet wird. Diese sprachlichen und mit Macht durchgesetzten Prozesse sind in den Postcolonial Studies als Othering beschrieben worden“ (Identitätspolitiken, S. 77) Hätte die Kolonialgeschichte also auch umgekehrt verlaufen können, wenn nur die Menschen in Lateinamerika oder Westafrika vor den Europäern auf die mächtige Idee des „Othering“ gekommen wären und sich selbst diskursiv als überlegen konstruiert hätten?
[28] Dazu: Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: LW 22, S. 198.
[29] Sehr überzeugend nachgezeichnet ist diese doppelte Entmenschlichung, einerseits des weißen Proletariats in den kapitalistischen Zentren und andererseits der Sklaven an der Peripherie, anhand der Schriften der wichtigsten Philosophen des bürgerlichen Liberalismus in: Domenico Losurdo, Freiheit als Privileg. Eine Gegengeschichte des Liberalismus, Köln 2011.
[30] Auf die „Naturalisierung“ als ein gängiges Muster in der Ideologie herrschender Klassen gehen Marx und Engels schon im Manifest ein: „Die interessierte Vorstellung, worin ihr eure Produktions- und Eigentumsverhältnisse aus geschichtlichen, in dem Lauf der Produktion vorübergehenden Verhältnissen in ewige Natur- und Vernunftgesetze verwandelt, teilt ihr mit allen untergegangenen herrschenden Klassen.“ (MEW 4, S. 478) Auf diese für den Kapitalismus typischen Phänomene der Naturalisierung oder auch des „Fetisch“ gehen Marx und Engels in ihren Schriften immer wieder ein, z.B. im Zusammenhang mit der Ware, dem Kapital oder der Lohnarbeit. Dabei betonen sie, dass diese Illusionen weder einfach im luftleeren Raum entstehen noch unbedingt von den Herrschenden bewusst mit dem Ziel ausgedacht werden, die Verhältnisse zu verschleiern. Diese Illusionen werden zu einem Großteil selbst von den sozialen Verhältnissen erzeugt, die sie verschleiern. Es bedarf daher der dialektisch-materialistischen Wissenschaft um sie zu entschleiern.
[31] Zum dialektischen Verhältnis zwischen „Sein“ und „Bewußtsein“ und „Basis“ und „Überbau“, siehe Marx‘ berühmtes Vorwort zu seiner Schrift Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW 13, S. 8-9.
[32] Einen ersten Aufschlag zur empirischen Erforschung der wirklichen Zusammensetzung des Proletariats und seiner Lebensverhältnisse lieferte Engels mit seiner berühmten Frühschrift zur Lage der arbeitenden Klasse in England (1845), die selbst von bürgerlichen Wissenschaftlern bis heute z.T. als erste soziologische Studie im modernen Sinne gelobt wird. Aber auch in Marx Kapital und seinen anderen ökonomischen Schriften taucht das Proletariat nie nur in Gestalt der weißen männlichen Industriearbeiter auf.
[33] Überhaupt taucht der Marxismus in den Texten der Identitätslinken fast ausschließlich als negative Kontrastfolie auf, über dessen „Klassenreduktionismus“ und „Hauptwiderspruchs“-Problem in der Szene offensichtlich so breiter Konsens herrscht, dass es keiner Belege mehr bedarf. Siehe z.B. das ganze erste Kapitel in Susemichel/Kastner, Identitätspolitiken, S. 21-28.
[34] Susemichel/Kastner unterstellen diese Position z.B. wenn sie schreiben: „Denn die Emanzipation der Frau lässt sich […]nur durch den Klassenkampf erreichen, sie ist bloßer ‚Nebenwiderspruch‘, der sich in Wohlgefallen auflösen würde, sobald nur der kapitalistische Hauptwiderspruch zwischen Lohnarbeit und kapital aufgehoben sei. […] Gemeinsam mit der sozialistischen Gesellschaft würde also automatisch auch Geschlechtergerechtigkeit Wirklichkeit werden.“ (Identitätspolitiken, S. 99)
[35] So Marx im Vorwort zur ersten Auflage von Das Kapital (MEW 23, S. 12).
[36] Diese Begriffe tauchen unter anderem in Marx‘ Artikelserie zur Kolonialherrschaft in Indien auf, aber auch in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie und einigen anderen Texten. Einen vollständigen Überblick gibt das Begriffsregister der Marx-Engels-Werke.
[37] Siehe zu dieser Auseinandersetzung um „Universalismus“ und „Partikularismus“ in den postcolonial studies das Interview mit Vivek Chibber: Wie spricht die Subalterne, in: Wemheuer (Hrsg.), Marx im Globalen Süden, Köln 2016, S. 61.
[38] Diese klassische Definition stammt aus Lenins Schrift Die große Initiative, LW 29, S. 410.
[39] Mehr zum Thema gibt es im Bolsche-Wiki auf der Seite der AG Klassenanalyse: https://wiki.kommunistische.org/index.php?title=AG_Klassenanalyse
[40] Die Textzeile stammt aus dem Song „Formation“ auf dem Album „Lemonade“ (2016). Zu Beyoncé als „Empowerment“-Ikone: „Beyoncé empowers women who want to have it all: the stellar career, the beautiful family, the expensive wardrobe, the fat bank account.” Link: https://www.savoirflair.com/culture/329529/most-empowering-beyonce-lyrics Beyoncé wird in der Pop-Presse auch immer wieder als identitätspolitische „Aktivistin“ gefeiert: https://www.billboard.com/articles/columns/hip-hop/8061796/beyonce-activist
[41] https://www.buzzfeed.com/regajha/how-privileged-are-you
[42] Zumindest in der amerikanischen Popkultur ist der privilegierte „straight white male“ längst zur allgemeinen Metapher für die Spitze der identitätspolitischen Nahrungskette geworden. Er ist ein beliebtes Negativbild in der linksalternativen Kulturszene. Um nur ein beliebiges Beispiel zu zitieren, siehe z.B. den Songtext zu „American Tune“ von „Andrew Jackson Jihad“: „I’m a straight white male in America – I have all the luck I need…“Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=sLg5POTvVzs
[43] Das besagt zum Beispiel eine kürzlich erschienene Studie der beiden US-Ökonomen Angus Deaton und Anne Case. Siehe dazu: https://www.derstandard.de/story/2000118687185/rasanter-niedergang-der-amerikanischen-mittelschicht
[44] Um nur einige relativ willkürliche Beispiele zu zitieren: In den Wochen nach dem Mord an George Floyd interviewte die BILD Boris Becker über den Alltagsrassismus, den seine Kinder erleben, druckte ein Interview mit Uchechi May Nzerem Chineke, die die Demos in Berlin organisiert und veröffentlichte ein Video, in dem schwarze Deutsche aufzählen, welche Sätze sie nicht mehr hören wollen: https://www.bild.de/video/clip/bild-video-kommentar/rassismus-saetze-die-schwarze-in-deutschland-nicht-mehr-hoeren-wollen-71232838.bild.html
[45] Eine unvollständige Liste von US-amerikanischen Firmen, die auf #BLM sofort mit gezielten Imagekampagnen reagiert haben, findet sich hier: https://www.buzzfeed.com/terrycarter/people-brands-called-out-for-racism
[46] Siehe dazu ihr theoretisches Hauptwerk „Gender Trouble“, in dem sie ihre wichtigsten philosophischen Inspirationen übrigens von niemand anderem als Nietzsche bezieht – der nun wirklich nicht für seine liberalen oder fortschrittlichen Einstellungen bekannt war.
[47] Vgl. Susemichel/Kastner S. 132.
[48] Siehe dazu Auernheimer, Identität und Identitätspolitik, S. 63.
[49] Siehe zu „kultureller Aneignung“ zum Beispiel: Susemichel/Kastner, Identitätspolitiken, S. 76-91.
[50] Hier nur ein beliebiges, aber repräsentatives und oft zitiertes Beispiel aus den Tiefen des Internets. https://missy-magazine.de/blog/2016/07/05/fusion-revisited-karneval-der-kulturlosen/
[51] Quelle: Facebookseite der „Migrantifa“-Zürich https://www.facebook.com/LinkePoC/
[52] Die „Panthifa“ auf Twitter: https://twitter.com/panthifa Panthifa-Blog: https://panthifa.blackblogs.org/
[53] Zur Geschichte dieser Begriffsverschiebung und zu ihren politischen Konsequenzen, siehe z.B. das interessante Buch von Jodi Dean, Comrade. An Essay on Political Belonging, 2019. Im Kontext der #BLM-Bewegung entstand auch ein Webinar, in dem Dean ihr Thesen und ihre Kritik am Konzept des „allyship“ vorstellt und auf Fragen von Bewegungsaktivisten antwortet. Das ganze gibt es hier auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UDmDg2sHZ9g Zum Konzept „Allyship“ siehe z.B.: https://guidetoallyship.com/ Das Internet ist voll von solchen „How-To-Guides“ mit denen „Privilegierte“ in der Arbeit an sich selbst und ihrer Selbstreflexion angeleitet werden sollen, um schließlich „Allies“ werden zu können.
[54] Hier nur zwei der unzähligen im Internet kursierenden Listen von Unternehmen, die große Geldbeträge an #Black Lives Matter gespendet haben: https://www.cnet.com/how-to/companies-donating-black-lives-matter/ ; https://www.teenvogue.com/story/fashion-and-beauty-brands-black-lives-matter-movement-donations
[55] Siehe dazu Susemichel/Kastner, Identitätspolitiken, S. 116-118.
[56] Die Kampagne ist in Deutschland vermutlich stark von der iL beeinflusst: https://frauenstreik.org/
[57] https://time.com/5696943/diversity-business/
[58] Das englische Original des Zitats lautet: „We are not fighting white capitalism with black capitalism, but with socialism.“ Siehe dazu auch diese Rede von Fred Hampton über die Notwendigkeit der „working class unity“: https://www.youtube.com/watch?v=XJBNoLJSLS8







