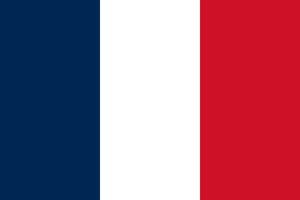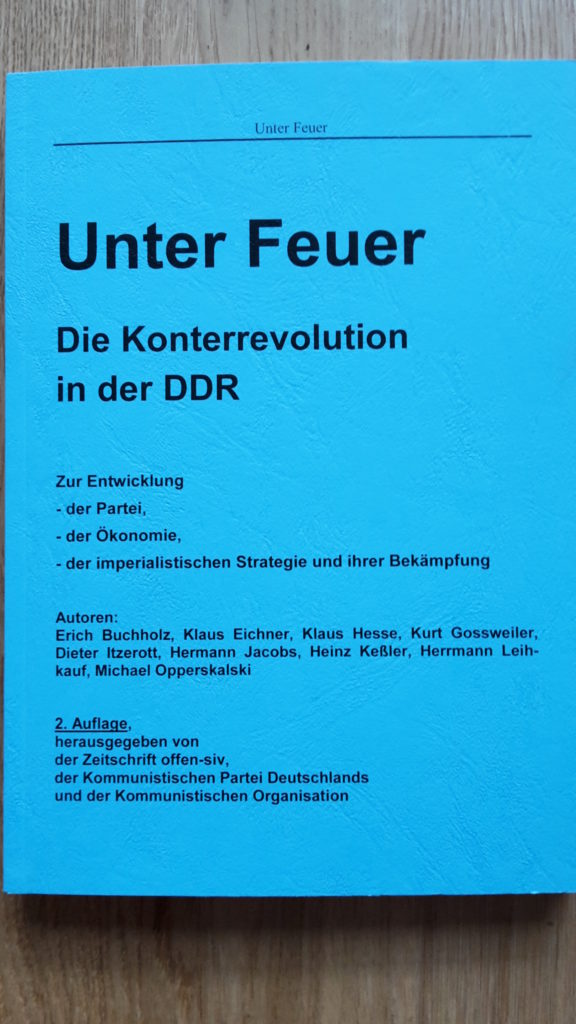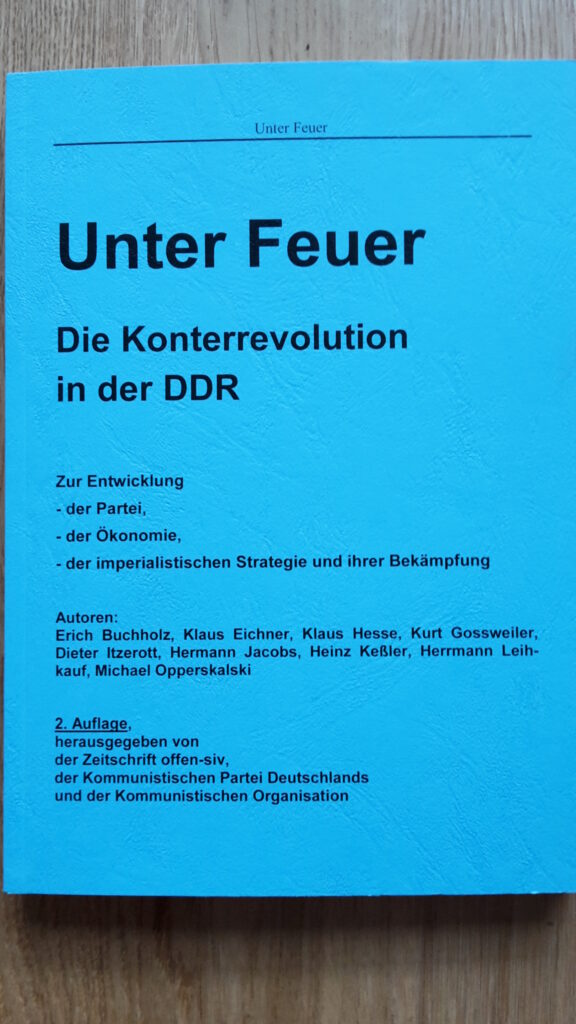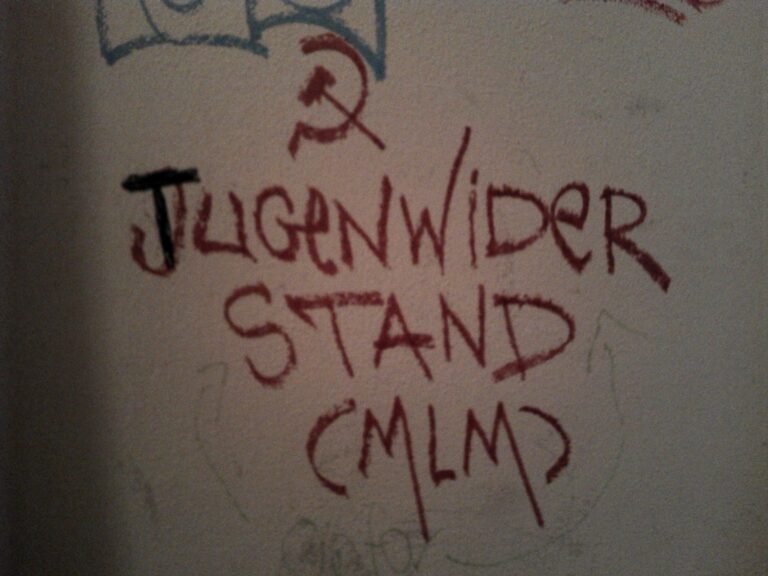Beitrag zur Diskussion um den Leitantrag – keine Positionierung der Kommunistischen Organisation (siehe Beschreibung der Diskussionstribüne)
Ein Gastbeitrag von Hans Christoph Stoodt
Noch einmal zur Frage von Inhalt und Form kommunistischer Massenpolitik heute
Die Diskussion zum Leitantrag (LA) der Kommunistischen Organisation (KO) nimmt Fahrt auf und zugleich werden Dissenspunkte deutlich. Das ist gut und notwendig. Als Teilnehmer der Diskussion möchte ich in aller Kürze zu Genossen Lennys Beitrag „Massenorganisation statt Bewegungsorientierung“ Stellung nehmen.
Ich sehe keinen Dissens in der Frage der Notwendigkeit des Aufbaus einer Kommunistischen Partei (KP), die sich in gesellschaftlichen Kämpfen die Rolle der politischen Führung des revolutionären Subjekts, der Arbeiterklasse, erkämpft, indem sie in der Lage ist, auf der Basis einer wissenschaftlichen Strategie in allen spontanen Auseinandersetzungen das strategische revolutionäre Ziel anzusteuern und schließlich zu erreichen.
Weiter sind wir uns darin einig, daß mit der Theorie und Praxis der Politik „breiter Bündnisse“ im bisherigen Stil Schluß gemacht werden muß: als Organisationenbündnisse „von oben“ auf unklarer politischer Grundlage insofern, als darin das revolutionärer Ziel kommunistischer Bündnisarbeit in aller Regel bis zur Unkenntlichkeit verschwindet. In dieser Frage besteht meines Wissens kein Dissens in der KO [1].
Lennys einzige Kritik des ansonsten offenbar von ihm völlig geteilten LA besteht in der Anmerkung, es gebe keine Auswertung der Erfahrungen mit Massenarbeit in der internationalen kommunistischen Bewegung. Das ist richtig. Aber es ist zugleich auch ein gutes Indiz dafür, daß die in meinem vorangegangenen Kommentar zum LA kritisierte Selbstbeschränkung des LA auf formale Fragen bei fast kompletter Ausblendung der inhaltlichen Ebene stimmt: eine solche Auswertung nämlich wäre unter Absehung eines ganzen Gebirges an inhaltlichen Themen nicht zu leisten (was allerdings auch nicht im Rahmen des LA für die nächste VV geschehen könnte).
Abgesehen von diesem Punkt meint Lenny, kommunistische Massenpolitik „ergänze und komplettiere“ den derzeit laufenden Klärungsprozess in der KO. Ähnlich wie in meiner ersten Äußerung zum Leitantrag bin ich der Meinung, daß eine solche Vorstellung die Dinge auf den Kopf zu stellen droht. Die Vorstellung, es gäbe zunächst einen parteiähnlichen Zusammenschluß mit sich herausbildenden richtigen Positionen, die dann in der hinzukommenden Massenarbeit „umgesetzt“ werden müssten oder könnten wirft die Frage auf, woher da die sich zusammenschließenden Revolutionäre kommen?
Dieses Thema ist so alt wie der Marxismus selbst. Schon ganz am Anfang seiner Wirksamkeit hat Marx in seiner Kritik an Feuerbach 1845 formuliert: „Die materialistische Lehre (damit meint Marx in diesem Zusammenhang die Position des von ihm kritisierten Feuerbach, HCS) von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergißt, daß die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muß. Sie muß daher die Gesellschaft in zwei Teile – von denen der eine über ihr erhaben ist – sondieren. Das Zusammenfallen des Ändern[s] der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefaßt und rationell verstanden werden.“ (MEW 3, 5f) – oder, umgekehrt ausgedrückt: revolutionäre Tätigkeit ist theoretisch nicht vorstellbar und praktisch nicht zu verwirklichen ohne eine gegenseitige Veränderung von revolutionärer Organisation / Partei und den Massen.
So sah es auch Lenin. In „Der linke Radikalismus“ formulierte er im Frühjahr 1920:
„Und da taucht vor allem die Frage auf: wodurch wird die Disziplin der revolutionären Partei des Proletariats aufrechterhalten? wodurch wird sie kontrolliert? wodurch gestärkt? Erstens durch das Klassenbewusstsein der proletarischen Avantgarde und ihre Ergebenheit für die Revolution, durch ihre Ausdauer, ihre Selbstaufopferung, ihren Heroismus. Zweitens durch ihre Fähigkeit, sich mit den breitesten Massen der Werktätigen, in erster Linie mit den proletarischen, aber auch mit den nichtproletarischen werktätigen Massen zu verbinden, sich ihnen anzunähern, ja, wenn man will, sich bis zu einem gewissen Grade mit ihnen zu verschmelzen. Drittens durch die Richtigkeit der politischen Führung, die von dieser Avantgarde verwirklicht wird, durch die Richtigkeit ihrer politischen Strategie und Taktik, unter der Bedingung,daß sich die breitesten Massen durch eigene Erfahrung von dieser Richtigkeit überzeugen. Ohne diese Bedingungen kann in einer revolutionären Partei, die wirklich fähig ist, die Partei der fortgeschrittenen Klasse zu sein, deren Aufgabe es ist, die Bourgeoisie zu stürzen und die ganze Gesellschaft umzugestalten, die Disziplin nicht verwirklicht werden. Ohne diese Bedingungen werden die Versuche, eine Disziplin zu schaffen, unweigerlich zu einer Fiktion, zu einer Phrase, zu einer Farce.“
LW 31, 9
Das „Zusammenfallen des Ändern[s] der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung“, das allein nach Marx als„revolutionäre Praxis“ aufgefasst werden kann, ohne sich zwei metaphysisch gegenüberstehende Größen „Partei“ und „Massen“ vorstellen zu müssen, wird von Lenin im Licht der Erfahrungen der Boschewiki breiter aufgefächert. Neben dem Heroismus und dem Klassenbewusstsein der Avantgarde sowie der Richtigkeit, der Wissenschaftlichkeit der politischen Strategie und Taktik tritt hier die Fähigkeit der Partei, „bis zu einem gewissen Grad mit den Massen zu verschmelzen“. Bemerkenswerterweise zieht Lenin diese Schlussfolgerung nicht nur in Hinblick auf die Verwirklichung des revolutionären Ziels, sondern, im vorliegenden Kontext, in Hinsicht auf die Rückwirkung einer richtigen Massenpolitik in der Partei selbst – nur, wenn die Partei ihre Massenpolitik wie von ihm dargelegt angehe, könne sie dauerhaft als disziplinierte Organisation wirken.
Es ist deutlich, wie sehr beide Zitate, das des frühen Marx und das des späten Lenin ineinander greifen und sich gegenseitig illustrieren.
Aktuell und konkret bedeutet das für die Anlage kommunistischer Massenpolitik in der BRD heute, dass jedes statische Gegenüberstellen von „Massen“ und „revolutionärer Organisation“, (hier: KO/KP) nicht nur das Ziel nicht zu erreichen, sondern auch in der eigenen Organisation die Disziplin zu gefährden droht.
In einer Situation, in der kommunistische Massen- und Bündnispolitik, wie Lenny völlig zu Recht kritisiert, über lange Zeit und immer mehr im opportunistischen „Mitschwimmen“ bestand, ist nachvollziehbar, dass zu dieser falschen Praxis hin ein besonders klarer Trennungsstrich gezogen werden soll. Aber dabei darf nicht das Kind mit dem Bad ausgeschüttet werden.
Wie schon in meiner ersten Stellungnahme dargelegt halte ich deshalb die inhaltliche Abstinenz des LA für falsch. Sie trennt in der Konkretion die richtig gemeinten formalen Vorstellungen kommunistischer Massenpolitik von ihrem aktuellen und konkreten inhaltlichen Gegenstand, also von den gesellschaftlichen Bewegungen der Massen hier und heute. Der LA hält es offenbar für erforderlich, über Massenpolitik „an sich“ diskutieren zu müssen. Das ist von der dargelegten Position Lenins meines Erachtens weit entfernt.
Welche Folgen kann das möglicherweise haben?
Zwei Beispiele:
Erstens – noch einmal die Klimafrage. Die Redaktion von kommunistische.org hat dankenswerterweise klargestellt, dass sich die KO mit einer kommunistischen Position zur Klima- und Umweltfrage ab Herbst 2019 eine Position erarbeiten will. Das ist offenkundig zu spät. Es besteht die Gefahr, den persönlichen, aktionsförmigen und argumentativen, damit aber auch politischen Kontakt zu einer Massenbewegung und den in ihr entstehenden Formen des Massenbewusstseins zu verlieren, den man, sozusagen „zu spät gekommen“, danach nur unter großen Glaubwürdigkeitsanstrengungen erreichen kann. Bei der durchaus schwierigen Position und Vorgeschichte kommunistischer Politik in der BRD, was die AKW- und die Ökologiefrage angeht, ist das etwas, was unbedingt vermieden werden sollte. Revolutionäre können bekanntlich zu spät kommen – mit der Möglichkeit dramatischer Folgen, wie die Diskussionen im ZK der Bolschewiki am Vorabend der Oktoberrevolution gezeigt haben.
Zudem ist die gegenwärtige Situation in der Klimabewegung gekennzeichnet durch eine wachsende Differenzierung von Positionen. Während ihr größter Teil sich – auch deshalb, weil marxistische und revolutionäre Kritik in ihren Reihen leider kaum vorhanden ist, sich in die Sackgasse parlamentarische Illusionen und einer völlig verfehlten Unterstützung der pro-imperialistischen Partei „DIE GRÜNEN“ begibt, kann angenommen werden, dass zB. in den bevorstehenden gemeinsamen Aktionen von FridaysForFuture“ (FFF) mit „EndeGelände“ oder, wie angepeilt, in Massenaktionen gegen die diesjährige IAA in Frankfurt auch bei vor allem jungen Aktivistinnen und Aktivisten in der Konfrontation mit dem Staat, an den man ständig appelliert, das Bewusstsein darüber wächst, welch ein Staat das ist, worin seine Funktion besteht, und was folglich von Parteien zu halten ist, die diesen Staat befürworten. Dieses „wachsende“, nämlich in der Aktion spontan entstehende Bewusstsein ist genau das, was Lenin mit einer „Keimform politischen Bewusstseins“ meinte.
Oder praktisch und konkret: spontanes Bewusstsein der Massen entsteht besonders schnell und besonders tief reichend aus in der Aktion geteilten Erlebnissen. Es kann zu politischem Bewusstsein werden, wenn es sich aufgrund der Anwesenheit von Revolutionären, die sich „in den Massen bewegen wie Fische im Wasser“, zu Klassenbewusstsein, zu revolutionärem Bewusstsein werden. Die Voraussetzung dafür aber ist die Präsenz der Revolutionäre, ihre Bereitschaft, im Mitmachen der möglicherweise auch nur halb oder noch weniger für richtig zu haltenden oder begründeten Aktionen gemeinsame Erlebnisse zu teilen und im Dialog politische Erfahrungen daraus zu formen.
In der aktuellen Lage ist ein relevanter Einfluss der KO auf die derzeit und vermutlich auf längere Zeit stärkste bundesweite Massenaktivität mit globalem Anschluss und mit einer tiefen Verwurzelung in der kapitalistischen Produktionsweise deshalb nicht möglich, weil ihre Mitglieder eben nicht „bis zu einem gewissen Grad mit den Massen verschmelzen“ wollen oder können. Der Grund dafür ist nicht eine falsche formale Struktur, sondern eine schmerzhaft fehlende politische Position, also eine inhaltliche Fehlstelle.
Zweitens
Wer Texte der KO liest, bemerkt schnell, dass sie geradezu demonstrativ nicht „gegendert“ sind. Der Hintergrund ist klar. Praktisch die gesamte „Linke“ in der BRD beschäftigt sich zu einem hohen Prozentsatz ihrer Energie mit Fragen von Bewusstseinsformen der imperialistischen Gesellschaft oder ihrer älteren Vorläufergesellschaften: Patriarchat und mangelnde Gleichberechtigung von Frauen, Genderfragen, Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, Islamhass, veganer Ernährung, diversity und so weiter. Jede und Jeder ist ein Sonderfall – die „linke“ Version von Thatchers reaktionärem Credo „There is no such thing as society. There are only individuals.“
In all den genannten Bereichen wird nicht nur (berechtigterweise) von einer relativen Selbständigkeit der gesellschaftlichen Bewusstseinsinhalte und ihrer Bedeutsamkeit von ihren Basis- also Klassenstrukturen ausgegangen. Grundlegende Erkenntnisse des historischen Materialismus sind hier weitgehend verschüttet und verachtet, selbst bei Menschen, die dem Wort nach angeben, sich als „Kommunisten“ zu fühlen. Für allzu viele verdrängt die Beschäftigung mit gender-, Rassismus- oder ähnlichen Fragen die Notwendigkeit eigener revolutionärer Praxis in den Klassenauseinandersetzungen der Zeit. Das Illusionäre und Desorientierende dieser Haltung besteht darin, dass heute eine Art queerer, antirassistischer, umweltbewusster Kapitalismus eine annehmbare Alternative für viele zu sein scheint – und die GRÜNEN als sein Vollstrecker (ich übergehe an dieser Stelle, dass selbst diese Illusion eines flauschig-grünen und „rechtstaatlichen“ deutschen Imperialismus 1000 Mal widerlegt ist, viele Male unter Mitwirkung der Grünen: beim Jugoslawien- und Afghanistankrieg, den Hartz-Gesetzen und so weiter). Die gesamte „postmoderne“ Linke stellt sich tendenziell gegen die Grunderkenntnis von Marx, dass das gesellschaftliche Bewusstsein notwendigerweise Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins ist, dessen Widersprüche aufgehoben werden müssen, um, die gesellschaftlichen Strukturen umwälzend wie oben aus der 3. Feuerbachthese zitiert, zugleich damit auch das gesellschaftliche und individuelle Bewusstsein zu revolutionieren.
Diese Haltung verbindet sich zudem auch noch meistens mit einer Position, die zwar irgendwie gegen den Kapitalismus ist, aber nicht für den Sozialismus/Kommunismus. Die Frage des Jenseits der kapitalistischen Barbarei soll „offen“ bleiben und im Prozess oder nach einer Umwälzung des Kapitalismus bestimmt werden – eine fatale Haltung, die sich leider nur allzugut mit der falschen Strategie einer Zwischenetappe zwischen Kapitalismus und Sozialismus verträgt [2].
Menschen, die sich so verhalten sind die richtigen Adressaten von Brechts „Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus“.
Auf diesem Hintergrund ist eine Ablehnung von postmodern-linken Ritualen wie dem zwanghaften Diskutieren und Streiten über die korrekte Form des Genderns („ArbeiterIn“, „Arbeiter_in“, „Arbeiter*in“, „Arbeiterinnen und Arbeiter“, „Arbeitende“) nur allzu verständlich.
Aber was ist unsere Alternative? Auch hier gibt es keine diskutierte Position, allerdings Hinweise in den Programmatischen Thesen wie auch in einer Stellungnahme der KO zum Internationalen Frauentag, die deutlich machen, wie eine kommunistische Position aussehen sollte. Dem steht die unausgesprochene und dennoch explizite Praxis von Texten der KO unverbunden gegenüber, in aller Regel nicht-inklusiv zu veröffentlichen.
Ich finde heute, dass das eine in der „einfachen Negation“ des Falschen, der PoMo-Linken, hängengebliebene Haltung ist. Es ist überhaupt nicht fortschrittlich, in Texten oder Diskussionsbeiträgen durchgehend das generische Maskulinum zu verwenden. So fehlgeleitet manche Diskussion zur Frage des Genderns auch ist: dass es heute Standard geworden ist, sich normalerweise wie auch immer inklusiv auszudrücken ist eine Selbstverständlichkeit, die nicht unterschritten werden sollte. Es beweist eher eine weiter bestehende, nun eben negative, Abhängigkeit von den Verrücktheiten mancher Diskussionen in diesem Bereich, diesen Standard absichtlich zu unterschreiten, quasi als Selbstverständnis-Marke.
Dabei geht es meines Erachtens am wenigsten um eine Frage des korrekten „wording“. Das wäre genau die „PoMo“-Fixierung auf den Ausdruck von Unterdrückung anstatt auf den Kampf gegen die Unterdrückung selbst. Es ist eine von vielen Fragen, an denen sich zeigt, wie wir, um Lenin anzuwenden, „bis zu einem gewissen Grade mit den Massen verschmelzen“ und dabei gleichzeitig die „Richtigkeit der politischen Führung“ immer wieder neu und vor den Augen der Massen erkämpfen können. Wir müssen in der Lage sein, unsere kommunistischen Positionen und Vorschläge in Situationen, die von postmodern-linken Stimmungen dominiert sind ebenso einzubringen, wie unter Arbeiterjugendlichen in der Siedlung, der Gewerkschaftsjugend, dem Sportverein oder der Schule. Die tatsächliche Fähigkeit „politischer Führung“ hängt nicht an korrekt gegenderten Texten, aber sie wird auch nicht, noch nicht einmal zum Teil, durch das demonstrative Nichtgendern erreicht. Das eine ist einfach genauso falsch wie das andere. Gerade, wenn es uns besonders wichtig ist, zuerst mit Arbeiterjugendlichen stabile soziale und politische Massenkontakte aufzubauen – es distanziert uns in keiner Weise von ihnen, wenn wir authentisch und als Kommunisten / Kommunistinnen dafür stehen: es ist nicht an sich fortschrittlich, inklusive und respektvolle Sprache doof zu finden oder chauvinistische / nationalistische Sprüche zu tolerieren. Das ist auch nicht ständig Thema, aber wir haben da eine Haltung: von „Genderwahnsinn“ reden die Feinde der Arbeiterklasse, also Eure und unsere Feinde, nicht wir. Wir stehen aus guten Gründen, die wir zur Diskussion stellen können, dafür ein, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte und Pflichten haben – von der Küche über die Erziehung bis in die bundesweite Politik. Es ist die kommunistische Haltung der Kader, die hier entscheidet, nicht der krückenhaft-korrekte Gebrauch gegenderter oder eben auch nicht-gegenderter Ausdrucksweise.
Die Fähigkeit zu kommunistischer Massenpolitik entscheidet sich an den richtigen Inhalten, gemessen sowohl an der aktuellen Lage als auch an der richtigen Strategie und Taktik; in der Haltung und Kompetenz der Kader und schließlich an den dafür jeweils angemessenen Strukturen. Kommunistische Prinzipienfestigkeit und die Fähigkeit, sich „wie ein Fisch im Wasser“ bewegen zu können, wo immer notwendig – das sind entscheidende Voraussetzungen erfolgreicher Massenpolitik.
Ich führe das aus, um darzulegen, dass nach meiner Ansicht die grundlegendsten organisations- und massenpolitischen Positionen nach Inhalt und Form nicht voneinander zu trennen sind. Diese Sichweise möchte ich gern erneut in die Debatte einbringen.
1 vgl. Hans Christoph Stoodt, Was ist ein breites Bündnis?; ders. Volksfront, breites Bündnis, antimonopolistische Demokratie? ; Thanassis Spanidis, Der VII. Weltkongress der Komintern und seine Folgen
2 vgl. dazu ausführlich und belegt: https://wurfbude.wordpress.com/2018/02/18/gegen-die-deutschen-zustaende-in-der-linken/