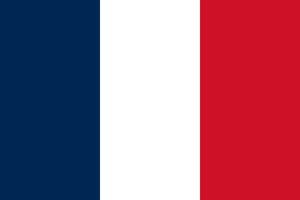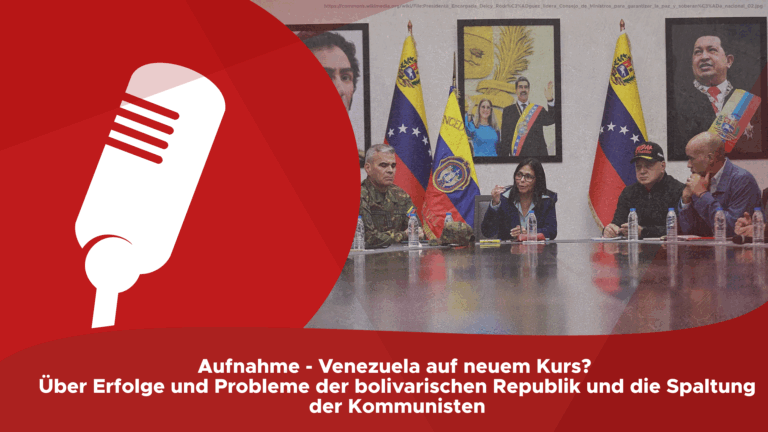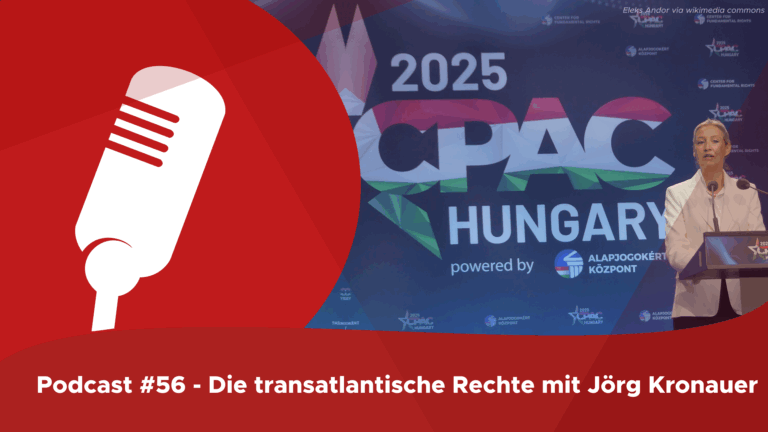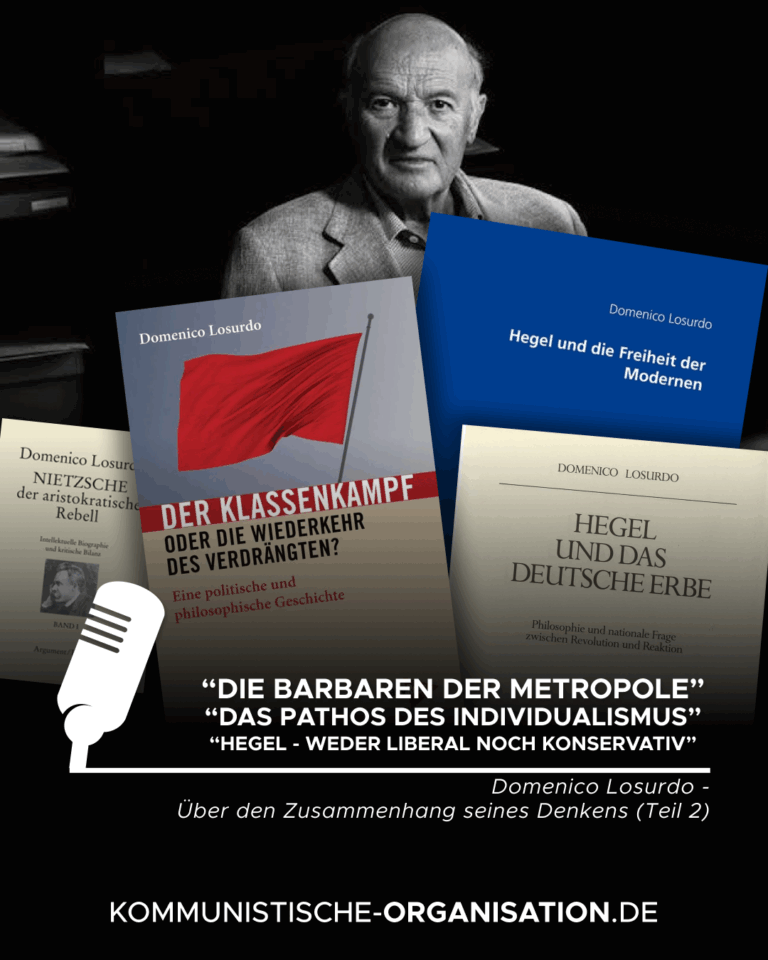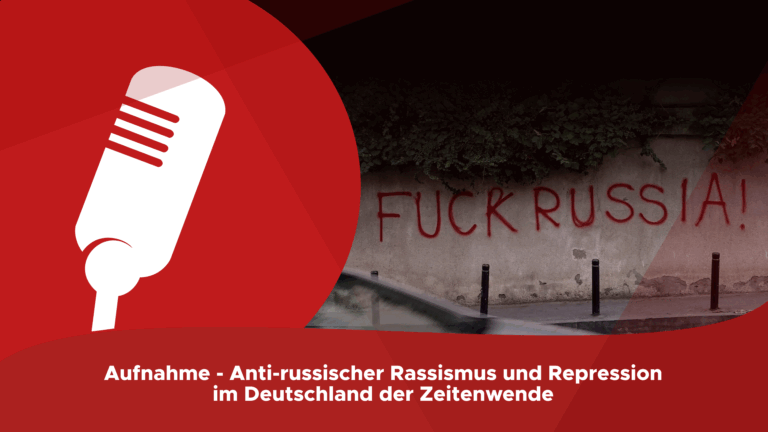Unsere Publikationsreihe zu „60 Jahre Afrikanisches Jahr“ wollen wir mit einem weiteren Text eines Schwarzen Revolutionärs abschließen, nämlich einem Vortrag von Walter Rodney. Der 1942 in Guyana geborene marxistische Historiker und Aktivist verfasste viele zentrale Schriften zur Geschichte des Kolonialismus und der Entwicklung Afrikas. Sein wohl bekanntestes Werk ist How Europe Underdeveloped Africa von 1972, das auch auf Deutsch in mehreren Übersetzungen vorliegt. Er lehrte, forschte und wirkte v. a. in Guyana, Jamaika, Tansania und den USA.
Der vorliegende Text ist eine Rede, die Rodney 1975 im Queens College in New York City hielt. Wir haben ihn aus dem Englischen übersetzt. Rodney geht der Frage nach, inwiefern der Marxismus überhaupt Gültigkeit und Wichtigkeit für Afrika und für die von Rassismus und Kolonialismus unterdrückten Schwarzen Massen insgesamt besitzt. Er argumentiert dafür, indem er herausstellt, dass es sich beim Marxismus primär um eine wissenschaftliche Methodik handelt, die dabei hilft, menschliche Gesellschaft im Allgemeinen und den die Welt beherrschenden Kapitalismus im Konkreten zu begreifen. Unter Bezugnahme u. a. auf Amílcar Cabral und Kwame Nkrumah legt er zudem Beispiele dar, inwiefern die Aneignung marxistischer Erkenntnisse dem Befreiungskampf der afrikanischen Völker bereits gedient hat – und wie das Ignorieren dieser Erkenntnisse zu bitteren Niederlagen führt.
Rodneys Text ist nicht nur von Interesse, weil er überzeugend für die Anwendung des Wissenschaftlichen Sozialismus auf Afrika argumentiert. Vielmehr bricht er, unter Verweis auf Russland, China, Kuba, Vietnam, Korea, Guinea-Bissau und Mosambik, eine Lanze für die universelle Gültigkeit des Marxismus insgesamt – und für das Festhalten an den wissenschaftlichen Prinzipien des Wissenschaftlichen Sozialismus.
Wie auch bei den anderen in dieser Reihe veröffentlichen Texten hoffen wir, zum weiteren Lesen und Studieren der hier vorgestellten Autoren anzuregen. Abschließend wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir aus Zeitmangel leider viele wichtige afrikanische marxistische Theoretiker nicht übersetzen konnten. Wir wollen aber auch diesbezüglich dazu anhalten, diesen wichtigen Arbeiten selbstständig nachzugehen. Unsere Bewegung ist global und hat viele großartige Köpfe hervorgebracht. Es ist an uns, von ihnen zu lernen, um die Welt zu verändern.
Redaktion der KO
Marxismus und afrikanische Befreiung
Zunächst einmal müssen wir den Hintergrund für diese Art von Debatte verstehen. Wenn man gebeten wird, über die Relevanz des Marxismus für Afrika in dieser besonderen Zeit zu sprechen, wird man gebeten, sich an einer historischen Debatte zu beteiligen, einer Debatte, die in diesem Land, insbesondere unter der schwarzen Bevölkerung, seit langem geführt wird. Es ist eine Debatte, die im letzten Jahr an Intensität zugenommen hat und die nach meinen Beobachtungen an vielen Orten in diesem Land geführt wird.
Manchmal tritt sie in Form der sogenannten Nationalisten gegen die Marxisten auf, manchmal in Form derjenigen, die behaupten, eine Klassenposition zu vertreten, im Gegensatz zu denen, die behaupten, eine „Rassen“position zu vertreten. Daher wäre es uns nicht möglich, in einer einzigen Sitzung auf alle Verzweigungen dieser Debatte einzugehen, aber sie bildet den Hintergrund für unsere Diskussion.
Es ist eine wichtige Debatte. Es ist eine wichtige Tatsache, dass solche Fragen heute in diesem Land diskutiert werden, genauso wie sie in Afrika, Asien, Lateinamerika und in vielen Teilen der metropolitanen Welt in Westeuropa und Japan diskutiert werden. Denn die Verbreitung und Intensität dieser Debatte spiegelt derzeit die Krise der kapitalistisch-imperialistischen Produktionsweise wider. Ideen und Diskussionen fallen nicht einfach vom Himmel. Es handelt sich nicht einfach um eine Verschwörung bestimmter Personen, um andere in eine sinnlose Debatte zu verwickeln.
Unabhängig vom Ausgang der Debatte und unabhängig von der Haltung der verschiedenen Teilnehmer ist die Tatsache, dass diese Debatte stattfindet, repräsentativ für die Krise des Kapitalismus und Imperialismus heute. Und je tiefer die Krise wird, desto schwieriger wird es für die Menschen, die alten Denkweisen zu akzeptieren, die das zusammenbrechende System rationalisieren. Daher ist es notwendig, nach neuen Wegen zu suchen, und ganz klar stellt sich der Marxismus, der wissenschaftliche Sozialismus, als eine der nächstliegenden Optionen dar.
Die Frage ist für Afrika oder die schwarzen Menschen insgesamt nicht neu – das ist vielleicht wichtig zu verstehen. Viele von uns haben bereits zuvor die Frage nach der Relevanz des Marxismus für dieses oder jenes aufgeworfen. Seine Relevanz für Europa; viele europäische Intellektuelle diskutierten seine Relevanz für ihre eigene Gesellschaft. Seine Relevanz für Asien wurde von Asiaten diskutiert. Seine Relevanz für Lateinamerika wurde von Lateinamerikanern diskutiert. Seit langem diskutieren Einzelpersonen über die Relevanz des Marxismus für ihre eigene Zeit. War er für das 19. Jahrhundert relevant? Wenn ja, war er dann auch noch für das 20. Jahrhundert relevant? Man kann über seine Relevanz für einen bestimmten Aspekt der Kultur einer Gesellschaft oder für das Recht oder die Kultur einer Gesellschaft insgesamt diskutieren.
All dies sind Fragen, die bereits diskutiert wurden, und wir sollten ein gewisses Geschichtsbewusstsein mitbringen, wenn wir uns heute mit dieser Frage beschäftigen, denn mit diesem Geschichtsbewusstsein können wir fragen, warum die Frage nach der Relevanz des Marxismus für die Gesellschaft immer wieder auftaucht. Und als sehr kurze Antwort würde ich sagen, dass allen Anwendungen dieser Frage vor allem eines gemeinsam ist: eine Situation des Kampfes, eine Situation, in der die Menschen mit der vorherrschenden Art der Wahrnehmung der Realität unzufrieden sind.
An diesem Punkt stellen sie die Frage nach der Relevanz des Marxismus.
Darüber hinaus ist die zweite Bedingung, dass Menschen diese Frage aufgrund ihres eigenen bürgerlichen Denkrahmens stellen. Man beginnt innerhalb der vorherrschenden Denkweise, die den Kapitalismus unterstützt und die wir als bürgerlichen Wahrnehmungsrahmen bezeichnen. Und weil man so beginnt, wird es notwendig, die Frage nach der Relevanz des Marxismus zu stellen.
Wenn man fortgeschritten ist, ist es wahrscheinlich zutreffender, die Frage nach der Relevanz des bürgerlichen Denkens zu stellen, denn dann wäre der Spieß umgedreht!
Aber zunächst einmal ist es wahr, dass, so sehr die Bourgeoisie auch widerspricht, es einen gemeinsamen Nenner gibt, der alle bürgerlichen Denkweisen verbindet: Sie machen gemeinsame Sache, indem sie die Relevanz, die Logik usw. des marxistischen Denkens in Frage stellen. Und deshalb passen wir in gewisser Weise leider auch in dieses Schema und Muster, wenn wir diese Frage stellen. Auch wir sind in gewisser Weise noch mehr oder weniger in das Schema des bürgerlichen Denkens eingebettet, und aus diesem Schema heraus fragen wir mit großer Zurückhaltung und Unsicherheit: Was ist „die Relevanz des Marxismus”?
Das gilt insbesondere für unseren Teil der Welt, also den englischsprachigen Teil der Welt, denn die angloamerikanische Tradition ist philosophisch gesehen von einer intensiven Feindseligkeit gegenüber dem Marxismus geprägt, einer Feindseligkeit, die sich auf eigentümliche Weise manifestiert. Sie manifestiert sich darin, dass man versucht, sich sogar vom Studium des Marxismus zu distanzieren. Wenn man sich die kontinentale Tradition in Europa ansieht, stellt man fest, dass dies dort nicht der Fall ist. Französische, deutsche und belgische Intellektuelle, unabhängig von ihrer Perspektive, verstehen die Bedeutung des Marxismus. Sie studieren ihn, sie setzen sich mit ihm auseinander, sie verstehen das Gedankengut, das als Marxismus bezeichnet wird, und sie beziehen Stellung zu diesem Gedankengut.
In der englischen Tradition, die auch in diesen Teil der Welt, in die Karibik und in viele Teile Afrikas übernommen wurde, ist es Mode, jegliche Kenntnis des Marxismus zu leugnen. Es ist in Mode, sich seiner Unwissenheit zu rühmen und zu sagen, dass man gegen den Marxismus ist. Wenn man darauf angesprochen wird, sagt man: Aber warum sollte man ihn lesen? Er ist offensichtlich absurd.
Man weiß also, dass er absurd ist, ohne ihn zu lesen, und man liest ihn nicht, weil man weiß, dass er absurd ist, und deshalb rühmt man sich seiner Unwissenheit über diese Position.
Es ist ziemlich schwierig, sich ernsthaft mit der Frage nach der Relevanz des Marxismus auseinanderzusetzen, wenn man nicht zumindest bereit ist, sich mit diesem umfangreichen Gedankengut auseinanderzusetzen, denn es handelt sich um eine gewaltige Menge an Literatur und Analysen, und von außen betrachtet ist das äußerst schwierig.
Ich würde sogar sagen, dass es sinnlos ist, von außen betrachtet, ohne jemals versucht zu haben, sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, nach seiner Relevanz zu fragen. Es ist fast eine unbeantwortbare Frage, und ich denke in aller Bescheidenheit, dass für diejenigen von uns, die aus einem bestimmten Umfeld kommen (und wir alle kommen aus diesem Umfeld), eines der ersten Dinge, die wir tun müssen, darin besteht, uns mit den verschiedenen intellektuellen Traditionen vertraut zu machen, und wenn wir uns mit ihnen vertraut gemacht haben, sind wir besser in der Lage, die Relevanz oder Irrelevanz des Marxismus zu beurteilen, je nach Fall.
Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Diskussion versuchen zu ergründen, ob die Variablen Zeit und Ort relevant sind, oder, anders ausgedrückt, ob die Variablen Zeit und Ort einen Einfluss darauf haben, ob der Marxismus relevant ist oder nicht. In gewisser Weise müssten wir fast davon ausgehen, dass er für den Ort, an dem er entstanden ist, nämlich Westeuropa, gültig ist. Wir haben nicht die Zeit, uns damit im Detail zu befassen. Aber wir können dann fragen, vorausgesetzt, dass der Marxismus für Westeuropa relevant, bedeutungsvoll und anwendbar ist oder im 19. Jahrhundert war, inwieweit sich seine Gültigkeit geografisch erstreckt. Inwieweit erstreckt sich seine Gültigkeit über die Zeit?
Das sind die beiden Variablen, Zeit und Ort, die sich in historische Umstände, Zeit – und Kultur, also den Ort, und die sozialen und kulturellen Bedingungen, die an jedem bestimmten Ort herrschen, übersetzen lassen. Um es genauer zu sagen: Schwarze Menschen, zweifellos wohlmeinende schwarze Menschen, stellen die Frage, ob eine Ideologie, die historisch im 19. Jahrhundert innerhalb der Kultur Westeuropas entstanden ist, heute, im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts, noch Gültigkeit für einen anderen Teil der Welt hat, nämlich Afrika oder die Karibik oder die schwarzen Menschen in diesem Land; ob sie für andere Gesellschaften zu anderen Zeiten gültig ist. Und das ist die Art von Formulierung, die ich zur Diskussion stellen möchte.
Die Methodik des Marxismus
Ich möchte zwei fundamentale Gründe nennen, warum ich glaube, dass das marxistische Denken, das wissenschaftlich-sozialistische Denken, auf verschiedenen Ebenen, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten existieren und sein Potenzial als Werkzeug behält, als eine Reihe von Konzepten, die die Menschen begreifen sollten.
Der erste Grund ist, den Marxismus als Methodik zu betrachten, denn eine Methodik ist per Definition unabhängig von Zeit und Ort. Man kann die Methodik zu jeder Zeit und an jedem Ort anwenden. Natürlich kann man unterschiedliche Ergebnisse erzielen, aber die Methodik selbst ist unabhängig von Zeit und Ort.
Um eine eher verkürzte Darstellung des Marxismus zu geben, die zwangsläufig zu stark vereinfacht ist, aber angesichts der begrenzten Zeit dennoch notwendig ist, würde ich sagen, dass eine der eigentlichen Grundlagen des marxistischen Denkens darin besteht, dass es von einer Perspektive der Beziehung des Menschen zur materiellen Welt ausgeht; und dass sich der Marxismus, als er historisch entstand, bewusst von allen anderen Wahrnehmungsweisen, die von Ideen, Konzepten und Worten ausgingen, distanzierte und sich ihnen entgegenstellte; und sich in den materiellen Bedingungen und den sozialen Beziehungen in der Gesellschaft verwurzelt hat.
Das ist der Unterschied, mit dem ich beginnen möchte. Eine Methodik, die ihre Analyse jeder Gesellschaft, jeder Situation damit beginnt, dass sie nach den Beziehungen sucht, die in der Produktion zwischen den Menschen entstehen. Daraus ergibt sich eine ganze Reihe von Konsequenzen: Das Bewusstsein des Menschen wird durch sein Eingreifen in die Natur geformt; die Natur selbst wird durch ihre Interaktion mit der Arbeit des Menschen humanisiert; und die Arbeit des Menschen bringt einen ständigen Strom von Technologien hervor, die wiederum andere soziale Veränderungen hervorrufen.
Das ist also der Kern der wissenschaftlich-sozialistischen Wahrnehmung. Eine Methodik, die sich mit den Beziehungen des Menschen im Produktionsprozess befasst, unter der meiner Meinung nach berechtigten Annahme, dass die Produktion nicht nur die Grundlage der Existenz des Menschen ist, sondern auch die Grundlage für die Definition des Menschen als ein besonderes Wesen mit einem bestimmten Bewusstsein.
Nur durch die Produktion unterscheidet sich die Menschheit von den übrigen Primaten und dem übrigen Leben.
Wogegen wendet sich der Marxismus? Er wendet sich gegen eine Reihe von Hypothesen, eine Reihe von Weltanschauungen, die mit Worten und Begriffen beginnen. Denjenigen, die mit Marx‘ eigener Entwicklung vertraut sind, ist bekannt, dass er zunächst Hegel betrachtete, einen sehr plausiblen und scharfsinnigen Analytiker des 19. Jahrhunderts, der nach Marx‘ eigener Einschätzung eine völlig idealistische Position vertrat, die Ideen in den Mittelpunkt des Universums stellte und die materielle Welt als praktisch aus diesen Ideen abgeleitet betrachtete.
Als ich darüber nachdachte, kam ich zu dem Schluss, dass ich mich nicht mit Hegel befassen würde. Ich würde über Hegel hinausgehen. Für eine klassische Darstellung der idealistischen Weltanschauung nehme ich das Neue Testament, das Johannesevangelium, wo es heißt: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott.“ Das ist die klassische Darstellung der idealistischen Position. Alles andere ergibt sich daraus: Das Wort war Gott!
Wir gehen jedoch davon aus, dass das Wort selbst eine Emanation der Aktivitäten der Menschen ist, wenn sie versuchen, miteinander zu kommunizieren, wenn sie aus der Produktion heraus soziale Beziehungen entwickeln, und dass wir uns nicht von Worten verwirren lassen sollten. Natürlich müssen wir uns mit Begriffen und der Kraft des Bewusstseins auseinandersetzen, die eine sehr mächtige Kraft ist und die sogar einige Marxisten unterschätzt haben.
Nun versuchte Marx, diesen breiten methodologischen Rahmen auf Westeuropa anzuwenden. Er wandte ihn auf eine Reihe von Gesellschaften an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten an, konzentrierte seine Aufmerksamkeit jedoch auf Westeuropa. Wenn man die von Marx und Engels verfassten Schriften untersucht, stellt man fest, dass sie zwar über Sklaverei, über die kommunale Gesellschaft und über den Feudalismus sprechen, sich aber im Großen und Ganzen auf den Kapitalismus konzentrieren. Sie sprechen kaum über den Sozialismus.
Marx‘ großer Beitrag war seine fantastische Kritik an einer bestehenden Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft. Wie ist sie in einem bestimmten Teil der Welt entstanden? Der Großteil ihrer Literatur befasst sich mit dieser Frage.
Aber wie ich bereits sagte, als ich mich auf die vorkapitalistische Gesellschaft, insbesondere den Feudalismus, bezog, sprachen sie auch über andere Teile der Welt. Gelegentlich erwähnt Marx die asiatische Produktionsweise. Gelegentlich befasste er sich mit Daten über die Vereinigten Staaten. Er hatte also eine gewisse geografische und zeitliche Spannweite.
Aber im Vergleich zum Großteil seines Werks war dies so minimal, dass viele Menschen Marx‘ Methode und seine Schlussfolgerungen als ein und dasselbe angesehen haben – dass der Marxismus nicht nur eine bestimmte Methodik ist, die auf Westeuropa angewendet wird, sondern selbst eine Ideologie über Westeuropa, über den Kapitalismus im 19. Jahrhundert, und diese Grenzen nicht überschreiten kann, obwohl Marx eindeutig die Arbeit tat, die er tun musste. Er betrachtete seine eigene Gesellschaft, er tat dies unter äußerst widrigen Umständen, er tat dies, indem er sich das Wissen der Bourgeoisie aneignete und es in den Dienst des Wandels und der Revolution stellte.
Ich würde daher sagen, dass die Methode unabhängig von Zeit und Ort war. Sie ist bei Marx implizit enthalten und wird in der postmarxistischen Entwicklung explizit, wobei „marxistisch” im wörtlichen Sinne des Lebens von Marx selbst verwendet wird. Nach Marx‘ Tod kam es zur Weiterentwicklung des wissenschaftlichen sozialistischen Gedankenguts, wobei andere Personen erkannten, dass die Methodik auf verschiedene Zeiten und Orte angewendet werden kann und muss.
Wenn wir unsere Geschichte wieder in sehr verkürzter Form darstellen, können wir uns Lenin ansehen, seine Anwendung der marxistischen Theorie auf die russische Gesellschaft. Das ist einer seiner wichtigsten Beiträge. Die erste große These des jungen Lenin war die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. Er musste sich mit seiner eigenen Gesellschaft auseinandersetzen. Er musste diese Formulierungen aus dem spezifischen kulturellen und historischen Kontext Westeuropas herausnehmen, sie auf seine eigene Gesellschaft anwenden und auf Osteuropa, auf Russland, das sich anders entwickelte, schauen. Das tat er auch.
Gleichzeitig musste er die zeitliche Dimension berücksichtigen, dass Marx im 19. Jahrhundert über das schrieb, was heute als die klassische Periode des Kapitalismus bezeichnet wird, die unternehmerische Version des Kapitalismus, und dass diese im späten 19. Jahrhundert dem Monopolkapitalismus gewichen war. Sie war dem Imperialismus gewichen. Lenin musste sich also mit dieser Methode auseinandersetzen, indem er sie auf eine neue zeitliche Dimension anwandte. So schrieb er über den Kapitalismus in seiner imperialistischen Phase.
Das sind also die beiden Varianten, die hier zum Tragen kommen: die Ideologie und die Methodik (wir bleiben vorerst bei der Methodik), die auf verschiedene Gesellschaften zu verschiedenen Zeiten angewendet werden. Nachdem ich dies für Lenin dargelegt habe, hoffe ich, dass es für viele Menschen klar wird: Mao Zedong wandte sie auf die chinesische Gesellschaft an, die sich von der russischen Gesellschaft unterschied. Er verstand die inneren Dynamiken der chinesischen Gesellschaft und setzte sich mit der Frage der Bauernschaft auf eine andere und tiefgreifendere Weise auseinander als alle Autoren vor ihm, weil dies der Natur der chinesischen Gesellschaft entsprach und er sich damit befasst hatte.
Und schließlich, für unsere Zwecke, das wichtigste Beispiel, das Beispiel von Amilcar Cabral, weil er sich mit Afrika befasste. Cabral begann in einem seiner Essays, der, wenn ich mich recht erinnere, den Titel Theorie als Waffe trug und zu seinen wichtigsten Essays zählt, damit, dass er klarstellte, das Beste, was er tun könne, sei, zu der grundlegenden Methodik von Marx und Engels zurückzukehren. Aber Cabral konnte nicht damit beginnen, die Geschichte Guinea-Bissaus zu analysieren, indem er beispielsweise sagte: „Ich werde nach Klassen suchen”. Er sagte: „Wenn ich das sage, leugne ich, dass mein Volk eine Geschichte hat, weil ich in der Entstehungsgeschichte meines Volkes über einen langen Zeitraum keine Klassen wahrnehme.“
Dann verwies er auf die klassische Aussage von Marx und Engels, dass „die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften die Geschichte von Klassenkämpfen ist“, zu der Engels eine Anmerkung hinzugefügt hatte, dass mit „aller Geschichte“ „die gesamte bisher aufgezeichnete Geschichte“ gemeint sei. Zufälligerweise ist die Geschichte des Volkes von Guinea-Bissau nicht aufgezeichnet worden, und Cabral sagt: „Ich möchte diese Geschichte aufzeichnen. Wir werden die marxistische Methode anwenden. Wir werden uns nicht an das Konzept binden, das historisch in Westeuropa entstanden ist, als Marx diese Gesellschaft studierte.“
Marx verwendet diese Methode und erkannte die Entwicklung der Klassen und das Phänomen der Klassen selbst als einen wichtigen Bestimmungsfaktor, den wichtigsten Bestimmungsfaktor in der westeuropäischen Geschichte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Cabral sagt, wir werden am Anfang beginnen. Wir werden uns zunächst nicht einmal mit Klassen befassen. Wir werden einfach die Menschen im Produktionsprozess betrachten. Wir werden uns die Produktionsweisen in der Geschichte Guineas ansehen und wir werden sehen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Ohne großes Aufsehen zeigte er also die Relevanz dieser Methodik für die afrikanische Gesellschaft auf.
Wenn und sobald in der Geschichte Guinea-Bissaus der Aspekt der Klassen historische Bedeutung zu haben schien, dann befasste sich Cabral damit. Bis dahin hielt er sich einfach an die Grundlage der marxistischen Methodik, die darin bestand, die Menschen in Guinea im Produktionsprozess zu betrachten, die verschiedenen Produktionsweisen, sozialen Formationen, kulturellen Formationen, die historisch entstanden waren, und die Richtung, in die sich die Gesellschaft entwickelte.
In vielerlei Hinsicht haben wir heute, wenn wir die Frage nach der Relevanz des Marxismus für schwarze Menschen stellen, sozusagen bereits eine Minderheitsposition erreicht. Viele der an der Debatte Beteiligten stellen die Debatte so dar, als sei der Marxismus ein europäisches Phänomen und schwarze Menschen, die darauf reagieren, müssten zwangsläufig entfremdet sein, weil die rassifizierte Entfremdung in die Diskussion einfließen müsse.
Sie scheinen nicht zu berücksichtigen, dass diese Methodik und Ideologie bereits in weiten Teilen der Welt, die nicht zu Europa gehören, genutzt, verinnerlicht und domestiziert worden sind.
Dass es bereits die Ideologie von achthundert Millionen Chinesen ist; dass es bereits die Ideologie ist, die das vietnamesische Volk zu einem erfolgreichen Kampf und dem Sieg über den Imperialismus geführt hat. Dass es bereits die Ideologie ist, die es Nordkorea ermöglicht, sich von einem rückständigen, quasi-feudalen, quasi-kolonialen Terrain in eine unabhängige Industriemacht zu verwandeln. Dass es bereits die Ideologie ist, die auf dem lateinamerikanischen Kontinent übernommen wurde und als Grundlage für die Entwicklung in der Republik Kuba dient. Dass es bereits die Ideologie ist, die von Cabral verwendet wurde, die von Samora Machel verwendet wurde, die auf dem afrikanischen Kontinent selbst verwendet wird, um den Kampf und den Aufbau einer neuen Gesellschaft zu unterstreichen und zu betonen.
Es kann daher nicht als europäisches Phänomen bezeichnet werden, und die Beweislast liegt sicherlich bei denen, die argumentieren, dass dieses Phänomen, das bereits selbst universalisiert wurde, für einige Schwarze irgendwie nicht anwendbar ist. Die Beweislast liegt meiner Meinung nach bei diesen Personen, die einen Grund, vielleicht einen genetischen, dafür aufzeigen müssen, warum die Gene der Schwarzen diese ideologische Position ablehnen.
Wenn wir das Konzept der Relevanz untersuchen und versuchen, es in den Mittelpunkt zu stellen oder dort zu halten, müssen wir uns Fragen zur Gegenwart stellen. In welcher Art von Gesellschaft leben wir heute? In welcher Art von Gesellschaften leben Schwarze heute in verschiedenen Teilen der Welt? Und obwohl wir als Schwarze in diesem Land, in der Karibik und in verschiedenen Teilen Afrikas natürlich unsere eigenen unabhängigen historischen Erfahrungen haben, ist eine der zentralen Tatsachen, dass wir alle auf die eine oder andere Weise Teil des kapitalistischen Produktionssystems sind.
Die Gesellschaft, über die Marx schrieb, dominierte Afrika und die Amerikas durch einen Prozess der Ausbreitung in der Ära des Merkantilismus, also in der Zeit, in der der Kapitalismus zur Reife heranwuchs. Sie dominierte diese Teile der Welt. Sie schuf die Sklavengesellschaft in Amerika.
Nach der Sklavenära war der Kapitalismus, der noch mächtiger geworden war, in der Lage, die ganze Welt in ein globales Produktionsnetzwerk zu integrieren, das seinen Ursprung in Westeuropa und Nordamerika hatte, ein System mit einem oder mehreren metropolitanen Zentren und einer separaten Gruppe von Peripherien, Kolonien und Halbkolonien.
So sind wir alle historisch gesehen in das kapitalistische Produktionssystem integriert worden, und das ist eine weitere Dimension der Relevanz des Marxismus.
Auch ohne die Übertragung auf Zeit und Ort scheint es mir, dass wir, wenn wir Teil der kapitalistisch-imperialistischen Welt geworden sind, es uns selbst schuldig sind, uns mit diesem kapitalistischen System auseinanderzusetzen, es zu verfolgen, zu verstehen und hoffentlich auch zu kritisieren und anzupassen, denn genau darum geht es im Wesentlichen in Marx‘ Schriften. Er kritisierte dieses kapitalistische System. Er tat dies wirksamer als jeder andere bürgerliche Schriftsteller, und wenn wir die Welt, in der wir leben, verstehen wollen, die vom Kapitalismus dominierte Welt, dann müssen wir das Zentrum dieses Systems, den Motor innerhalb dieses Systems, die Arten der Ausbeutung, die innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise zu finden sind, verstehen. Das ist also ein weiterer Faktor.
Der Marxismus als revolutionäre Ideologie
Meine zweite Überlegung nach der Methodik (und ich hatte ursprünglich vorgeschlagen, dass es zwei grundlegende Dinge gibt, von denen eines die Methodik ist) ist, den Marxismus als revolutionäre Ideologie und als Klassenideologie zu betrachten.
In Klassengesellschaften sind alle Ideologien Klassenideologien. Alle Ideologien leiten sich von einer bestimmten Klasse ab und unterstützen diese. Praktisch gesehen sind wir also in einer kapitalistischen Gesellschaft aufgewachsen, und die bürgerliche Ideologie ist in unserer Gesellschaft vorherrschend. Die Institutionen, in denen wir funktionieren, wurden geschaffen, um Ideen als Waren zu produzieren, Ideen, die das kapitalistische System stützen.
Nun würde ich, wie Marx selbst, historisch gesehen behaupten, dass die Ideen, die wir als wissenschaftlichen Sozialismus bezeichnen, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft entstanden sind, um die Interessen der Produzenten in dieser Gesellschaft zu vertreten, um die Interessen der Ausgebeuteten und Enteigneten zu vertreten, um die Interessen der Unterdrückten und kulturell Entfremdeten zu vertreten; und wir müssen verstehen, dass von den beiden großen Ideenkomplexen, die uns vorliegen, dem Idealismus und dem Materialismus, der bürgerlichen Philosophie und der marxistischen Philosophie, jeder für eine bestimmte Klasse repräsentativ ist.
Ich habe nicht die Zeit, auf alle historischen Wurzeln der Entstehung des Sozialismus einzugehen, aber kurz gesagt wurden im 19. Jahrhundert mit dem Aufstieg der kapitalistischen Gesellschaft die Voraussetzungen für die Entwicklung sozialistischer Ideen geschaffen. Aus den vielfältigen und unsystematischen sozialistischen Ideen gelang es Marx, eine klare und systematische Theorie zu formulieren – den wissenschaftlichen Sozialismus. Sie hatte eine bestimmte Klassenbasis, und weil sie diese bestimmte Klassenbasis hatte, war sie revolutionär. Sie strebte danach, die Verhältnisse in der Gesellschaft zu verändern und umzustürzen.
Die bürgerliche Ideologie ist notwendigerweise Status quo erhaltend. Sie strebt danach, das bestehende Produktionssystem, die daraus resultierenden Verhältnisse, die aus einem bestimmten Produktionssystem hervorgehen, zu bewahren und zu stützen.
Eine wissenschaftlich-sozialistische Position ist und bleibt revolutionär, weil sie bewusst darauf abzielt, dieses Produktionssystem und die daraus resultierenden politischen Verhältnisse zu untergraben. Das meine ich mit revolutionär.
Von Zeit zu Zeit tauchen Marxisten auf, die versuchen, den revolutionären Gehalt des Marxismus zu leugnen oder zu entleeren. Das ist wahr. Es gibt Marxisten, die zu legalen oder Sesselmarxisten geworden sind, die den Marxismus lediglich als eine weitere Variante der Philosophie betrachten und ihn auf sehr eklektische Weise behandeln, als ob man sich aus dem Marxismus ebenso frei bedienen könnte wie aus dem griechischen Denken und dessen Entsprechungen, ohne auf die Klassenbasis zu achten und ohne zu prüfen, ob eine Ideologie den Status quo unterstützt oder nicht.
Dennoch können wir den Marxismus und den wissenschaftlichen Sozialismus im Großen und Ganzen als subversiv und als Gegenpol zur Aufrechterhaltung des Produktionssystems, in dem wir leben, betrachten. Denn Ideen, ich wiederhole es, schweben nicht im Himmel, sie schweben nicht in der Atmosphäre, sie stehen in Zusammenhang mit konkreten Produktionsverhältnissen. Bürgerliche Ideen leiten sich aus bürgerlichen Produktionsverhältnissen ab. Sie dienen dazu, diese Produktionsverhältnisse zu bewahren und aufrechtzuerhalten. Sozialistische Ideen leiten sich aus derselben Produktion ab, aber sie leiten sich aus einem anderen Klasseninteresse ab, und ihr Ziel ist es, dieses Produktionssystem zu stürzen.
Afrika und der wissenschaftliche Sozialismus
Auch hier möchte ich wieder darauf hinweisen, dass die afrikanischen Völker, wie auch andere Völker der Dritten Welt, ein großes Interesse am wissenschaftlichen Sozialismus haben, weil er ihnen als theoretische Waffe dient. Er bietet sich ihnen auf der Ebene der Ideen als ein Werkzeug an, das zum Abbau der kapitalistischen imperialistischen Struktur genutzt werden kann. Das ist sein Anliegen.
Ich werde versuchen, so gut ich kann, auf bestimmte Fragen einzugehen, die von Personen gestellt werden, die vielleicht zu dem meisten, was ich gesagt habe, Ja sagen und dann die Frage stellen: „Gibt es keine andere Alternative? Gibt es kein anderes ideologisches System, das weder kapitalistisch noch sozialistisch ist, sondern antikapitalistisch, das sich aber, wenn man so will, humaner mit den Interessen der afrikanischen Menschen befasst, wo immer sie sich befinden?“
Diese Fragen sind es wert, untersucht zu werden, denn es sind schwarze Menschen, die diese Fragen stellen, und wir müssen versuchen, sie zu beantworten. Ich würde vorschlagen, dass wir uns konkrete Beispiele von Afrikanern oder Schwarzen ansehen, die versucht haben, Systeme zu entwickeln, die sie als nicht-kapitalistisch und nicht-sozialistisch betrachten, Systeme, die sie als gültige Alternativen betrachten. Wissenschaftlicher Sozialismus für die Emanzipation der afrikanischen Bevölkerung.
In dieser Hinsicht gibt es eine Reihe von Panafrikanisten, eine Reihe von afrikanischen Nationalisten in Afrika, in der Karibik und in diesem Land, die diesen Weg eingeschlagen haben. George Padmore tat dies am Ende seines Lebens und unterschied zwischen wissenschaftlichem Sozialismus und Panafrikanismus. Er sagte, dies sei der Weg, den wir einschlagen werden: Panafrikanismus. Wir wollen nicht den kapitalistischen Weg gehen, wir wollen nicht den sozialistischen Weg gehen, wir werden für uns selbst etwas entwickeln, das panafrikanisch ist.
In gewisser Weise knüpfte Nkrumah daran an; und obwohl er sich einmal als Marxist bezeichnete, achtete er stets darauf, dies mit dem Hinweis zu relativieren, dass er auch Protestant sei. Er glaubte gleichzeitig an den Protestantismus. So versuchte er, zwei Welten gleichzeitig zu verbinden – die Welt, die sagt, dass am Anfang die Materie war, und die Welt, die sagt, dass am Anfang das Wort war.
Und zwangsläufig geriet er zwischen diese beiden Welten. Es ist unmöglich, zwischen diesen beiden Welten zu vermitteln. Aber er war nun einmal da, und wir müssen seine Ehrlichkeit anerkennen, ebenso wie die Ehrlichkeit vieler anderer Menschen, die versucht haben, diese unmögliche Aufgabe zu bewältigen, und wir müssen ihnen folgen, um herauszufinden, warum sie gescheitert sind.
Sie sind gescheitert, weil sich ihre Vorstellung von einer Variante, die sich vom bürgerlichen Denken und vom sozialistischen Denken unterschied, zwangsläufig als bloßer Ableger des bürgerlichen Denkens herausstellte.
Und das war das Problem, dass das bürgerliche Denken und in der Tat auch das sozialistische Denken, wenn wir es genau nehmen, eine Vielzahl von Entwicklungen oder Wegen und Aspekten oder Pfaden haben kann. Beim bürgerlichen Denken kann man aufgrund seiner eigenwilligen Natur und aufgrund der Art und Weise, wie es Exzentriker hervorbringt, jeden Weg einschlagen, denn wenn man nirgendwohin geht, kann man schließlich jeden Weg wählen!
So war es diesen Personen möglich, einen meiner Meinung nach echten Versuch zu unternehmen, mit der Dominanz des bürgerlichen Denkens zu brechen, um dann letztendlich festzustellen, dass sie lediglich eine andere Ausprägung dessen angenommen hatten, womit sie sich ihrer eigenen Aussage nach ursprünglich auseinandergesetzt hatten.
Es gibt eine Reihe von Beispielen, von denen einige passender sind als andere. Einige der Beispiele sind tatsächlich Afrikaner, die meiner Meinung nach von Anfang an offensichtlich unehrlich waren. Ich glaube, dass die meisten Ideologen des Afrikanischen Sozialismus, die behaupten, einen dritten Weg gefunden zu haben, in Wirklichkeit nur billige Betrüger sind, die versuchen, die Mehrheit der Bevölkerung zu täuschen. Ich glaube nicht, dass sie darauf aus sind, den Sozialismus zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass sie darauf aus sind, etwas zu entwickeln, das den Interessen des afrikanischen Volkes dient. Dennoch ist es eine Notwendigkeit unserer Zeit, dass unser Volk nicht länger bereit ist, etwas zu akzeptieren, das ihm nicht unter dem Deckmantel des Sozialismus präsentiert wird.
Deshalb werde ich nicht weiter auf den afrikanischen Sozialismus eingehen. Stattdessen werde ich Beispiele von Menschen anführen, die meiner Meinung nach ernsthaft und ehrlich waren. Kwame Nkrumah war sicherlich einer von ihnen. Nkrumah verbrachte mehrere Jahre in den fünfziger Jahren und bis zu seinem Sturz – das sind mindestens zehn Jahre –, in denen er nach einer Ideologie suchte. Er begann mit einer Mischung aus Marxismus und Protestantismus, sprach über Panafrikanismus, wandte sich demConsciencism und dann dem Nkrumahism zu, und entwickelte alles andere als ein klares Verständnis vom Sozialismus.
Was waren die tatsächlichen Folgen dieser Wahrnehmung? Das ist für uns von Bedeutung. Nehmen wir an, er suchte nach etwas Afrikanischem und versuchte, die Falle zu vermeiden, etwas Fremdes zu übernehmen. Was waren die praktischen Folgen dieses Versuchs, sich von einer internationalen sozialistischen Tradition zu distanzieren? Wir sahen in Ghana, dass Nkrumah sich standhaft weigerte zu akzeptieren, dass es Klassen gab, dass es Klassenwidersprüche in Ghana gab, dass diese Klassenwidersprüche grundlegend waren.
Jahrelang hielt Nkrumah an dieser Mischphilosophie fest, die einige sozialistische Prämissen übernahm, deren logische Schlussfolgerung er jedoch nicht ziehen wollte – dass es entweder ein kapitalistisches System gab, das auf dem Privateigentum an den Produktionsmitteln und der Entfremdung der Arbeitsergebnisse der Menschen beruhte, oder dass es ein alternatives System gab, das völlig anders war, und dass es keine Möglichkeit gab, diese beiden Systeme nebeneinander zu stellen und zu vermischen, um etwas Neues und Lebensfähiges zu schaffen.
Eine äußerst wichtige Bewährungsprobe für diese Position war der Sturz Nkrumahs selbst! Nach seinem Sturz lebte er in Guinea-Conakry und schrieb vor seinem Tod einen kleinen Text mit dem Titel Class Struggle in Africa. Es handelt sich dabei nicht um die bedeutendste philosophische Abhandlung, aber sie ist historisch wichtig, weil Nkrumah darin selbst die Folgen, die irreführenden Folgen einer Ideologie zugibt, die sich für eine afrikanische Sache einsetzte, aber aus Gründen, die er nicht verstand, eine historische Notwendigkeit verspürte, sich vom wissenschaftlichen Sozialismus zu trennen. Er wies ganz klar auf die katastrophalen Folgen dieser Haltung hin.
Denn Nkrumah leugnete die Existenz von Klassen in Ghana, bis die Kleinbourgeoisie als Klasse ihn stürzte. Und dann, in Guinea, sagte er, es sei ein schrecklicher Fehler gewesen. Ja, es gibt Klassen in Afrika. Ja, die Kleinbourgeoisie ist eine Klasse, deren Interessen denen der Arbeiter und Bauern in Afrika grundlegend entgegenstehen. Ja, die Klasseninteressen der Kleinbourgeoisie sind dieselben oder zumindest mit den Klasseninteressen des internationalen Monopolkapitals verbunden; und deshalb haben wir in Afrika einen Klassenkampf innerhalb des afrikanischen Kontinents und einen Kampf gegen den Imperialismus.
Und wenn wir diese Widersprüche überwinden und den arbeitenden Menschen, den Produzenten Afrikas, den Sieg und die Befreiung bringen wollen, müssen wir uns mit dieser Ideologie auseinandersetzen, die zunächst einmal die Existenz ausbeutender und unterdrückender Klassen anerkennt und in Frage stellt.
Es ist ein sehr wichtiges historisches Dokument. Es ist das, womit Nkrumah einer Selbstkritik am nächsten kommt. Es ist das Zeugnis eines echten Nationalisten, eines afrikanischen Nationalisten, der jahrelang mit der Annahme und dem Gefühl umherwanderte, dass er sich irgendwie vom wissenschaftlichen Sozialismus distanzieren müsse, weil dieser außerhalb der Grenzen seiner eigenen Gesellschaft entstanden war und er Angst vor dessen kulturellen Auswirkungen hatte.
Das ist die wohlwollendste Art, es auszudrücken. Aber die Angst ist in Wirklichkeit auf Aspekte der bürgerlichen Ideologie zurückzuführen. Auf die Tatsache, dass er eine Unterscheidung zwischen sozialer Theorie und wissenschaftlicher Theorie machte, die nicht notwendig ist. Das ist die Unterscheidung, die aus der Geschichte des bürgerlichen Denkens hervorgeht.
Die Menschen scheinen keine Schwierigkeiten damit zu haben, sich für die Nutzung von Aspekten der materiellen Kultur zu entscheiden, die ihren Ursprung im Westen haben, unabhängig davon, ob sie aus einer kapitalistischen oder einer sozialistischen Gesellschaft stammen. Die Menschen haben keine Schwierigkeiten mit Elektrizität, aber sie sagen: „Marx und Engels, das ist europäisch!“ War Edison ein Rassist? Aber sie stellen die Frage: „War Marx ein Rassist?“ Sie glauben wirklich, dass sie eine grundlegende Unterscheidung treffen, während sie in Wirklichkeit die Gesamtheit der sozialen Entwicklung verschleiern. Und die Naturwissenschaften sind nicht von den Sozialwissenschaften zu trennen. Unsere Interpretation der sozialen Realität kann in ähnlicher Weise ein bestimmtes historisches Gesetz und damit ein wissenschaftliches Gesetz der Gesellschaft ableiten, das unabhängig von seinem Ursprung oder seinen Urhebern angewendet werden kann.
Natürlich ist es wahr, und dies ist die passendste Anmerkung zum Schluss, dass jede Ideologie, wenn sie angewendet wird, mit Feingefühl angewendet werden muss. Sie muss mit einem gründlichen Verständnis der inneren Realitäten einer bestimmten Gesellschaft angewendet werden.
Der Marxismus kommt als historische Tatsache in die Welt, und er kommt in einem kulturellen Kontext. Wenn zum Beispiel Afrikaner oder, lassen Sie uns zu den Asiaten zurückkehren, wenn die Chinesen zum ersten Mal marxistische Texte in die Hand nahmen, waren das europäische Texte. Sie waren voller Vorstellungen von der historischen Entwicklung Europas selbst. So waren Methode und Fakten offensichtlich miteinander verwoben, und die Schlussfolgerungen standen tatsächlich in einem bestimmten historischen und kulturellen Kontext.
Es war die Aufgabe der Chinesen, sich damit auseinanderzusetzen, es anzupassen, zu hinterfragen und zu prüfen, inwieweit es auf ihre Gesellschaft anwendbar war. Um wissenschaftlich zu sein, bedeutete dies in erster Linie, die Besonderheiten der historischen und sozialen Entwicklung Chinas gebührend zu berücksichtigen.
Ich habe Cabral bereits in einem anderen Zusammenhang zitiert, und er taucht auch in diesem Zusammenhang wieder auf. Die Art und Weise, wie er stets die Besonderheiten der Klassenentwicklung im heutigen Guinea-Bissau betrachtet. Er betrachtet das Potenzial der Klassen in Guinea-Bissau zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und deshalb sorgt er natürlich dafür, dass der Marxismus nicht einfach als Summe der Geschichte anderer Völker erscheint, sondern als lebendige Kraft innerhalb der eigenen Geschichte.
Und das ist eine schwierige Transformation. Das ist die Aufgabe eines jeden, der sich als Marxist versteht. Da dies jedoch mit so vielen Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden ist, wählen viele Menschen den einfachen Weg, nämlich es als fertiges Produkt zu betrachten und nicht als fortlaufendes soziales Produkt, das an die eigene Gesellschaft angepasst werden muss.
Wenn man sich die marxistische Theorie und ihre Relevanz für die „Rassenfrage“ ansieht, wenn man sich die Relevanz der marxistischen Theorie für die nationale Emanzipation ansieht, stößt man auf ein sehr wichtiges Paradoxon. Und zwar dieses: Der Nationalist im engeren Sinne, also der kleinbürgerliche Nationalist, der in unserer Epoche lediglich die Wiederherstellung der nationalen Unabhängigkeit anstrebt, ist nicht in der Lage, den Menschen in Afrika oder den Völkern der Karibik eine Teilhabe an der liberalen Demokratie zu ermöglichen.
Der Kleinbürger kann diese historischen Aufgaben nicht erfüllen. Denn die nationale Befreiung erfordert eine sozialistische Ideologie. Wir können diese beiden Dinge nicht voneinander trennen.
Selbst für die nationale Befreiung in Afrika haben Guinea-Bissau und Mosambik sehr deutlich die Notwendigkeit einer ideologischen Entwicklung, einer Bewusstseinsbildung, wie man in Lateinamerika sagt, aufgezeigt; und der nationalistische Kampf wurde gewonnen, weil er unter dem Vorzeichen der wissenschaftlichen sozialistischen Perspektive stand.
Wie Cabral sagte: „Es mag Revolutionen gegeben haben, die eine revolutionäre Theorie hatten und gescheitert sind. Aber es hat sicherlich keine Revolution gegeben, die ohne eine revolutionäre Theorie erfolgreich war.“
1973 erschien es beim Wagenbach-Verlag unter dem Titel Afrika. Die Geschichte einer Unterentwicklung. 2023 wurde es unter dem Titel Wie Europa Afrika unterentwickelte für den Manifest-Verlag neu übersetzt.
Auf Englisch findet man einige Texte von Rodney im Internet. Auf Deutsch ist neben dem erwähnten Werk von ihm zudem 2024 eine Textsammlung beim Berliner Dietz-Verlag unter dem Titel Dekolonialer Marxismus erschienen.
Anregungen und zahlreiche Texte auf Englisch finden sich im Marxist Internet Archive.
Gemeint sind die USA.
Gemeint ist das Jahr 1974.
Im Original: „race position“.
Wörtlich: „Ausfluss“, bezeichnet im metaphysischen und religiösen Denken das Hervorgehen der Dinge aus dem (ewigen/göttlichen) Ursprünglichen. Rodney nutzt hier bewusst einen religiösen bzw. idealistischen Terminus, der im Gegensatz zu seiner materialistischen Argumentation steht.
Revolutionärer Führer und Theoretiker aus Guinea-Bissau. Wir haben einen Ausschnitt aus seinem Werk Theorie als Waffe veröffentlicht.
Revolutionärer Führer und von 1975 bis 1986 erster Präsident des unabhängigen Mosambik.
Aus Trinidad stammender Panafrikanistischer Vordenker und Führer, in den 1920er und 1930er Jahren organisierter Kommunist, später enger Weggefährte und Berater Nkrumahs.
Panafrikanistischer Führer sowie von 1952 bis 1957 Premierminister des kolonialen und 1957 bis 1966 erster Präsident des unabhängigen Ghana. Wir haben sowohl einen Auszug aus seinem Werk Afrika muss eins werden von 1963 als auch aus Class Struggle in Africa von 1970 veröffentlicht.
Mit diesem Label wurden ab den 1960er Jahren verschiedene politische Ideologien und Konzepte bedacht, was teilweise zu Verwirrung führt. Auch Mehdi Ben Barka kritisierte in seinem von uns veröffentlichten Text von 1963 solche Konzepte, ohne sie jedoch genau zu differenzieren. In unserem redaktionellen Vorwort zum Textauszug aus Nkrumahs Class Struggle in Africa nannten wir als Beispiel den sog. „Ujamaa“-Sozialismus in Tansania unter Julius Nyerere. Rodney widerspricht dem aber in seinem Text Tanzanian Ujamaa and Scientific Socialism von 1972 entschieden: „Es gibt jedoch mehrere Gründe, diese beiden Konzepte klar voneinander zu trennen. Als der „Afrikanische Sozialismus” Anfang der 1960er Jahre in Mode war, umfasste er eine Vielzahl von Interpretationen, die vom Wunsch nach einer sozialistischen Gesellschaft in Afrika bis zum Bestreben reichten, den Status quo des Neokolonialismus aufrechtzuerhalten. Seitdem wird der Begriff mit seinem konsequentesten und am wenigsten revolutionären Ideologen, Leopold Senghor, und mit dem verstorbenen Tom Mboya in Verbindung gebracht. Unter „Afrikanischem Sozialismus” wird insofern im Allgemeinen eine Reihe von Beziehungen verstanden, die Kapitalismus und Imperialismus unangefochten lassen. Es ist daher unerlässlich, die antikapitalistische und antiimperialistische Haltung in Tansania von einem Begriff zu trennen, der von nicht-revolutionären afrikanischen Führern vorweggenommen wurde.“
Nkrumah wurde 1966 gestürzt.
Mit dem 1964 erstmals veröffentlichten Buch Consciencism. Philosophy and Ideology for De-Colonization legte Nkrumah die Grundlage für eine Art eigener Ideologie.
Gemeint ist der Erfinder Thomas Edison, der im 19. Jahrhundert u. a. die Glühbirne entwickelte.