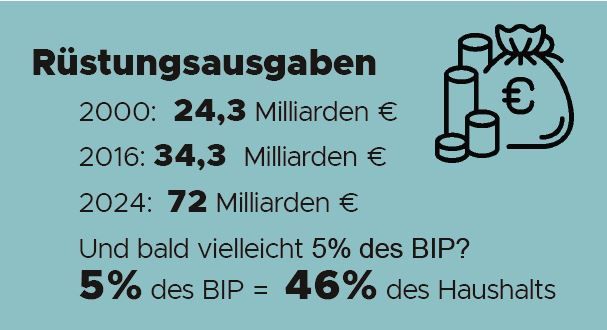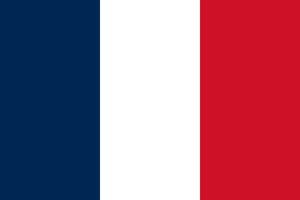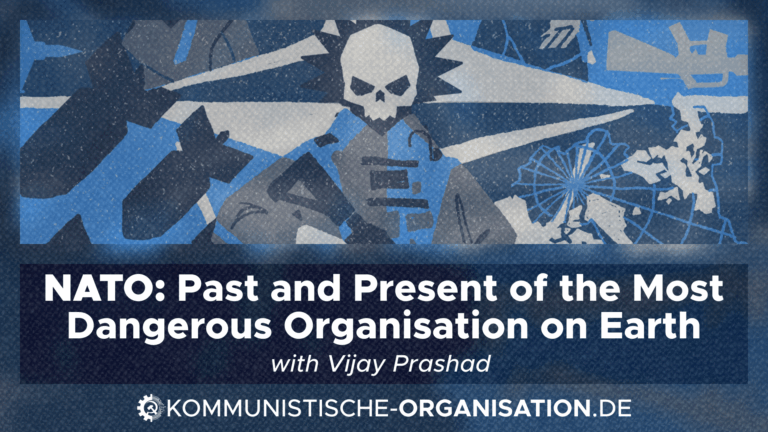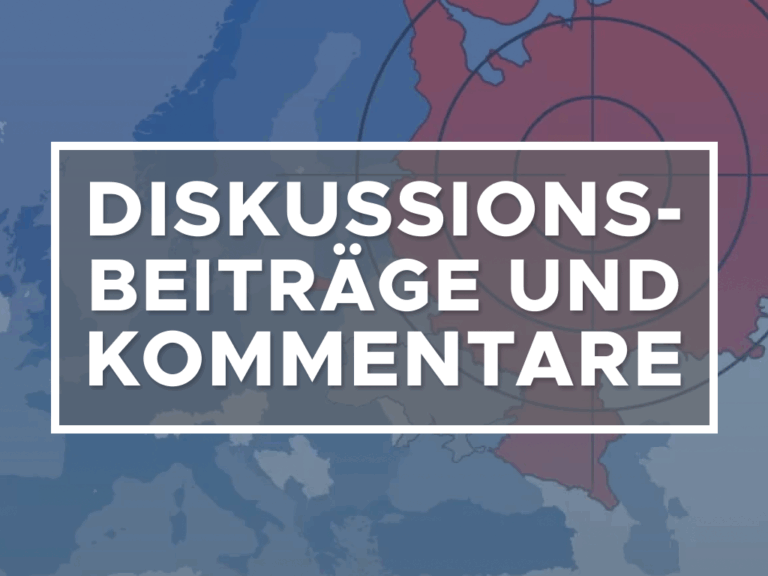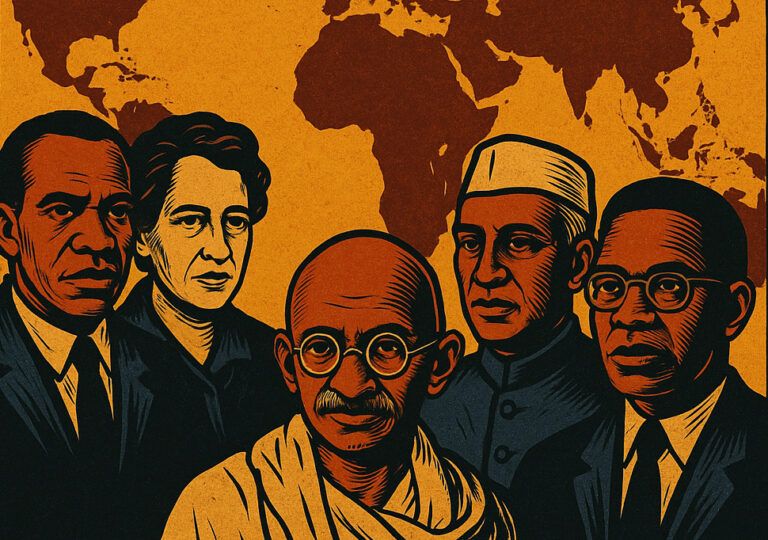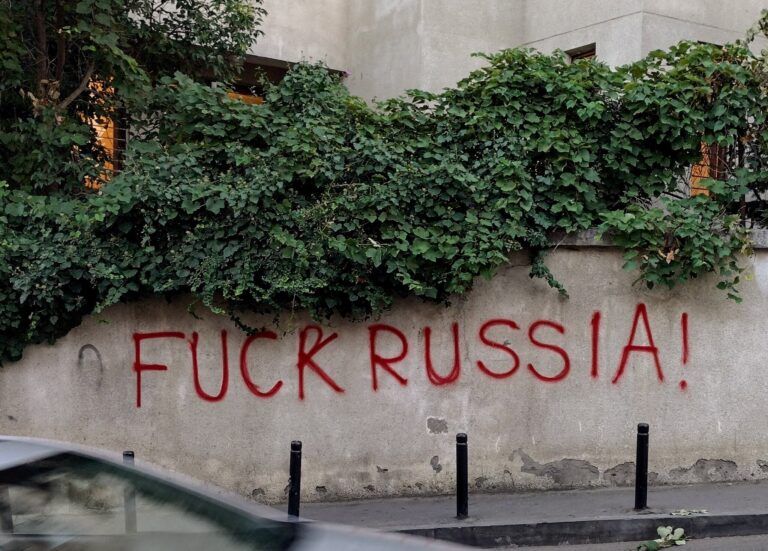von Leon Wystrychowski
Wir veröffentlichen die einzelnen Kapitel und Abschnitte der Broschüre „Faschismus – Kommunistische und bürgerliche Analysen im Überblick“ als Fließtexte Online. Die gesamte Broschüre ist bereits auf der Website verfügbar.
Abstract: Der Text versucht, einen Einblick in die verschiedenen Analyseansätze und Debatten rund um die Frage nach den Zusammenhängen zwischen Kolonialismus und Faschismus zu geben. Als zentrale inhaltliche Ebenen werden eingangs 1. die kolonialen Wurzeln des Faschismus, 2. die „klassische“ Kolonialpolitik, die von den Faschisten fortgesetzt wurde, 3. die faschistische Kolonialpolitik in Osteuropa und 4. die Wesensverwandtschaft oder gar -identität der beiden Phänomene ausgemacht. Anhand von Aussagen und Einschätzungen verschiedener politischer und akademischer Akteure verfolgt der Text die Auseinandersetzungen um diese Fragen von den 1930er Jahren bis in die Gegenwart. Obwohl er vor allem auf der Darstellungsebene bleibt, ordnet der Text die verschiedenen Aussagen in ihren jeweiligen historischen Kontext ein, zieht Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Diskurssträngen und argumentiert, inwiefern das Aufzeigen der Zusammenhänge zwischen Kolonialismus und Faschismus eine Bereicherung für das Verständnis des Phänomens Faschismus sein kann.
Zwischen 1936 und 1961 äußerten sich politische Akteure und Intellektuelle verschiedener Lager – von deutschen und palästinensischen Kommunisten bis Hannah Arendt, von Mahatma Gandhi bis Frantz Fanon – zu den Zusammenhängen zwischen Faschismus und Kolonialismus. Doch danach war lange wenig zu diesem Thema zu vernehmen. Erst in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten wurde es wieder, unter Einfluss der Postcolonial Studies, auf die wissenschaftliche – und zugleich politische – Tagesordnung gesetzt.
Diese Zusammenhänge berühren vor allem vier verschiedene Ebenen: Zunächst die „klassische Kolonialpolitik“ der faschistischen Regime vor allem gegenüber Afrika. Dann die Vernichtungs- und Eroberungspolitik in Osteuropa, die mit der „Notwendigkeit“ der Eroberung des „Lebensraums“ für das deutsche Volk legitimiert wurde und die in der Forschung in den letzten Jahren vermehrt in eine Reihe mit Kolonialkriegen gesetzt wurde. Und schließlich ist da die Frage nach den kolonialen Wurzeln und Kontinuitäten des Faschismus an sich: personell, ideologisch und vor allem die Herrschaftspraxis betreffend. Insbesondere der letztgenannte Aspekt wirft sogleich die Frage auf, ob der Kolonialismus eine Form des Faschismus ist.
Der Text beginnt mit einem kurzen Überblick über die reale faschistische Kolonialpolitik am Beispiel Deutschlands und Italiens. Anschließend werden die Forschung und Debatte rund um das Thema Faschismus und Kolonialismus – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – anhand der vier ausgemachten Ebenen nacheinander dargestellt. Dabei sei vorweggeschickt, dass viele der hier behandelten Autoren die Begriffe Faschismus und Kolonialismus nicht immer konsequent und durchgängig in gleicher Weise verwendet haben. Erst recht gibt es unter den Autoren kein einheitliches Verständnis dieser beiden Phänomene. Ausgeklammert werden musste hier die letztlich strategische Frage nach den Zusammenhängen und Widersprüchen zwischen Antikolonialismus und Antifaschismus, obwohl sich einige der hier behandelten Autoren zu diesen Fragen kontrovers positioniert haben.
1. Faschistische Kolonialpolitik in Afrika
Die wichtigsten faschistischen oder proto-faschistischen Regime Europas – Italien, Deutschland, Spanien, Portugal und das Vichy-Regime – haben eine aktive Kolonialpolitik vor allem in Afrika betrieben.
Italiens Kolonialpolitik bezog sich in erster Linie auf Nord- und Ostafrika. Die Italiener schafften es bis zur Machtübernahme der Faschisten weder, das 1912 besetzte Libyen wirklich unter Kontrolle zu bringen, noch es in eine wirkliche Siedlerkolonie zu verwandeln. Zwar war die „Übergangsphase von Liberalismus zu Faschismus“ von weitgehenden Kontinuitäten in der Kolonialpolitik geprägt, weil man 1922-25 noch mit der Errichtung der uneingeschränkten faschistischen Diktatur beschäftigt war.[1] Trotzdem begann bereits ab 1923 ein Eroberungsfeldzug, der bald die Form eines Vernichtungskriegs annahm: Giftgas, Bombardements und Massenerschießungen gehörten genauso zur Praxis wie die systematische Vernichtung der Viehbestände, um den Libyern die Lebensgrundlage zu entziehen.[2] Darüber hinaus wurden rund 15 Prozent der Libyer in Konzentrationslager gesperrt, von denen nur eine Minderheit überlebte.[3] Auf diese Weise wurde Libyen bis 1931 „befriedet“. Im Zuge des italienisch-deutschen Nordafrika-Feldzuges 1940-43 kam es dann erneut zu Masseninternierungen, -vergewaltigungen, -morden und Plünderungen durch italienische und Wehrmachtssoldaten sowie Siedler, was übrigens von General Rommel, der bis heute in der BRD den Ruf eines „unideologischen Saubermanns“ genießt, mindestens gebilligt wurde.[4]
Am 3. Oktober 1935 überfiel Italien das Königreich Äthiopien. Für die meisten afrikanischen und einige europäische Historiker kennzeichnet dieses Datum den eigentlichen Beginn des Zweiten Weltkriegs.[5] Auch in diesem Krieg wurde die Zivilbevölkerung „gezielt gedemütigt, vertrieben, interniert und getötet“, es kam Giftgas in großem Stil zum Einsatz und die Lebensgrundlage der Äthiopier wurde „durch das Abbrennen ganzer Landschaften, die Bombardierungen und die Vergiftung der Viehherden“ systematisch zerstört.[6] Sowohl die Zerschlagung des Widerstands in Libyen und die folgende Einwanderung arbeitsloser Siedler dorthin als auch der Angriffskrieg auf Äthiopien „stärkten“ Gerhard Feldbauer[7] zufolge „den Masseneinfluss und die Stabilität des Regimes“ in Rom.[8]
In Deutschland wiederum unterstützten die Nazis die Forderung nach der „Rückgabe“ der 1919 abgetretenen Kolonien. In den Reihen der NSDAP fanden sich alte „Kolonialhelden“, wie etwa der an der Niederschlagung des Yihetuan-Aufstandes in China und am Völkermord an den Herero und Nama in Namibia beteiligte Franz Ritter von Epp. Dieser wurde nach 1933 zum Chef des Kolonialpolitischen Amtes der NSDAP und des Reichskolonialbundes (RKB) ernannt.[9]Insbesondere ab 1935 wurde die Kolonialpropaganda massiv forciert.[10] Diese war sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet. Die „Rückgabe“ der ehemaligen deutschen Kolonien wurde insbesondere gegenüber Großbritannien eingefordert. Zugleich stellten sich die Nazis als Vertreter der „weißen Rasse“ und als antikommunistisches Bollwerk Europas dar: Ihre Herrschaft in Afrika werde das „Rückgrat gegen die bolschewistischen Angriffe in den Kolonialländern“ sein, „mit günstiger Auswirkung für Europa.“[11] Bis 1941 stieg die Mitgliederzahl des RKB von 40.000 im Jahr 1933 auf 2 Millionen an.[12]
Schon vor Kriegsbeginn studierten die Nazis den Kolonialismus des faschistischen Italiens in Afrika aufmerksam.[13]Ende der 1930er Jahre begannen die ersten Planspiele für die Neuaufteilung Afrikas.[14] Parallel wurde bereits ein kolonialer Verwaltungsapparat aufgebaut. Dieses Unternehmen stand zwar strategisch immer hinter dem Endsieg im Ostfeldzug zurück – so wurden diese Aufbauarbeiten Ende 1941 zurückgefahren –, doch erst Anfang 1943, zwei Wochen nach der Niederlage bei Stalingrad, wurden sie vollends auf Eis gelegt.[15] Zunächst aber rückte ein deutsches Kolonialreich in Afrika mit dem Sieg über Frankreich im Sommer 1940 in scheinbar greifbare Nähe. Die IG Farben, die Deutsche Bank, das Oberkommando der Wehrmacht und das Auswärtige Amt arbeiteten Pläne für ein deutsches Herrschaftsgebiet aus, das von der afrikanischen West- bis zur Ostküste reichen und vor allem Französisch-Äquatorialafrika und Belgisch-Kongo umfassen sollte. Dabei ging es insbesondere um die Ausbeutung von Bodenschätzen.[16] Die Pläne entsprachen weitgehend jenen, die das Kaiserreich bereits während des Ersten Weltkriegs ausgearbeitet hatte.[17] Allerdings wurden sie mit Blick auf Italien, Spanien, Portugal und Vichy wiederholt angepasst und schließlich vorerst verworfen bzw. angesichts des bevorstehenden Krieges gegen die Sowjetunion zurückgestellt.[18] Stattdessen beutete Deutschland die unter Kontrolle Vichys stehenden Afrika-Kolonien aus.[19]
Die NS-Führung ließ keinen Zweifel daran, dass das Hauptobjekt ihrer Begierde, der von ihr so bezeichnete „Lebensraum“, in erster Linie in Osteuropa lag. Afrika dagegen könne „nur zusätzliche Ausbeutungskolonien für tropische Rohstoffe“ bieten.[20] Die „klassische“ Kolonialpolitik wurde entsprechend der Zerschlagung der Sowjetunion untergeordnet. Es gab während der ersten Jahre der Nazi-Herrschaft durchaus Streit um die Frage, inwiefern Kolonialambitionen in Afrika mit den Eroberungsplänen in Europa in Einklang zu bringen seien.[21] Zudem gab es Verfechter einer „peripheren Strategie“, der zufolge man sich zunächst auf die Ausschaltung Großbritanniens, insbesondere im Mittelmeerraum, konzentrieren sollte.[22] Diese beiden Konzepte – Eroberung von Kolonien und Sicherung des Mittelmeers – waren zum Teil miteinander verwoben und wurden von sich überschneidenden Macht- und Personenkreisen unterstützt, wobei es allerdings bei der „Mittelmeerstrategie“ nicht primär um koloniale Interessen in Afrika ging, sondern darum, London zu isolieren und den eigenen Erdölbedarf durch Zugriff auf die Quellen im Nahen Osten zu decken. Da es sich bei den Befürwortern dieser Strategie zwar „um eine ziemlich große, aber keineswegs dauerhafte, konsistente, einheitlich auftretende oder gar organisierte Fraktion“ handelte,[23] setzte sich letztlich die gerade auch von Hitler vertretene Strategie des „Kontinentalkrieges“ und der Fokussierung auf Osteuropa durch.
2. Faschistischer Kolonialismus
Dass die Faschisten rassistischen und kolonialistischen Vorstellungen anhingen und eigene koloniale Ziele verfolgten, war auch für Zeitgenossen kein Geheimnis: Indem er in seinem Buch über die britische Kolonialherrschaft in Afrika „solchen Quatsch“ wie „die Lehre der ‚Bürde des weißen Mannes‘, der ‚nordischen Überlegenheit‘“ oder „dem ‚Gottesgnadentum der Arier‘“ auflistete, stellte George Padmore[24] 1936 die Ideologie der deutschen Faschisten in eine Reihe mit anderen in Europa vorherrschenden Kolonialideologien. Zugleich betonte er, dass „Mussolini sich als Verfechter der weißen Rasse in Afrika ausgibt“.[25] M. N. Roy[26] machte zwei Jahre später deutlich: „Von seiner Geburt an war der Faschismus als internationales Phänomen offenkundig imperialistisch“,[27] womit er offensichtlich in erster Linie kolonialistisch meinte. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Nazis schon immer Kolonien gefordert hatten und dass Mussolini deutlich gemacht habe, dass Italien sich Gebiete in Afrika und Asien unterwerfen wolle.[28] Seinen Landsleuten, die das Gerede der Nazis über „Arier“ missverstanden, machte er deutlich: „Faschistischer Arianismus ist der Kult der Überlegenheit der weißen Rasse.“[29] Die deutschen „Herrenmenschen“ seien als „gute Europäer“ und „Retter der Welt“ angetreten, um gemeinsam „mit den Briten „die Last des weißen Mannes“ zu teilen.“[30]
Beide waren mit diesen Einsichten nicht allein. Unter arabischen Intellektuellen und in der arabischen Presse etwa wurde die rassistische (einschließlich der antisemitischen), kolonialistische und imperialistische Ideologie des Faschismus immer wieder betont und verurteilt, und zwar sowohl von linker als auch von liberaler, nationalistischer oder islamischer Seite.[31] Die Nationale Befreiungsliga, die 1943 aus der Spaltung der Kommunistischen Partei Palästinas in eine jüdisch-zionistische und eine palästinensische Sektion hervorging, nannte den von den Nazis entfesselten Weltkrieg in ihrem Gründungspapier „die schrecklichste und aggressivste koloniale Bewegung, die die Menschheit je gesehen hat.“[32]
Zur Kolonialpolitik Nazi-Deutschlands wurden in den 1960er Jahren die ersten wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht. Den Vorreiter machte, wie so oft, die DDR: 1961 erschien ein Aufsatz von Horst Kühne über die „faschistische Rassentheorie im Dienst der Kolonialpolitik des deutschen Imperialismus“ und im Jahr darauf ein Buch desselben Autors zum selben Thema.[33] 1965 erschienen ein Heft über die Afrika-Politik der IG Farben und ein Aufsatz über die Kolonialforderungen Nazideutschlands.[34] Die BRD zog 1963 mit einem Aufsatz und 1967 und 1969 mit je einer Monografie nach.[35] In den folgenden mehr als zwei Jahrzehnten erschienen verschiedene Aufsätze zur Kolonialpolitik Nazi-Deutschlands, sowohl in der DDR als auch in der BRD. In den DDR-Standardwerken zur Geschichte Afrikas und zur Geschichte der Araber wurde die Zeit des Zweiten Weltkriegs und insbesondere die Politik der faschistischen Mächte gegenüber diesen Regionen relativ ausführlich behandelt,[36] während die Jahre 1933-45 in den meisten westdeutschen Werken bis heute in wenigen Zeilen abgehandelt werden. 1993 wurde die bereits zwei Jahrzehnte zuvor fertiggestellte Dissertation des kameruneschen Historikers Alexandre Kum’a Ndumbe III. zur Afrika-Politik der Nazis auf Deutsch verlegt.[37] Seither erschienen einige weitere Aufsätze und seit den 2000er Jahren auch mehrere Bücher zur faschistischen Kolonial- und zur damit thematisch zwangsläufig eng verknüpften Afrika-, Araber- und Islampolitik.
Einige bürgerliche Historiker führen die strategische Fokussierung der faschistischen Führung Deutschlands auf den Osten und gegen die Sowjetunion in erster Linie auf die Person Hitlers und auf dessen ideologisches Programm zurück.[38] Gerade Klaus Hildebrand, der 1969 eine fast 1000 Seiten starke Studie zur Kolonialpolitik der NSDAP vorgelegt hatte, vertrat die These eines „Hitler’schen Programms“. An dieser Personen- und Ideologiefixierung wiederum wurde von marxistischer Seite scharfe Kritik geübt.[39] Aber auch Ndumbe III. warf Hildebrand vor, „die ökonomischen Faktoren […] zu wenig [zu] berücksichtig[en].“[40] Allerdings lieferte Hildebrand auch einen für eine materialistische Argumentation durchaus interessanten Hinweis, indem er betonte, dass zwar die verarbeitende und die chemische Industrie (insbesondere die IG Farben) sowie das Handelskapital ein unmittelbares ökonomisches Interesse an afrikanischen Kolonien gehabt hätten, die Schwerindustrie – mit Ausnahme der Krupp AG – dagegen kaum.[41]
Die Funktion der kolonialen Propagandakampagne ab 1935/36 wird in der Literatur relativ einhellig eingeordnet. Die folgende Auflistung stützt sich auf Kühne: Außenpolitisch wollte man mit den lautstarken revisionistischen Forderungen Großbritannien zum Einlenken gegenüber den deutschen Ambitionen in Osteuropa bewegen. Innenpolitisch diente die Kolonialpropaganda einerseits der Ablenkung vom durch die massive Aufrüstung verursachten sinkenden Lebensstandard der Bevölkerung. Andererseits und vor allem aber war sie ein wichtiges Mittel der ideologischen Kriegsvorbereitung. Darin lag eine Besonderheit: Das Problem war nämlich, dass die Briten als „nordisches Brudervolk“ galten und Rassismus hier also unbrauchbar war. Daher griff man in Berlin erneut zur Polemik gegen das „Versailler Diktat“ und die deutschen Kolonien in „fremder Hand“. Darüber hinaus sollte die Kolonialpropaganda das deutsche Volk auf einen weiteren kolonialen Raubkrieg einstimmen, diesmal in Europa selbst.[42]
Was die italienische Kolonialpolitik angeht, so kritisiert Francesco Filippi in einer kürzlich auf Deutsch erschienenen Arbeit, dass der eigene Kolonialismus im italienischen Diskurs zumeist auf den „Kolonialismus „Marke Mussolini““ verkürzt und die „Verantwortung Italiens […] auf die zwanzig Jahre der Mussolini-Herrschaft beschränkt“ bleibe.[43]Allerdings war der Angriffskrieg des faschistischen Italien 1935 auf Äthiopien letztlich das einzige italienische Kolonialunternehmen, das nicht de facto im Interesse des britischen Imperialismus lag und auch nicht mit London im Vorhinein abgestimmt war. Insofern ließe sich argumentieren, dass die italienischen Faschisten nicht nur die Kolonialpolitik der Liberalen fortgesetzt und in ihrer Brutalität auf die Spitze getrieben, sondern sie auch erstmals zu einem eigenständigen Projekt des italienischen Imperialismus gemacht haben. Das umso mehr, als Mussolini sein ostafrikanisches Imperium nun explizit gegen Großbritannien durchsetzen wollte, indem er von Libyen aus in Richtung Ägypten marschieren ließ, um den Sueskanal zu besetzen und Ägypten und den Sudan unter Kontrolle zu bringen.[44]Gabriele Schneider wiederum ging anhand der Kolonialpolitik der italienischen Faschisten der Behauptung von Historikern wie Renzo De Felice, Karl Dietrich Bracher oder Hildebrand nach, wonach der „Nationalsozialismus“ und der italienische Faschismus sich dadurch unterschieden, dass letzterer deutlich weniger rassistisch gewesen sei. Damit argumentieren sie zugleich gegen einen universellen Faschismus-Begriff.[45] Sie kam dabei zu dem Ergebnis, dass der Rassismus zwar „nicht als ein konstituierendes Element“ des italienischen Faschismus angesehen werden könne, das spätere, sowohl mit der Kolonialpolitik in Libyen und dem Überfall auf Äthiopien als auch mit dem an Nazi-Deutschland orientierten antisemitischen Kurs zusammenhängende „Einschwenken auf rassenpolitische Prämissen – bei allen Unterschieden in Intensität und Ausprägung – wiederum die ideologische Affinität der deutschen und italienischen Diktatur“ durchaus beweise.[46]
Zuletzt ein paar Anmerkungen zur faschistischen Politik gegenüber den Arabern bzw. Muslimen: Dieses Thema ist aufgrund des gerade in Deutschland weit verbreiteten Geschichtsrevisionismus à la Benjamin Netanjahu, Matthias Küntzel, Amadeu-Antonio-Stiftung und Ruhrbarone von hoher Aktualität. 1965 erschien in der DDR eine Pionierarbeit von Heinz Tillmann zu „Deutschlands Araberpolitik im zweiten Weltkrieg“,[47] an die insbesondere der ehemalige DDR-Arabist und -Islamwissenschaftler Gerhard Höpp und das Zentrum Moderner Orient (ZMO) kritisch anschlossen. Höpp, das ZMO und einige andere Autoren konnten in den zwei Jahrzehnten, gestützt auf arabische Quellen, den Mythos widerlegen, wonach die Faschisten einen starken Einfluss oder auch nur besonders große Sympathie in den arabischen Ländern genossen hätten.[48] Wie oben erwähnt, waren sich viele Intellektuelle und Politiker über den rassistischen und imperialistischen Charakter der Faschisten im Klaren. Zwar bemühten sich Mussolini, Franco und Hitler tatsächlich zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Zielen – um ihre eigenen Kolonien ruhig zu halten, um die britische bzw. französische Kolonialherrschaft zu destabilisieren, um die feindlichen Armeen zu zersetzen oder um Truppen in Nordafrika, auf dem Balkan und in der Sowjetunion zu rekrutieren – um ein „pro-arabisches“ bzw. „pro-muslimisches“ Image. Doch insbesondere Italien, mit seinen Kolonialkriegen in Afrika, war unbeliebt.[49] Und auch Deutschlands großangelegte Propaganda in Nordafrika und der Versuch, arabische Einheiten aufzustellen, waren letztlich ein „Misserfolg“, wie David Motadel konstatiert.[50] Stefan Petke geht zudem davon aus, „dass die muslimischen Einheiten“, die Deutschland in kleinen Mengen in Nordafrika und in größeren in Osteuropa aushob, „in einer Tradition kolonialer Hilfstruppen gesehen werden müssen“, so wie sie in allen besetzten Gebieten von den Kolonialherren eingesetzt wurden, um, unter Zwang oder für ein kleines Gehalt, als Kanonenfutter zu dienen, harte oder gefährliche Arbeit zu übernehmen, die lokale Bevölkerung ruhig zu halten und die ortsfremden Besatzer zu führen.[51]
3. Koloniale Wurzeln des Faschismus
Aufmerksame Zeitgenossen in den verschiedenen Teilen der Welt – und gerade solche, die selbst von Rassismus und Imperialismus betroffen waren – hatten aber nicht nur einen geschärften Blick für die kolonialen Ambitionen der Faschisten. Roy etwa wies auch auf die ideologischen Wurzeln dieses faschistischen Kolonialismus hin. In seinem Buch über den Faschismus aus dem Jahr 1938 schrieb er im Kapitel über den „Herrenmenschen-Kult“: „Der unmittelbare politische Ausdruck“ dieses auf Nietzsche zurückgehenden Konzepts „war die Forderung des deutschen Imperialismus nach einem „Platz an der Sonne“ – das heißt koloniale Expansion“ noch zu Zeiten des Kaiserreichs. „Faschismus“ wiederum sei „die krasseste Manifestation derselben Philosophie der Macht und Raubtierhaftigkeit.“[52] Ähnlich urteilte 1940 auch W. E. B. Du Bois[53]: „Hitler ist der späte, rohe, aber logische Vertreter der Rassenphilosophie der weißen Welt seit der Berliner Konferenz von 1884.“[54]
Hannah Arendt, die bereits 1945/46 viel über den Zusammenhang zwischen Imperialismus, Kolonialrassismus und Antisemitismus geschrieben hatte,[55] untersuchte in ihrem 1951 erschienenen Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft den Imperialismus neben dem Antisemitismus als eine der beiden politischen und ideologischen Wurzeln des deutschen Faschismus. Ohne die von Marx, Hobson, Hilferding, Lenin und Luxemburg festgestellten ökonomischen Triebkräfte des Kapitalismus hin zum Imperialismus in Abrede zu stellen, benannte sie „den Versuch […], die Menschheit in Herren- und Sklavenrassen, in „higher and lower breeds“, in Schwarze und Weiße, in Bürger und eine „force noire“ […] einzuteilen“ als „die eigentliche politische Struktur“ des Imperialismus.[56] Dass dieser Rassismus also „die Waffe des Imperialismus“ sei, war Arendt zufolge „evident“ und letztlich eine „Binsenweisheit“.[57] Er habe schon „lange vor den Nazis […] große Teile der geistigen Welt des Abendlandes entscheidend bestimmt.“ Den Rassebegriff hätten „weder die Nazis noch die Deutschen entdeckt, er ist nur nie vorher mit solch gründlicher Konsequenz in die Wirklichkeit umgesetzt worden.“[58] Diese letzte Formulierung klingt sehr nach Du Bois, ohne dass Arendt sich auf ihn bezogen hätte. Ideengeschichtlich leitet sie den deutschen Faschismus nicht direkt aus dem kolonialen, sondern aus dem „kontinentalen Imperialismus“ ab. Letzterer habe sich, weil ein Kind des späten 19. Jahrhunderts und auch „vielleicht weil er als eine Reaktion auf den Überseeimperialismus entstanden war, von vornherein an Rassebegriffen“ orientiert und sich die Rassentheorien „viel enthusiastischer und bewußter zu eigen gemacht.“[59] In Bezug auf die Ideologie ist der kontinentale Imperialismus also bildlich gesprochen der jüngere Bruder des überseeischen und der Nazi-Faschismus wiederum seine Ausgeburt. Hinzu kommt noch die „totalitäre Bürokratie“, die sich, im Gegensatz zu den Herrschaftsapparaten nicht-totalitärer Regime, „in alle Angelegenheiten der Bürger, private wie öffentliche, seelische wie äußere mit gleicher Konsequenz und Brutalität einzuschalten“ verstehe.[60] Sowohl der Rassismus als auch die Bürokratie seien „außerhalb Europas in Afrika, dem schwarzen Kontinent, experimentiert worden.“[61] Obwohl das Buch als ihr zentrales Werk gilt und weithin bekannt ist, findet diese Argumentation Arendts bis heute wenig Beachtung. Stattdessen wird es – und das dürfte sich die Autorin mit ihrer antikommunistischen und dann auch anti-antikolonialen Wende, die in diesem Werk offen zutage tritt, selbst zuzuschreiben haben –[62] in erster Linie als ein Manifest des „Anti-Totalitarismus“ (siehe Kapitel 3) und damit letztlich des liberalen Antikommunismus der Nachkriegszeit gefeiert.
Ein von verschiedenen Autoren behandelter Zusammenhang zwischen Kolonialismus und Faschismus ist der sogenannte „Bumerang-Effekt“: Bereits 1936 schrieb Padmore über den Faschismus der Siedler in den britisch beherrschten Gebieten Afrikas.[63] Dabei stellte er fest, dass die Kolonien „der Nährboden für die Art faschistischer Mentalität“ seien, „die heute in Europa entfesselt wird“, weshalb der Kampf gegen den Faschismus in Europa mit dem Kampf gegen den Kolonialismus verbunden sei.[64] Im Jahr darauf erklärte auch Jawaharlal Nehru, wenn auch auf abstrakterer Ebene und ohne Verweis auf die Kolonialsiedler als treibende Kraft, dass Demokratie und Imperialismus inkompatibel seien: „das eine muss das andere schlucken.“ Daher müsse „das Imperium sich selbst liquidieren oder in den Faschismus abdriften.“[65] In seinem 1950 erstmals erschienenen Discours sur le Colonialisme schrieb Aimé Césaire[66] darüber,
„wie die Kolonisation daran arbeitet, den Kolonisator zu entzivilisieren, ihn im wahrsten Sinne des Wortes zu verrohen […] wenn in Vietnam ein Kopf abgeschlagen und ein Auge ausgestochen wird und in Frankreich nimmt man das hin, ein Kind vergewaltigt wird und in Frankreich nimmt man das hin, ein Madagasse hingerichtet wird und in Frankreich nimmt man das hin“.
Es handle sich bei diesem offen ausgelebten Rassismus um ein „Gift“, das „in die Adern Europas infiltriert“ werde und zur „Verwilderung des Kontinents“ führe. Die Faschisten profitierten davon und holten „eines schönen Tages“ zum „gewaltigen Gegenschlag“ in der Metropole selbst aus.[67] In der englischen Übersetzung wurde dieser „Gegenschlag“ mit „boomerang“ übersetzt, wodurch der Begriff des „Imperial boomerang“ geprägt wurde. Dieser findet sich bereits im Jahr darauf bei Arendt wieder, die von einer „große[n] Furcht vor dem Bumerangeffekt in den Mutterländern“ schrieb.[68]Sie erklärt allerdings auch, dass der „kontinentale Imperialismus“ aufgrund seiner räumlichen Nähe im Gegensatz zum überseeischen Kolonialismus „keiner Bumerangeffekte bedurfte, um die Konsequenzen imperialistischer Methoden und Herrschaftsvorstellungen unmittelbar in Europa selbst fühlbar zu machen.“[69] Albert Memmi[70] konkretisierte die These vom „Bumerang-Effekt“ 1957 weiter, indem er mit den Kolonialisten ein Subjekt ins Spiel brachte: Weil nämlich der Kolonialismus von der Metropole abhänge, neigten diese ihm zufolge dazu, reaktionäre Kräfte im „Mutterland“ zu unterstützen, die das Fortbestehen der kolonialen Herrschaft am ehesten gewährleisteten. Der „Kolonialfaschismus“ expandiere also nach Europa.[71] Zur Einordnung sei darauf hingewiesen, dass Padmore primär Afrika und Großbritannien, Nehru Indien, Spanien und Britannien vor 1945, Arendt vor allem Deutschland und Césaire wiederum Afrika, Vietnam und Frankreich und Memmi Algerien und Frankreich nach 1945 im Blick hatten. Memmis Buch erschien mitten im Algerienkrieg und am Vorabend des Putsches pro-kolonialistischer Militärs von 1958, der die Vierte Republik in Frankreich beendete.
Schon früh wurden Gemeinsamkeiten und Kontinuität zwischen dem Rassismus der Nazis und dem westlich des Atlantiks gezogen. C. L. R. James[72] verglich bereits in seinem Werk Die schwarzen Jakobiner[73] über die haitianische Revolution von 1791 die Abstammungsregelungen und die „Rassen“hierarchie in der Karibik mit jenen in Nazideutschland: Die Faschisten hätten den Deutschen „eine arische Großmutter ebenso wertvoll erscheinen [lassen], wie die Herrschenden von damals den M*latten einen karaibischen Vorfahr“,[74] das heißt einen zwar schwarzen, aber eben nicht einen versklavten afrikanischen, sondern einen frei geborenen karibischen Indigenen. James schrieb diesbezüglich, dass man diesen Rassen- und Abstammungswahn „nach der Zeit des Hitlerfaschismus besser verstehen“ könne.[75] Über die Südstaaten der USA schrieb A. Philip Randolph[76] 1943, dass diese Nazi-Deutschland in Sachen Rassismus in nichts nachstünden. Es gäbe „keinen Unterschied zwischen Hitler aus Deutschland und [Gouverneur] Talmadge aus Georgia oder […] [Senator] Bilbo aus Mississippi.“[77] Der jüdische Theologe Richard L. Rubenstein stellte 1987 fest: „Die Verbindung zwischen den genozidalen Siedlergesellschaften des 18. und 19. Jahrhunderts und dem Völkermord des 20. Jahrhunderts lässt sich in Adolf Hitlers „Lebensraumprogramm“ erkennen.“[78] Er zog insbesondere eine Linie von der Ausrottung der nordamerikanischen Ureinwohner zur Vernichtungspolitik der Nazis in Osteuropa, wobei er die Faschisten, ähnlich wie Roy und Du Bois, als eine Art noch brutalere Weiterentwicklung der Kolonialisten betrachtete: „In Hitlers Augen waren die Slawen dazu bestimmt, die Indianer Europas zu werden. Sie sollten vertrieben, entwurzelt, versklavt und notfalls vernichtet werden, um Platz für Deutschlands Überbevölkerung zu schaffen. Anders als die früheren Kolonisatoren machte sich Hitler keine Illusionen über den Völkermord eines solchen Unterfangens.“[79] 1995 wies auch Mark Mazower auf den „Wilden Westen“ als Vorbild für den Krieg der Nazis im Osten hin.[80] Seine damals erhobene „Forderung nach einer genaueren Untersuchung der kolonialen Wurzeln der nationalsozialistischen Politik verhallte“ jedoch „weitgehend ungehört.“[81] Ward Churchill[82] argumentierte zwei Jahre später gegen die These der „Singularität“ des Holocaust. Dabei kritisierte er nicht nur, dass der Völkermord an den europäischen Juden den Völkermord an den Slawen im westlichen Bewusstsein überdecke, sondern setzte beide in eine Reihe von Genoziden.[83] Dabei zeigte er auch Parallelen zwischen der Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner, indem er etwa eine Linie vom Kriegsrecht in der ersten britischen Kolonie Nordamerikas 1610 über die „Manifest Destiny“-Ideologie während der Westexpansion der USA bis hin zu Hitlers „Lebensraum im Osten“ zog.[84] 2008 arbeiteten Hermann Ploppa und 2010 Domenico Losurdo[85] u. a. die aus den USA stammenden rassistischen Ideologeme heraus, die Einfluss auf die Nazi-Ideologie hatten, wozu nicht zuletzt die Termini „Untermensch“ und „Endlösung“ und die damit zusammenhängenden politischen Konzepte zählten.[86] 2017 folgte die Studie des US-Juristen James Whitman, die nachwies, wie stark die Nürnberger Rassengesetze von der rassistischen US-Gesetzgebung beeinflusst waren.[87]
Sven Lindqvists 1992 erstmals auf Englisch erschienener, international viel beachteter literarischer Streifzug durch die Geschichte der kolonialen Völkermorde führte ihn ebenfalls zum Massenmord der deutschen Faschisten. Er betont, dass der koloniale Genozid Ende des 19. Jahrhunderts quasi zur Norm gehörte:
„Die Luft, die [der junge Hitler] und alle anderen Menschen im Westen in seiner Kindheit atmeten, war erfüllt von der Überzeugung, dass Imperialismus ein biologisch notwendiger Prozess ist, der nach den Naturgesetzen zur unvermeidlichen Vernichtung der niederen Rassen führt. Es war eine Überzeugung, die bereits Millionen Menschenleben gekostet hatte, bevor Hitler sie zu seiner höchst persönlichen Überzeugung machte.“[88]
Und auch der Holocaust folgt ihm zufolge demselben Muster wie die kolonialen Genozide:
„Die Nazis steckten den Juden einen Stern an ihre Mäntel und pferchten sie in „Reservaten“ ein – genau wie die Indianer, die Hereros, die Buschmänner, die Amandabele und all die anderen […] Sie starben allein, sobald die Nahrungsmittelversorgung der Reservate unterbrochen wurde.“[89]
2001 erschien auf Französisch die Studie Weiße Barbarei von Rosa Amelia Plumelle-Uribe. Sie zieht eine Linie von der Vernichtung der Indigenen Amerikas über die Versklavung der Afrikaner bis hin zum deutschen Faschismus. Sie bleibt allerdings nicht 1945 stehen, sondern schreibt die Geschichte anhand des Rassismus in den USA und des Apartheidregimes in Südafrika weiter. Sie spricht von einer dem Kolonialismus entsprungenen „Kultur der Vernichtung“: „Die Vorstellung, es gäbe minderwertige Menschen, die ausgelöscht werden können, war im gesamten europäischen Kulturraum verbreitet.“[90] Daher habe der „Übergang von der „weißen“ zur „arischen Rasse“ […] die bequeme Gewissheit, die bis dorthin alle Weißen aus ihrer Zugehörigkeit zur Herrenrasse bezogen“, zwar erschüttert.[91] Sie sei aber dennoch anschlussfähig gewesen.
Eine weitere, allerdings bislang wenig beachtete Kontinuität zwischen Kolonialismus und Faschismus ist die personelle: Franco etwa stieg während seines Einsatzes gegen die Rif-Republik unter Abdel Krim zum jüngsten General Europas auf und setzte die dort gemachten Erfahrungen auch während des Spanischen Bürgerkriegs ein.[92] Auch General Pétain war ab 1921 als Oberbefehlshaber an diesem Kolonialkrieg beteiligt. Der bereits erwähnte Franz Ritter von Epp wiederum setzte seine in den Kolonialkriegen in China und Namibia erlangten Kenntnisse in Aufstandsbekämpfung 1919 bei der Zerschlagung der Münchner Räterepublik und 1920 bei der Vernichtung der Roten Ruhrarmee ein. Hermann Görings Vater war oberster Kolonialherr in Deutsch-Südwestafrika und der in Alexandria geborene Rudolf Heß stammte aus einer kolonialen Kaufmannsfamilie und verbrachte seine Kindheit unter deutschen Siedlern in Ägypten. Inwiefern sich derartige persönliche Hintergründe und Erfahrungen bei verschiedenen faschistischen Funktionären niederschlugen und ob es dabei Auffälligkeiten und Muster gibt, bedarf weiterer Forschung. Während Mazower bereits 1995 auf den kolonialen Hintergrund mancher NS-Mediziner aufmerksam machte,[93] erschien eine entsprechende Studie erst kürzlich.[94]
4. Kolonisierung Osteuropas
1957 behauptete der bereits 1929 der NSDAP beigetretene westdeutsche Historiker Walter Schlesinger in Bezug auf den Terminus der „ostdeutschen Kolonisation“: „Unsere östlichen Nachbarvölker hören den Ausdruck nicht gern, weil sie im Zeitalter des Kolonialismus und Antikolonialismus ihn als für sich herabsetzend empfinden.“[95] Darin wurde er noch 1981 von Wolfgang Wippermann[96] bestätigt.[97] Artur Weigandt schrieb dagegen 2023:
„Der moderne Antirassist geht zwar auf die Kolonisierung Afrikas ein. Auf den nationalsozialistischen Traum jedoch, auf den ,Fall Barbarossa‘, den Kampf um den ,Lebensraum im Osten‘, geht er nicht ein. Aber auch das war Kolonialisierung. Dafür starben Millionen Osteuropäer.“[98]
Tatsächlich fällt allerdings auf, dass im sowjetischen und auch im DDR-Diskurs von einem kolonialen Charakter des Krieges gegen die Sowjetunion kaum die Rede war. Zwar wurde der Große Vaterländische Krieg als ein patriotisches und klassenübergreifendes Unternehmen propagiert. Im Nachhinein jedoch wurde (wieder) der Widerspruch zwischen Imperialismus und Sozialismus als zentraler Grund und als Wesen dieses Krieges betont. Es war zwar stets von einem „Vernichtungs-“ oder „Ausrottungskrieg“ die Rede, aber eine Parallele zu den Völkermorden in den Kolonien wurde in der Regel nicht gezogen.
Dabei machte bereits 1936 der aus einer jüdischen Familie stammende deutsche Kommunist Albert Norden deutlich: „Hitlers erträumte Kolonien liegen nicht nur in Afrika, sondern in Europa selbst.“[99] Ende Oktober 1939 warfen die KPD, die KPÖ und die KPČS der deutschen Führung vor, den Völkern Österreichs und der Tschechoslowakei „jedes Recht geraubt“ zu haben, „sie national [zu] unterdrücken und […] sie wie Kolonialvölker aus[zu]plündern.“[100] 1962 stellte Kühne fest: „Die faschistischen Okkupanten praktizierten in vieler Hinsicht bis in Einzelheiten diejenigen Thesen, die das Kolonialpolitische Amt der NSDAP seit Jahren für die künftige „Eingeborenenpolitik“ in Übersee propagiert hatte.“[101]Drei Jahre später bemerkte auch der westdeutsche Historiker Andreas Hillgruber, dass den Plänen der Nazis zufolge die Sowjetunion
„nicht nur wie die übrigen Teile Kontinentaleuropas in eine enge Abhängigkeit von der deutschen Führungsmacht gebracht, sondern auf die Stufe von Kolonialgebieten (zur wirtschaftlichen Ausbeutung und zur Besiedlung) herabgedrückt werden“
sollte. „Damit wurde eine im Zeitalter des Imperialismus bisher auf überseeische Räume beschränkte machtpolitische Zielsetzung auf Europa übertragen.“[102]
Wie Jürgen Zimmerer feststellt, hat auch die Wissenschaft den Expansionismus Nazi-Deutschlands nach Osteuropa lange
„nicht unter dem Blickwinkel der Kolonialgeschichte betrachtet, sei es, weil man instinktiv Kolonialismus bestimmten geographischen Regionen außerhalb Europas zuordnet, sei es, weil man ein verfehltes Bild des Kolonialismus vor Augen hat.“[103]
Und das, obwohl, wie er und auch Losurdo herausstellten, Hitler persönlich sich immer wieder positiv auf das britische Kolonialreich in Indien und Afrika als Vorbild bezog[104] und nach dem Überfall auf die Sowjetunion den Vernichtungskrieg im Osten mit dem Ausrottungsfeldzug gegen die nordamerikanischen Ureinwohner verglich, wobei er die Slawen wiederholt als „Eingeborene“ bezeichnete.[105] Zudem soll er im Oktober 1942 explizit davon gesprochen haben, „dass Deutschlands Kolonien nicht mehr in Afrika, sondern im Osten lägen.“ Dieser Diskurs blieb nicht auf das Führerhauptquartier beschränkt, wie Karsten Linne berichtet:
„[I]mmer mehr verbreitete sich die Ansicht, dass die besetzten Ostgebiete das neue „deutsche Kolonialland“ seien. Der Gebrauch der Ausdrücke „Kolonien“, „Kolonialland“ und „kolonial“ für die besetzten Ostgebiete hatte 1942 offensichtlich dermaßen überhand genommen“ und zu Verwirrung geführt, dass der Stabschef des Kolonialpolitischen Amts der NSDAP für seinen Bereich anordnete, „sie auf die Kolonisation in tropischen und subtropischen Überseegebieten zu beschränken.“[106]
Eine wirkliche Auseinandersetzung mit Osteuropa als Objekt kolonialistischer Diskurse und kolonialer Unterwerfung im Allgemeinen und in Bezug auf den faschistischen Ostfeldzug im Besonderen, die auch teilweise die Form einer Debatte annahm, kam erst in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten allmählich auf.[107] Hervorzuheben ist hier einerseits Losurdo, durch dessen gesamtes Werk sich das Thema Kolonialismus hindurchzieht, und andererseits die Arbeit Zimmerers, der ursprünglich aus der Afrika-Geschichtswissenschaft kommt.
Zimmerer stellte die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen den Kolonialkriegen und dem Krieg in Osteuropa heraus: Vernichtungskrieg und Genozid, Rassismus und „Großraumpolitik mit der damit verbundenen „Ökonomie der Vernichtung“.“[108] Er bezieht sich in seiner Arbeit sowohl auf die Postcolonial Studies und die Siedlerkolonialismus-Forschung als auch auf die Forschung von Autoren, die als deren entschiedene Gegner auftreten, wie etwa Götz Aly und Saul Friedländer. Zugleich sind seine Beiträge wichtiger Teil und Bezugspunkt in einer politischen Debatte geworden, die von manchen bereits als „Neuer Historikerstreit“ bezeichnet wurde. Diese Auseinandersetzung nahm 2021 mit der Polemik des australischen Genozidforschers Dirk Moses gegen den „Neuen deutschen Katechismus“[109]Fahrt auf und spielte sich – von der politischen Linken in Deutschland weitgehend unbemerkt – zumeist in den Feuilletons deutscher Leitmedien ab.[110] Seit dem 7. Oktober 2023 ist diese Auseinandersetzung umso erbitterter geworden, als sie von staatlicher, medialer und institutioneller Seite zunehmend repressiv erstickt wird. Umso bemerkenswerter ist es, dass Zimmerers Buch von 2011 kürzlich als Open Access-Neuauflage erschienen ist. Ein Aufsatz aus diesem Buch über die „Geburt des „Ostlandes“ aus dem Geiste des Kolonialismus“ wurde zudem in dem 2024 veröffentlichten ersten deutschsprachigen Sammelband zum Konzept des Siedlerkolonialismus abgedruckt. Dieses wiederum soll laut den Herausgebern Ilan Pappe und Jürgen Mackert der „Ausklammerung siedlerkolonialer Theorie und Analysen aus dem wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs in Deutschland“ entgegenwirken und führt die besagte Ausklammerung klar auf die „Legitimation des siedlerkolonialen Apartheidstaates Israel“ sowie das bewusste Verschweigen der deutschen Kolonialgeschichte zurück.[111]
So wenig dieser „Neue Historikerstreit“ in der deutschen Linken Beachtung fand, so gründlich hat die bürgerliche Wissenschaft Losurdos Arbeit ignoriert. In Teilen der Linken dagegen genießt er heute einen gewissen Einfluss. Ob die Tatsache, dass Gerd Schumann dem „Generalplan Ost“ in seiner Einführung in das Thema Kolonialismus ein eigenes Kapitel gewidmet hat, auf Losurdo zurückzuführen ist, ist nicht klar – in der Literaturliste tauchen weder er noch Zimmerer auf. Jedenfalls fasst Schumann die Aussagen der beiden gut zusammen:
„Der Feldzug im Osten hatte die militärische Okkupation des gesamten europäisch-asiatischen Teils der Sowjetunion […] zum Ziel. Danach sollte eine auf totaler Unterjochung und Massenvernichtung basierende Kolonisierung umgesetzt werden: Der „Generalplan Ost“ sah in mehreren Varianten die Errichtung einer Siedlungskolonie unter rigoroser Anwendung der Nazi-Rassenpolitik vor.“[112]
5. Faschismus als Kolonialismus?
Die antirassistische und antikoloniale Literatur ist voll von Vergleichen zwischen Kolonialismus und Faschismus. Dabei gibt es selbstverständlich eine moralische Ebene, die vor allem auch daher rührt, dass der Terror der Nazis gerade auch von den Kolonialmächten bzw. dem politischen Westen als solcher anerkannt und verurteilt wurde. Hier setzt die Abwehr derer an, die sich vehement gegen eine welthistorische Kontextualisierung des Faschismus verschließen und jedem Ansatz, den Faschismus mit dem Kolonialismus in ein Verhältnis zu setzen, sofort die Relativierung der Nazi-Verbrechen vorhalten: Es gehe letztlich um „Opferkonkurrenz“.
Es gibt aber, das sollte der bisherige Text deutlich gemacht haben, auch eine analytische Ebene: Diese reicht, wie dargelegt, von der Offenlegung der kolonialistischen Wurzeln des Faschismus über die Darstellung der Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen den Kolonialverbrechen auf der einen und den Verbrechen der Faschisten in Afrika, West- und Osteuropa auf der anderen Seite bis hin zur Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern der Faschismus und der Kolonialismus von ihrem Wesen her verwandt oder gar identisch sind. Die letztgenannte Frage wurde meist gar nicht derart offen gestellt und häufig nur in Ansätzen beantwortet. Im Folgenden sollen Aussagen, die dahingehend verstanden werden können bzw. häufig so verstanden werden, auf ihren Gehalt geprüft werden.
In seinem bereits zitierten Buch von 1936 schrieb Padmore: „Soweit es die eingeborene Bevölkerung angeht, war Südafrika schon immer ein faschistischer Staat.“[113] Und auch in Kenia und Nigeria herrsche „Kolonialer Faschismus“.[114] Allerdings lässt er die Frage offen, ob in den drei genannten Ländern besonders brutale Kolonialregime herrschten oder ob er diesen Befund für auf alle Kolonien anwendbar hält. Im Jahr darauf zeigte auch Nehru in einer Rede in Solidarität mit der Spanischen Republik die Wesensverwandtschaft zwischen Kolonialismus und Faschismus auf: „Imperialismus und Faschismus sind im Wesentlichen eng verwandt und gehen ineinander über.“[115] In derselben Rede nannte er sie auch „Blutsbrüder“[116] und in einem anderen Text aus derselben Zeit bezeichnete er sie als „Zwillinge“.[117] „Manchmal“, so erklärte er weiter,
„hat der Imperialismus zwei Gesichter – ein nationales, das die Sprache der Demokratie spricht, und ein koloniales, das an Faschismus grenzt. Letzteres dominiert und bestimmt letztlich die Politik. So sehen wir, dass in Großbritannien, egal ob konservative, Labour- oder ‚nationale‘[118] Regierung jede Regierung in Indien eine faschistische Uniform trägt.“[119]
Allerdings spricht Nehru stets von „an faschistisch grenzen“ oder einer „Tendenz zum Faschismus“.[120] Der Kolonialismus ist bei ihm also eher faschistoid als faschistisch.
Gandhi dagegen schrieb 1941 in einem Brief an den Mitherausgeber der Indian Times: „Ich behaupte, dass wir in Indien eine hitlerische Herrschaft haben, auch wenn sie mit milderen Begriffen verschleiert wird.“[121] 1942/43 stellte der von Gandhi stark beeinflusste Randolph die schwarze Bevölkerung in den USA gemeinsam mit den Völkern Asiens und Afrikas den imperialistischen Nationen Europas und den USA gegenüber, machte deutlich, dass ein Sieg über die faschistische Achse diesen Völkern keine Freiheit bringen werde, und betonte, wie bereits erwähnt, den Rassismus, den die US-Südstaaten und Nazi-Deutschland gemein hätten.[122] Bei den hier geschilderten Aussagen Randolph schlägt sich bereits ein strategisches Verhältnis zum Faschismus nieder, das in dieser Arbeit, wie eingangs erwähnt, nicht untersucht werden kann. Hier sei lediglich darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen den Rassismus und Kolonialismus der nicht-faschistischen Mächte zwangsläufig eine andere Form annehmen bzw. zurückgestellt werden musste, wenn mit den liberalen Rassisten und Kolonialherren eine Allianz gegen den Faschismus geschlossen werden sollte. Umgekehrt ging eine Gleichsetzung von Faschismus und Kolonialismus in den 1930er und 1940er Jahren häufig, wenn auch nicht zwangsläufig, mit einer Kritik an solchen Allianzen einher.
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb Du Bois:
„Es gab keine Nazi-Gräueltaten – Konzentrationslager, massenhafte Verstümmelung und Mord, Schändung von Frauen oder grausame Entweihung der Kindheit –, die die christliche Zivilisation Europas nicht schon seit langem im Namen und zur Verteidigung einer überlegenen Rasse, die geboren wurde, um die Welt zu beherrschen, an farbigen Menschen in allen Teilen der Welt verübt hatte.“[123]
In sehr ähnlicher Weise heißt es in einem Text von Césaire aus dem Jahr 1948:
„Nazideutschland hat lediglich in kleinem Maßstab in Europa praktiziert, was die Westeuropäer Jahrhunderte lang gegenüber den Rassen praktiziert haben, die so mutig oder so unvorsichtig waren, ihnen über den Weg zu laufen.“[124]
In seinem Discours sur le Colonialisme hielt er den Europäern vor, dass sie Hitler vor allem „die Anwendung kolonialistischer Praktiken auf Europa, denen bisher nur die Araber Algeriens, die Kulis in Indien und die N*g*r Afrikas ausgesetzt waren“, nicht verziehen.[125] Memmi bezeichnete den Kolonialismus 1957 als eine „Spielart des Faschismus“, denn: „Was ist der Faschismus anderes als eine Staatsform der Unterdrückung zum Nutzen einiger weniger?“ Und er stellte fest, dass „der gesamte administrative und politische Apparat der Kolonie keinen anderen Zwecken“ als eben diesem diene.[126] In Frantz Fanons[127] Die Verdammten dieser Erde, das Ende 1961 erschien, fragte der Autor rhetorisch: „Aber was ist der Faschismus auf der Ebene des Individuums und des Völkerrechts anderes als der Kolonialismus innerhalb eines traditionell kolonialistischen Landes?“ Einige Seiten später heißt es: „Vor kurzem hat der Nazismus ganz Europa in eine Kolonie verwandelt.“[128] Bald nach dem Erscheinen von Fanons letztem Werk wies Kühne darauf hin, dass die deutschen Faschisten im Zweiten Weltkrieg „den unterworfenen Völkern Europas das gleiche Schicksal zugedacht hatten wie den Völkern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.“[129] Und Hildebrand charakterisierte 1969 das Programm Hitlers als ein Unternehmen, „Europa, die Wiege des Kolonialismus, mit Kolonialmethoden zu reorganisieren.“[130] Auch Plumelle-Uribe spricht von „Hitlers Anspruch, Europa selbst zu kolonisieren“.[131]
Padmore, Du Bois, Césaire, Memmi, Fanon, Kühne, Hildebrand und Plumelle-Uribe schreiben übereinstimmend explizit, dass der (deutsche) Faschismus letztlich koloniale Herrschaftsmethoden auf Europa angewandt habe. Auffällig ist dabei, dass nicht nur Césaire und Fanon in ihren politischen Essays, sondern auch die beiden Historiker Kühne und Hildebrand – im Gegensatz etwa zu Hillgruber – in ihren Formulierungen stark verallgemeinern, insofern sie von „Europa“ sprechen: Denn auch wenn das faschistische Deutschland letztlich fast ganz Europa besetzt hat, so waren Krieg und Okkupation im Westen doch ganz anders als im Osten: Im Westen waren beide „zivilisiert“ und lediglich Juden, Widerstandskämpfer und afrikanische Soldaten fielen Massakern der Faschisten zum Opfer. Der Ostfeldzug war, wie oben beschrieben, von Anfang an ein Ausrottungsfeldzug gegen die breite Bevölkerung. Zudem ist Hildebrands Rede von der „Wiege des Kolonialismus“ möglicherweise auf das Zarenreich, aber in keiner Weise auf die Sowjetunion anwendbar. Allerdings ließe sich wiederum argumentieren, dass Kolonialismus nicht zwangsläufig zum Völkermord ausartet. Ebenfalls als kolonial bezeichnet werden können etwa die ökonomische Ausbeutung der besetzten Gebiete im Westen durch Plünderungen im großen Stil, durch die Abgabe einer Art von „Schutzgeld“, durch die Degradierung zum billigen Lieferanten von Rohstoffen und Lebensmitteln inklusive eines formalisierten ungleichen Tauschs und nicht zuletzt durch das Einziehen von Millionen Zwangsarbeitern.[132] Zudem wurde nach dem Überfall auf die Sowjetunion auch im Westen die Besatzung repressiver und brutaler und steigerte sich mit jeder Niederlage zusehends.[133] Es gab jedoch keinen Rassismus gegen die Mehrheitsbevölkerung im Westen, der annähernd mit dem Antisemitismus, dem anti-slawischen Rassismus oder dem Kolonialrassismus vergleichbar gewesen wäre.
Daneben ähneln sich die Argumentationen Padmores, Césaire und Memmis in besonderer Weise, da sie nicht nur davon ausgehen, dass faschistische Ideologie und Herrschaftsform bereits lange in den Kolonien existierten, sondern alle drei gingen, von einem Rückwirken des Faschismus in den Kolonien auf die Metropolen aus. Fanon, der zumindest Césaires Text kannte, scheint sich für diesen Aspekt wenig interessiert zu haben. Er kritisierte bereits 1957 die Debatte in Frankreich darüber, „dass gegenwärtig in Algerien eine umfassende Enthumanisierung der französischen Jugend vor sich geht“ und „dass die französischen Wehrpflichtigen „dort den Faschismus erlernen““ als „Perversion der Moral“, weil „sich diese Humanisten nur für die moralischen Auswirkungen dieser Verbrechen auf die Seele der Franzosen interessieren.“[134]
1975 erschien mit der Dissertation von Peter Schmitt-Egner eine ideologiekritische Untersuchung über die kolonialen Ursprünge des Faschismus. Der Autor hat dabei den Versuch unternommen, das Phänomen des Rassismus als eine Form von falschem Bewusstsein direkt aus der kapitalistischen Produktionsweise abzuleiten,[135] in diesem Fall konkret aus den speziellen Produktionsverhältnissen in den Kolonien sowie dem ungleichen Tausch zwischen Kolonien und Metropolen. Einleitend stellt er fest, dass in der Kolonialideologie „schon alle entscheidenden Elemente der späteren faschistischen Ideologie ausgebildet“ seien.[136] Auch bezieht er sich eingangs neben Arendt u. a. auf Césaire und Fanon, bezeichnet den Kolonialismus zum Ende hin wiederholt als „Faschismus an der Peripherie“[137] und in einem weiteren Aufsatz beide als „Pendants“ zueinander.[138] Als soziale Träger des Rassismus in den Kolonien benennt Schmitt-Egner in erster Linie die kleinkapitalistischen und kleinbürgerlichen sowie die proletarischen und subproletarischen Siedler.[139] Ohne es explizit zu sagen, liegt für ihn darin wohl eine wesentliche Parallele zum Faschismus. Die eliminatorische Seite des Kolonialrassismus führt er ebenfalls auf die kapitalistische Verwertungslogik zurück:
„Denn wie steht es mit denjenigen Völkern, die „nicht zu gebrauchen“ und der Entfaltung des Kolonialsystems hinderlich sind, deren Arbeitskraft keinen „Wert“ darstellt, also auch nicht unter dem Wert gekauft werden kann, weil sie sich nicht einmal von ihren Produktionsmitteln trennen können oder ihre alten sozialen Organisationen die Umwandlung zum Lohnarbeiter nur in langen Zeiträumen zuläßt? Die Kolonialgeschichte gibt uns empirisch die Antwort: sie heißt Ausrottung, im besten Fall Zuweisung von Reservaten, die dann den Prozeß der „Erziehung zur Arbeit“ gewähren sollen.“[140]
Zudem beschreibt er die „innere Verwandtschaft“ zwischen der „kleinbürgerlichen Kolonialideologie als Siedlungsideologie“ und dem Antisemitismus in den Metropolen: In beiden Fällen gehe es um das „Primat der Arbeit“ – im Fall der Kolonien um die Arbeit der kleinen und mittleren Bauern – „gegenüber dem Kapital“, und zwar dem unproduktiven, als „raffend“ wahrgenommenen Bankkapital.[141] Es dürfte wohl an der – noch dazu extrem abstrakten – Theorielastigkeit von Schmitt-Egner Arbeit liegen, dass sie bis heute keine nennenswerte Beachtung gefunden hat.
Keiner der hier angeführten Autoren hat je behauptet, dass sich eine Analyse des Faschismus darin erschöpfen würde, ihn als eine Übertragung des Kolonialismus auf Europa zu begreifen. Zumal, wie wir wissen, die faschistische Herrschaftspraxis konkret von Land zu Land so stark differenzieren konnte wie die koloniale Herrschaft in den verschiedenen Kolonien. Häufig ging es den Autoren auch gar nicht so sehr darum, den Faschismus zu erfassen, als vielmehr umgekehrt den Kolonialismus als ein seinem Wesen nach faschistisches System zu entlarven. Den Einfluss des Kolonialismus auf die Metropole selber haben lediglich Nehru und Padmore angesichts des in Europa in den 1930er Jahren aufsteigenden Faschismus sowie Césaire und Memmi vor dem Hintergrund des Algerienkrieges und dessen Auswirkungen auf Frankreich in den Blick genommen. Letztlich geht der Ansatz, den Faschismus als auf die Metropolen angewandte kolonialistische Herrschaftsform zu betrachten, nicht weit über die historische Kontextualisierung des Faschismus als ein Produkt imperialistischer und kolonialistischer Gesellschaf, und über die Erkenntnis, dass insbesondere die deutschen Faschisten koloniale Methoden in Europa angewandt haben hinaus.
Anders sieht es aus, wenn man den Blick auf die Kolonien richtet und dort von einer letztlich faschistischen Herrschaft ausgeht. Denn dann drängt sich sofort Nehrus Erkenntnis auf, dass in Bezug auf die Kolonien alle bürgerlichen Parteien Faschisten sind – ob nun Konservative oder Sozialdemokraten. Diese Annahme sollte man nicht idealistisch missverstehen, also dahingehend, dass sie von einem „Blickwinkel“ abhängt. Vielmehr geht es ganz materialistisch um ein objektives Verhältnis, das diese politischen Akteure einnehmen. Insofern ist diese Erkenntnis eine Bereicherung für das Verständnis des dialektischen Verhältnisses zwischen Liberalismus und Faschismus als zwei Formen bürgerlicher Herrschaft, die sich zwar qualitativ unterscheiden und deren Vertreter durchaus im politischen Gegensatz zueinander stehen können, die aber eben zwei Seiten einer Medaille sind und sich in der Realität ergänzen und häufig ineinander übergehen.
Dabei führt die These vom Kolonialismus als Faschismus eine räumliche Kategorie ein: Die bürgerliche Herrschaft kann in der Metropole liberal auftreten, während sie in der Peripherie faschistisch herrscht. Für dieses Verhältnis zwischen dem Westen und dem Trikont hat Losurdo – auch wenn er nicht von Faschismus spricht – den sich ursprünglich auf die Zustände in den USA beziehenden Begriff der „Herrenvolk-Demokratie“ geprägt.[142] Aus dieser Erkenntnis wiederum entspringen allerdings neue Fragen: Etwa die, ob es „bessere“ oder „schlechtere“ Kolonialherren, also „bessere“ oder „schlechtere“ Faschisten gibt. Diese Frage ist hochaktuell, wenn man nach Palästina blickt. Schließlich waren es die sozialdemokratischen Zionisten mit Ben Gurion an der Spitze, die während der Nakba 1947-49 Palästina von 800.000 Indigenen „säuberten“, die 1956 Ägypten überfielen und 1967 die arabischen Nachbarländer angriffen, ganz Palästina besetzten und erneut Hunderttausende Palästinenser vertrieben. Wenn also über einen drohenden Faschismus in Israel gesprochen wird, sollte bedacht werden, dass man auch argumentieren könnte, dass in Palästina bereits seit 1948 Faschismus herrscht. Zudem eröffnet die Perspektive des Kolonialismus als Faschismus bzw. der Unterstützung einer Kolonialmacht als eine (pro-)faschistische Außenpolitik einen eigenen Zugang zur Frage des „exportierten Faschismus“.
[1] Santarelli, Enzo: „The Ideology of the Libyan ‚Reconquest‘ (1922-1931)“. In: Santarelli, Enzo u. a. (Hrsg.): „Omar al-Mukhtar. The Italian Reconquest of Libya“, Darf Publishers, London 1986, S. 17. Vgl. Nagiah, Abdulhakim: „Italien und Libyen in der Kolonialzeit. Faschistische Herrschaft und nationaler Widerstand“. In: Frank, Sabine (Hrsg.); Kamp, Martina (Hrsg.): „Libyen im 20. Jahrhundert. Zwischen Fremdherrschaft und nationaler Selbstbestimmung“, Deutsches Orient-Institut, Hamburg 1995, S. 72f.
[2] Vgl. Künzi, Giulia Brogini: „Italien und der Abessinienkrieg 1935/36. Kolonialkrieg oder Totaler Krieg?“ Schöningh-Verlag, Paderborn 2006, S. 149f.
[3] Vgl. Ahmida, Ali Abdullatif: „Genocide in Libya. Shar, a Hidden Colonial History“, Routledge Press, London/New York 2021, S. 90.
[4] Vgl. Bernhard, Patrick: „Im Rücken Rommels. Kriegsverbrechen, koloniale Massengewalt und Judenverfolgung in Nordafrika, 1940-1943“, Autorenversion, 2019, S. 12-16.
[5] Vgl. Künzi, Giulia Brogini: „Der Wunsch nach einem blitzschnellen und sauberen Krieg. Die italienische Armee in Ostafrika (1935/36)“. In: Klein, Thoralf (Hrsg.); Schumacher, Frank (Hrsg.): Kolonialkriege. Militärische Gewalt im Zeichen des Imperialismus, S. 289.
[6] Ebd. S. 283.
[7] Feldbauer (*1933) ist Historiker mit Schwerpunkt Italien und Vietnam. In den 1980er Jahren war er Diplomat der DDR in Algerien und im Kongo.
[8] Feldbauer, Gerhard: „Mussolinis Überfall auf Äthiopien. Eine Aggression am Vorabend des Zweiten Weltkriegs“, Pahl-Rugenstein Verlag, Bonn 2006, S. 54.
[9] Vgl. Linne, Karsten: „Deutschland jenseits des Äquators? Die NS-Kolonialplanungen für Afrika“, Ch. Links Verlag, Berlin 2008, S. 29.
[10] Vgl. Gründer, Horst (Hrsg.): „„…da und dort ein junges Deutschland gründen“. Rassismus, Kolonien und kolonialer Gedanke vom 16. bis zum 20. Jahrhundert“, dtv, München 1999, S. 218. Vgl. Ballhaus, Johanna: „Kolonialziele und -vorbereitungen des faschistischen Regimes 1933-1939“. In: Stoecker, Helmuth (Hrsg.): „Drang nach Afrika. Die koloniale Expansionspolitik und Herrschaft des deutschen Imperialismus in Afrika von den Anfängen bis zum Ende des zweiten Weltkrieges“, Akademie-Verlag, Berlin, 1977, S. 281-91.
[11] Richtlinien des Kolonialpolitischen Amtes der NSDAP von 1937, zitiert nach Koop, Volker: „Hitlers Griff nach Afrika. Kolonialpolitik im Dritten Reich, Dietz Verlag, Bonn 2018, S. 72.
[12] Vgl. Hildebrand, Klaus: „Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage 1919-1945“, Wilhelm Fink Verlag, München 1969, S. 700.
[13] Bernhard, Patrick: „Die „Kolonialachse“. Der NS-Staat und Italienisch-Afrika 1935 bis 1943“. In: Klinkhammer, Lutz (Hrsg.); Guerrazzi, Amedeo Osti (Hrsg.); Schlemmer, Thomas (Hrsg.): „Die Achse im Krieg 1939-1945. Politik, Ideologie und Kriegführung 1939-1945“, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2010, S. 148-60.
[14] Vgl. Eichholtz, Dietrich: „Das Expansionsprogramm des deutschen Finanzkapitals am Vorabend des zweiten Weltkrieges“. In: Eichholtz, Dietrich (Hrsg.); Pätzold, Kurt (Hrsg.): „Der Weg in den Krieg. Studien zur Geschichte der Vorkriegsjahre (1935/36 bis 1939)“, Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 1989, S. 28.
[15] Vgl. Ndumbe III., Kum’a: „Was wollte Hitler in Afrika? NS-Planungen für eine faschistische Neugestaltung Afrikas“, Verlag für Interkulturelle Kommunikation, Frankfurt am Main 1993, S. 240.
[16] Vgl. ebd. S. 50-57, 61.
[17] Vgl. „Kriegszieldenkschrift des Reichskanzlers Theobald von Bethmann-Hollweg vom 9. September 1914 (Auszüge)“. In: Kühnl, Reinhard (Hrsg.): „Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten“, PapyRossa-Verlag, Köln 2000, S. 23.
[18] Vgl. Loth, Heinrich: „Geschichte Afrikas. Von den Anfängen bis zur Gegenwart Band 2. Afrika unter imperialistischer Kolonialherrschaft und die Formierung der antikolonialen Kräfte 1884-1945“, Akademie-Verlag, Berlin 1976, S. 237-40. Vgl. Autorenkollektiv: „Konzept für die „Neuordnung“ der Welt. Die Kriegsziele des faschistischen deutschen Imperialismus im zweiten Weltkrieg“, Dietz Verlag, Berlin 1977, S. 44.
[19] Vgl. Wystrychowski, Leon: „Die Rolle und Bedeutung der französischen Afrika-Kolonien für die deutsche Kriegswirtschaft 1940-44“ (Master-Arbeit), Bochum 2024, S. 51-79.
[20] So eine undatierte Einschätzung der SS, zitiert nach Koop: „Griff nach Afrika“, S. 139.
[21] Vgl. Linne: „Jenseits des Äquators“, S. 38-42.
[22] Vgl. Eichholtz, Dietrich: „Krieg um Öl. Ein Erdölimperium als deutsches Kriegsziel (1938-1943)“, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, S. 53-59.
[23] Ebd. S. 54.
[24] Padmore (1902-59) war Sozialist und Vorkämpfer des Panafrikanismus. 1928-34 war er Mitglied der Kommunistische Partei der USA bzw. der KPdSU, zwischenzeitlich aktiv in der Antiimperialistischen Liga und als Leiter des Negro Bureau der Roten Gewerkschaftsinternationale. Später war er als Berater Kwame Nkrumah tätig.
[25] Padmore, George: „How Britain rules in Africa“, Negro University Press, New York 1969, S. 4.
[26] Manabendra Nath Roy (1887-1954) stammte aus Bangladesh und war an der Gründung der Sozialistischen Partei (1917) und der Kommunistischen Partei Mexikos (1919) sowie der Kommunistischen Partei Indiens (1920) beteiligt. In den 1920ern brach er mit der kommunistischen Bewegung und begründete in den 1930er Jahren den „Radikalen Humanismus“. Unter Kommunisten ist er vor allem für seine Kritik an Lenins Entwurf zur nationalen und kolonialen Frage für den Zweiten Weltkongress der Komintern 1920 bekannt.
[27] Vgl. Roy, Manabendra Nath: „Fascism. Its Philosophy, Professions, and Practice“, D. M. Library, Kalkutta 1938, S. 148.
[28] Vgl. ebd. S. 147-51.
[29] Ebd. S. 73.
[30] Ebd. S. 45.
[31] Vgl. Cao-Van-Hoa, Edmond: „„Der Feind meines Feindes …“. Darstellungen des nationalsozialistischen Deutschland in ägyptischen Schriften“, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1990, S. 68, 81, 83-85, 87-89, 161f., 167. Vgl. Gershoni, Israel; Nordbruch, Götz: „Sympathie und Schrecken. Begegnungen mit Faschismus und Nationalsozialismus in Ägypten, 1922-1937“, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2011, S. 53-56, 110, 119f., 124f., 131, 135, 137-39, 141-45, 147, 149-54, 157-59, 183-245. Vgl. Schumann, Christoph: „Symbolische Aneignungen. Anṭūn Saʿādas Radikalnationalismus in der Epoche des Faschismus“. In: Höpp, Gerhard (Hrsg.); Wien, Peter (Hrsg.); Wildangel, René (Hrsg.): „Blind für die Geschichte? Arabische Begegnungen mit dem Nationalsozialismus“, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2004, S. 157-80. Vgl. Wildangel, René: „Zwischen Achse und Mandatsmacht. Palästina und der Nationalsozialismus“, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2007, S. 151-54.
[32] Zitiert nach Wildangel: „Feind der Menschheit“, S. 148.
[33] Kühne, Horst: „Die faschistische Rassentheorie im Dienst der Kolonialpolitik des deutschen Imperialismus“. In: Göschler, Henry (Hrsg.): „Rassen, Rassen„theorie“ und imperialistische Politik. Fünf Beiträge zur Kritik der Rassen„theorie“, Dietz Verlag, Berlin 1961. Ders.: „Faschistische Kolonialideologie und zweiter Weltkrieg“, Dietz Verlag, Berlin 1962.
[34] Schmelzer, Janis: „IG-Farben stossen nach Afrika. Zur Kolonialgeschichte und kolonialen Tradition der IG-Farben-Nachfolgegesellschaften“, VEB Filmfabrik Wolfen, Bitterfeld/Wolfen 1965. Groehler, Olaf: „Kolonialforderungen als Teil der faschistischen Kriegszielplanung“. In: Zeitschrift für Militärgeschichte 5/1965, S. 547-62.
[35] Weinberg, Gerhard L.: „German Colonial Plans and Policies, 1938-1942“. In: „Geschichte und Gegenwartsbewusstsein. Festschrift für Hans Rothfels“, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963, S. 462-91. Schmokel, Wolfe W.: „Der Traum vom Reich. Der deutsche Kolonialismus von 1919-1945“, Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh 1967. Hildebrand: „Weltreich“.
[36] Loth: „Geschichte Afrikas“. Rathmann, Lothar u. a. : „Geschichte der Araber. Von den Anfängen bis zur Gegenwart Band 3 und 4. Die arabische Befreiungsbewegung im Kampf gegen die imperialistische Kolonialherrschaft (1917-1945), Akademie-Verlag, Berlin 1974.
[37] Ndumbe III.: „Hitler in Afrika“.
[38] Vgl. Hildebrand: „Weltreich“, S. 767-75. Vgl. Linne: „Jenseits des Äquators“, S. 165-68.
[39] Vgl. Eichholtz: „Expansionsprogramm“, S. 28. Ders.: „Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945 Band 2“, Saur Verlag, München 1999, S. 449. Hass, Gerhart; Greiser, Ingeborg: „Zweiter Weltkrieg“. In: Berthold, Werner u. a. (Hrsg.): Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Handbuch, Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 1977, S. 355.
[40] Ndumbe III.: „Hitler in Afrika“, S. 32.
[41] Ebd. S. 140-56.
[42] Vgl. Kühne: „Faschistische Kolonialideologie“, S. S. 37-40, 42-46, 50-54.
[43] Filippi, Francesco: „„Aber wir haben ihnen doch Straßen gebaut!“ Das italienische Kolonialreich: Terror, Lügen und Vergessen“, Verlag Edition AV, Bodenburg 2024, S. 11.
[44] Vgl. ebd. S. 21, 27, 37f., 43-48, 52, 67-69.
[45] Vgl. Schneider, Gabriele: „Mussolini in Afrika. Die faschistische Rassenpolitik in den italienischen Kolonien 1936-1941, SH-Verlag, Köln 2000, S. 11,
[46] Ebd. S. 270.
[47] Tillmann, Heinz: „Deutschlands Araberpolitik im zweiten Weltkrieg“, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1965.
[48] Zu nennen sind insbesondere: Achcar, Gilbert: „Die Araber und der Holocaust. Der arabisch-israelische Krieg der Geschichtsschreibungen“, Nautilus Verlag 2012. Cao-Van-Hoa: „Der Feind meines Feindes“. Gershoni; Nordbruch: „Sympathie und Schrecken“. Höpp; Wien; Wildangel: „Blind?“. Motadel, David: Für Prophet und Führer. Die Islamische Welt und das Dritte Reich, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2017. Wagenhofer, Sophie: „„Rassischer“ Feind – politischer Freund? Inszenierung und Instrumentalisierung des Araberbildes im nationalsozialistischen Deutschland“, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2010. Wildangel: „Achse und Mandatsmacht“.
[49] Vgl. Cao-Van-Hoa: „Feind meines Feindes“, S. 162. Vgl. Gershoni, Israel: „„Der verfolgte Jude“. Al-Hilals Reaktionen auf den Antisemitismus in Europa und Hitlers Machtergreifung“. In: Höpp; Wien; Wildangel: „Blind?“, S. 68f. Vgl. Wildangel, René: „„Der größte Feind der Menschheit“. Der Nationalsozialismus in der arabischen öffentlichen Meinung in Palästina während des Zweiten Weltkrieges“. In: Höpp: „Blind?“, S. 123.
[50] Motadel: „Prophet und Führer“, S. 135.
[51] Petke, Stefan: „Muslime in der Wehrmacht und Waffen-SS. Rekrutierung, Ausbildung, Einsatz“, Metropol Verlag, Berlin 2016, S. 481.
[52] Roy: „Fascism“, S. 45.
[53] William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963) war ein schwarzer US-amerikanischer Historiker und Soziologe, Mitbegründer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und des Panafrikanismus. Außerdem galt er ab den 1920er Jahren als Bewunderer der Sowjetunion, hatte enge Kontakte zur Kommunistischen Partei der USA und trat ihr 1961 auch bei.
[54] Du Bois, W. E. B.: „Writing“, The Library of America, New York 1986, S. 1243.
[55] Vgl. Losurdo, Domenico: „Der westliche Marxismus. Wie er entstand, verschied und auferstehen könnte“, PapyRossa Verlag, Köln 2021, S. 147-50, 158
[56] Arendt, Hannah: „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft Band 2. Imperialismus“, Ullstein Verlag, Frankfurt am Main 1975, S. 18.
[57] Ebd. S. 69.
[58] Ebd. S. 65.
[59] Ebd. S. 159.
[60] Ebd. S. 192.
[61] Ebd. S. 105.
[62] Siehe Losurdo: „Westlicher Marxismus“, S. 150-69.
[63] Vgl. Padmore: „How Britain rules in Africa“, Negro University Press, New York 1969, S. 74, 129f.
[64] Ebd. S. 4.
[65] Nehru, Jawaharlal: „Eighteen Month in India, 1936-1937. Being Further Essays and Writings“, Kitabistan, Allahabad 1938, S. 125/131. 1938 erschien bereits eine Zweitauflage des Buchs mit abweichender Seitennummerierung, daher werden hier jeweils beide angeführt.
[66] Césaire (1913-2008) stammte aus der französischen Karibik-Kolonie Martinique und war Schriftsteller und Politiker und einer der Begründer der „Négritude“. 1945-55 war er aktives Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs.
[67] Césaire, Aimé: „Über den Kolonialismus“, Wagenbach Verlag, Westberlin 1968, S. 12.
[68] Arendt: „Elemente und Ursprünge“, S. 7.
[69] Ebd. S. 158.
[70] Memmi (1920-2020) war ein tunesischer jüdischer Soziologe. Er war in der tunesischen Unabhängigkeitsbewegung engagiert und beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit Rassismus und Kolonialismus.
[71] Memmi, Albert: „Der Kolonisator und der Kolonisierte. Zwei Porträts“, Syndikat Verlag, Frankfurt am Main 1980, S. 67.
[72] Cyril Lionel Robert James (1901-89) war ein aus Trinidad stammender Schriftsteller, Kulturtheoretiker und Trotzkist. Seine Arbeiten waren zentral für die afro-karibische politische Theorie und Kultur. Sein Buch Die schwarzen Jakobiner wurde 1984 in der DDR verlegt.
[73] Die Erstauflage erschien 1938 und soll bereits Verbindungen zwischen Kolonialismus und Faschismus aufgezeigt haben. (Vgl. James, C. L. R.: „Die schwarzen Jakobiner. Toussaint Louverture und die Haitianische Revolution“, Dietz Verlag, Berlin 2022, S. 16.) Für diesen Aufsatz konnten aber nur die 1963 von James selbst überarbeitete und aktualisierte Neuauflage und deren beiden deutsche Übersetzungen herangezogen werden.
[74] James, C. L. R.: „Die schwarzen Jakobiner. Toussaint L’Ouverture und die Unabhängigkeitsrevolution in Haiti“, Pahl-Rugenstein, Köln 1984, S. 54f. Zensur durch L. W.
[75] Ebd. S. 53.
[76] Asa Philip Randolph (1889-1979) war ein schwarzer US-amerikanischer Sozialist, Gewerkschafter, Bürgerrechtsaktivist und Bewunderer Gandhis.
[77] Zitiert nach Kapur, Sudarshan: „Raising up a Prophet. The African-American encounter with Gandhi“, Beacon Press, Boston 1992, S. 112.
[78] Vgl. Rubenstein, Richard L.: „Afterword: Genocide and Civilization“. In: Wallimann, Isidor (Hrsg.); Dobkowski, Michael (Hrsg.): „Genocide and the Modern Age. Etiology and Case Studies of Mass Death“, Green Wood Press, New York/Westport/London 1987, S. 287f.
[79] Ebd. S. 288.
[80] Vgl. Mazower, Mark: „After Lemkin. Genocide, the Holocaust and History“. In: The Jewish Quarterly 5, 1995, S. 7.
[81] Zimmerer, Jürgen: „Von Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust“, LIT-Verlag, Berlin/Münster 2011, S. 140.
[82] Churchill (*1943) lehrte bis 2007 Ethnic Studies an der Universität vonColorado und war lange in der indigenen Bürgerrechtsbewegung in den USA engagiert.
[83] Vgl. Churchill, Ward: „A little Matter of Genocide. Holocaust and Denial in the Americas 1492 to the Present“, City Lighters Publishers, San Francisco 1997.
[84] Vgl. ebd. S. 147.
[85] Losurdo (1941-2018) war ein italienischer kommunistischer Historiker und Philosoph. Einer seiner Schwerpunkte lag auf der Geschichte des Antikolonialismus im 20. Jahrhundert in Verbindung mit der kommunistischen Weltbewegung.
[86] Vgl. Losurdo, Domenico: „Die Deutschen. Sonderweg eines unverbesserlichen Volkes?“, Kai Homilius Verlag, Berlin 2010, S. 38-59. Vgl. Ploppa, Hermann: „Hitlers amerikanische Lehrer. Die Eliten der USA als Geburtshelfer des Nationalsozialismus“, Liepsen Verlag, Steure 2008, S. 25-117, 167-284.
[87] Whitman, James Q.: „Hitlers amerikanisches Vorbild. Wie die USA die Rasengesetze der Nationalsozialisten inspirierten“, C. H. Beck Verlag, München 2018.
[88] Lindqvist, Sven: „Exterminate all the Brutes“, The New Press, New York 1996, S. 141.
[89] Ebd. S. 160.
[90] Plumelle-Uribe, Rosa Amelia: „Weiße Barbarei. Vom Kolonialrassismus zur Rassenpolitik der Nazis“, Rotpunkt Verlag 2004, S. 17f.
[91] Ebd. S. 168f.
[92] Vgl. Kunz, Rudibert; Müller, Rolf-Dieter: „Giftgas gegen Abd el Krim. Deutschland, Spanien und Marokko und der Gaskrieg in Spanisch-Marokko 1922-1927“, Rombach Verlag, Freiburg 1990, S. 32-34.
[93] Vgl. Mazower: „After Lemkin“, S. 6f.
[94] Elsner, Gine: „Freikorps, Korporationen und Kolonialismus. Die soziale Herkunft von Nazi-Ärzte“, VSA Verlag, Hamburg 2024.
[95] Schlesinger, Walter: „Die geschichtliche Stellung der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung“. In: Historische Zeitschrift 183, 1957, S. 520.
[96] Wippermann (1945-2021) war ein Historiker, Faschismusforscher und Schüler Ernst Noltes. Er galt u. a. als linker Kritiker der „Totalitarismus“-Doktrin.
[97] Vgl. Wippermann, Wolfgang: „Der ‚deutsche Drang nach Osten‘. Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981, S. 130.
[98] Weigandt, Artur: „Die Verräter“, Hanser Verlag, Berlin 2023, S. 78f.
[99] Zitiert nach Kühne: „Faschistische Kolonialideologie“, S. 40.
[100] Zitiert nach Bayerlein, Bernhard H.: „„Der Verräter, Stalin, bist Du!“ Vom Ende der linken Solidarität: Komintern und kommunistische Parteien im Zweiten Weltkrieg 1939-1941“, Aufbau Verlag, Berlin 2008, S. 185.
[101] Kühne: „Faschistische Kolonialideologie“, S. 40.
[102] Hillgruber, Andreas: „Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940-1941“, Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main 1965, S. 567.
[103] Zimmerer: „Von Windhuk nach Auschwitz“, S. 140.
[104] Vgl. Losurdo, Domenico: „Kampf um die Geschichte. Der historische Revisionismus und seine Mythen“, PapyRossa Verlag, Köln 2007, S. 134. Vgl. Zimmerer: „Von Windhuk nach Auschwitz“, S. 140.
[105] Vgl. Losurdo, Domenico: „Stalin und Hitler. Zwillingsbrüder oder Todfeinde?“ In: Koch, Christoph (Hrsg.): „Gab es einen Stalin-Hitler-Pakt? Charakter, Bedeutung und Deutung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages vom 23. August 1939“, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2015, S. 22.
[106] Linne: „Jenseits des Äquators“, S. 148.
[107] Vgl. Panagiotidis, Jannis; Petersen, Hans-Christian: „Antiosteuropäischer Rassismus in Deutschland. Geschichte und Gegenwart“, Beltz Juventa Verlag, Weinheim 2024, S. 18-20. Vgl. Zimmerer: „Von Windhuk nach Auschwitz“, S. 141f.
[108] Ebd. S. 147.
[109] Moses, A. Dirk: „Der Katechismus der Deutschen“, 2021, Online: www.geschichtedergegenwart.ch/der-katechismus-der-deutschen (zuletzt eingesehen am 5.5.2025).
[110] Vgl. Wystrychowski, Leon: „Der „Katechismus“-Streit: Politischer Kontext und (geschichts)wissenschaftliche Verantwortung“, 2023, Online: www.etosmedia.de/politik/der-katechismus-streit-politischer-kontext-und-geschichtswissenschaftliche-verantwortung(zuletzt eingesehen am 5.5.2025).
[111] Mackert, Jürgen (Hrsg.); Pappe, Ilan (Hrsg.): „Siedlerkolonialismus. Grundlagentexte des Paradigmas und aktuelle Analysen“, Nomos Verlag, Baden-Baden 2024, S. 5f.
[112] Schumann, Gerd: „Kolonialismus“, PapyRossa Verlag, Köln 2016, S. 70.
[113] Padmore: „How Britain rules“, S. 192.
[114] Ebd. S. 125, 129, 322.
[115] Nehru: „Eighteen Month“, S. 124/130.
[116] Ebd. S. 123/129.
[117] Ebd. S. 204/216.
[118] Gemeint sind die „große Koalitionen“ in Großbritannien 1931-40.
[119] Nehru: „Eighteen Month“, S. 124/130.
[120] Ebd.
[121] Gandhi, Mahatma: „Collected Works Band 74“, Navajivan Press, Ahmedabad 1978, S. 17.
[122] Vgl. Kapur: „Raising up a Prophet“, S. 107-09, 112.
[123] Du Bois, W. E. B.: „ The World and Africa. An Inquiry into the Part which Africa has played in World History“, International Publishers, New York 1975, S. 23.
[124] Zitiert nach Plumelle-Uribe: „Weiße Barbarei“, S. 316f.
[125] Césaire: „Über den Kolonialismus“, S. 12. Zensur durch den Autor.
[126] Memmi: „Der Kolonisator und der Kolonisierte“, S. 67.
[127] Fanon (1925-61) war Psychiater und gilt als einer der wichtigsten Theoretiker der antikolonialen Befreiung. Er stammte wie Césaire von Martinique und studierte auch bei ihm. 1953 ging er nach Algerien und schloss sich dort später der Befreiungsbewegung an.
[128] Fanon, Franz: „Die Verdammten dieser Erde“, Rowohlt Verlag, 1971, S. 69 Fußnote 8, S. 79.
[129] Kühne: „Faschistische Kolonialideologie“, S. 40.
[130] Hildebrand: „Weltreich“, S. 775.
[131] Plumelle-Uribe: „Weiße Barbarei“, S. 130.
[132] Für das Beispiel Frankreich vgl. Nestler, Ludwig; Schulz, Friedel: „Die faschistische Okkupationspolitik in Frankreich (1940-1944)“, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1990, S. 57-79.
[133] Vgl. ebd. S. 80-92.
[134] Fanon, Frantz: „Für eine afrikanische Revolution. Politische Schriften“, März Verlag 2022, S. 94.
[135] Eine interessante Parallele zu Moishe Poste, der dasselbe mit dem Antisemitismus, den er allerdings vom Rassismus unterschied, getan hat. Damit legte Poste die theoretische Grundlage für die sich als „Wertkritiker“ bezeichnenden Hardcore-„Antideutschen“ mit ihrem „strukturellen Antisemitismus“.
[136] Schmitt-Egner, Peter: „Kolonialismus und Faschismus. Eine Studie zur historischen und begrifflichen Genesis faschistischer Bewußtseinsformen am deutschen Beispiel“, Andreas Achenbach Verlag, Gießen/Lollar 1975, S. 5.
[137] Ebd. S. 123, 126.
[138] Ders.: „Wertgesetz und Rassismus. Zur begrifflichen Genesis kolonialer und faschistischer Bewußtseinsformen“, 1978, Online: www.trend.infopartisan.net/trd0505/t180505.html (zuletzt angesehen am 4.5.2025).
[139] Vgl. Schmitt-Egner: „Kolonialismus und Faschismus“, S. 43-45.
[140] Ebd. S. 46.
[141] Ebd. S. 106
[142] Vgl. Losurdo, Domenico: „Das 20. Jahrhundert begreifen“, PapyRossa Verlag, Köln 2013, S. 22f.