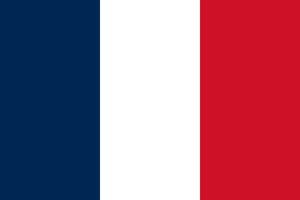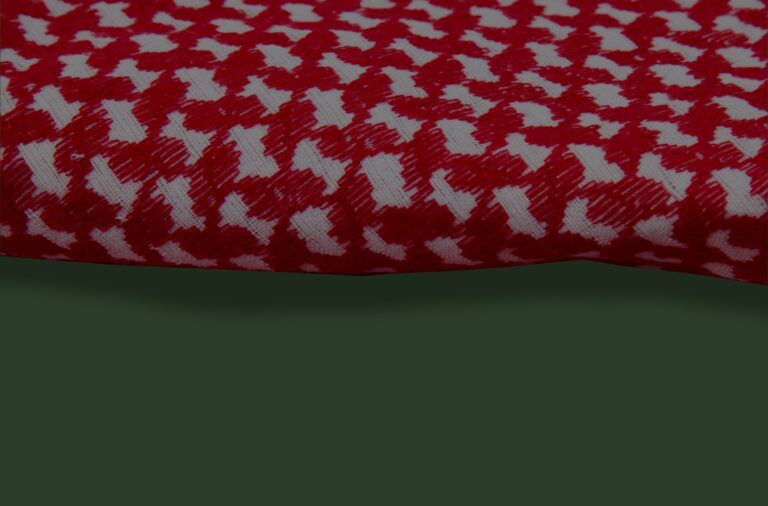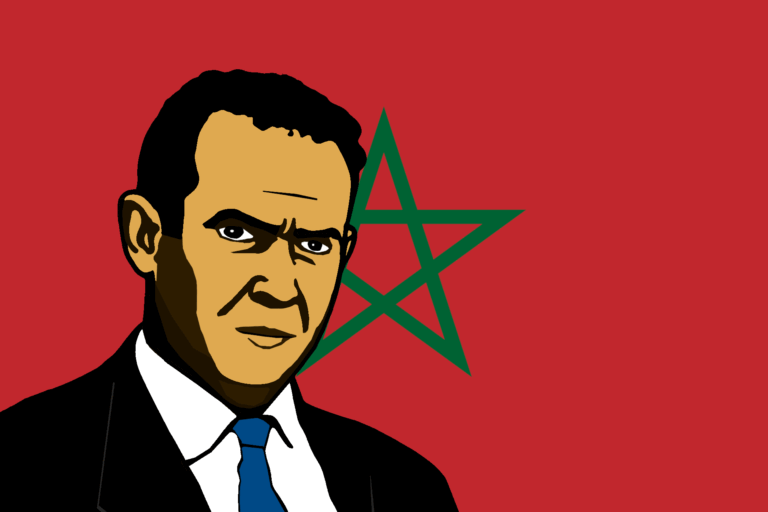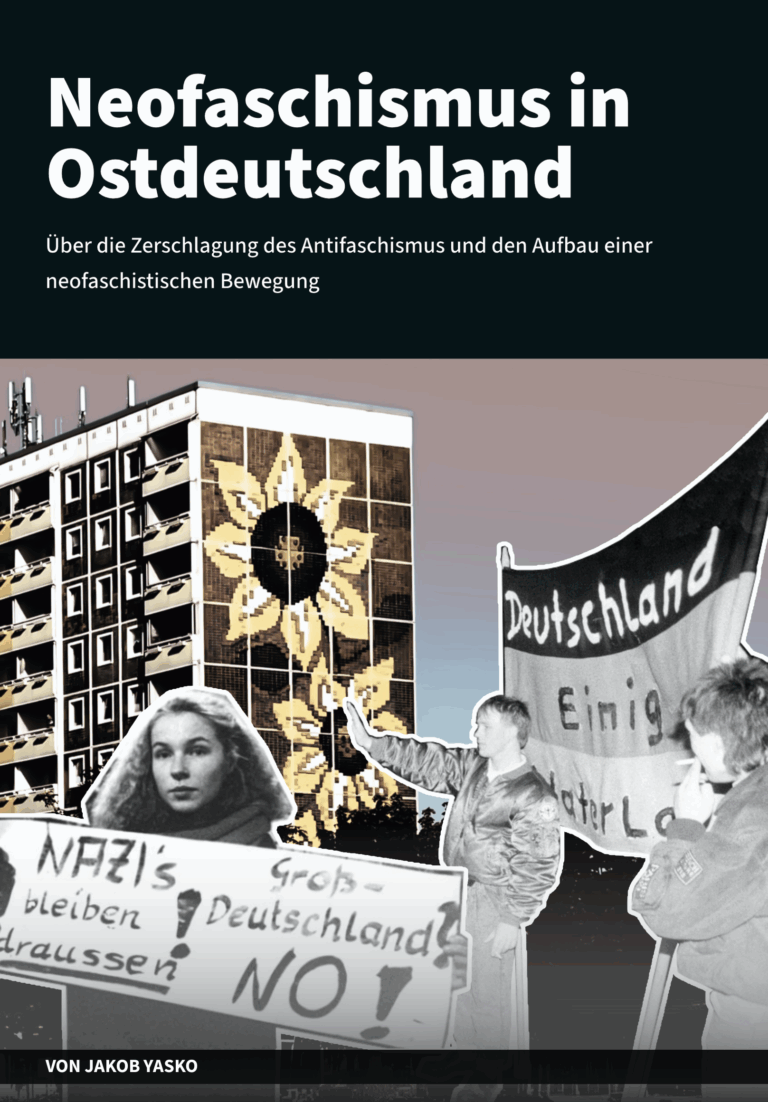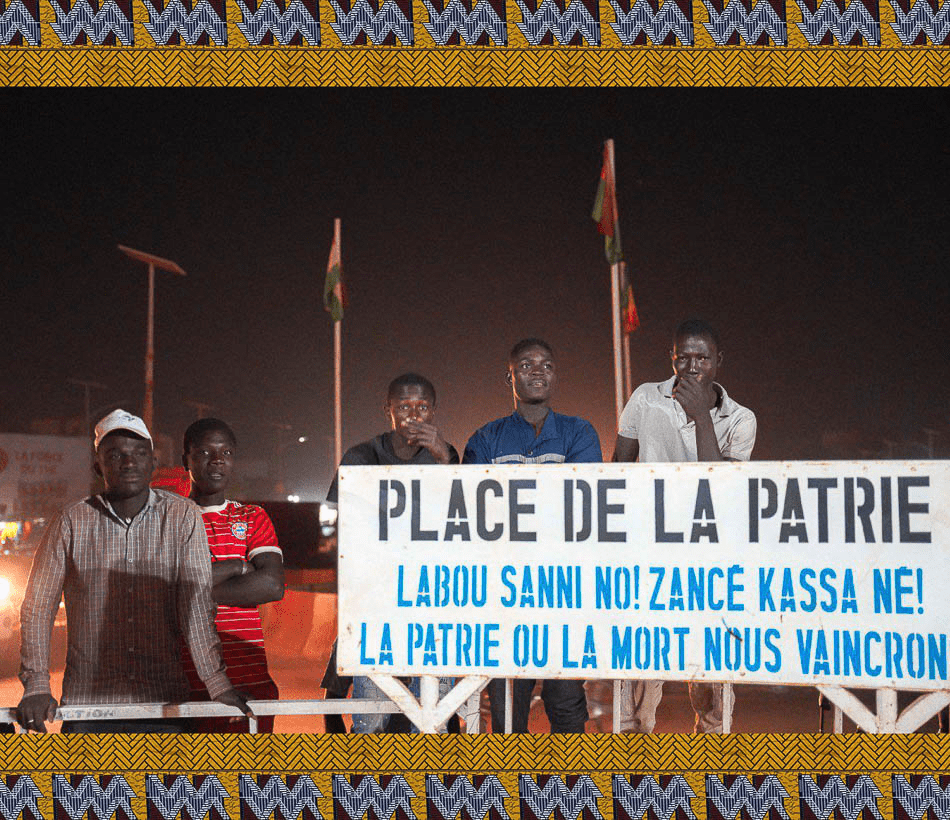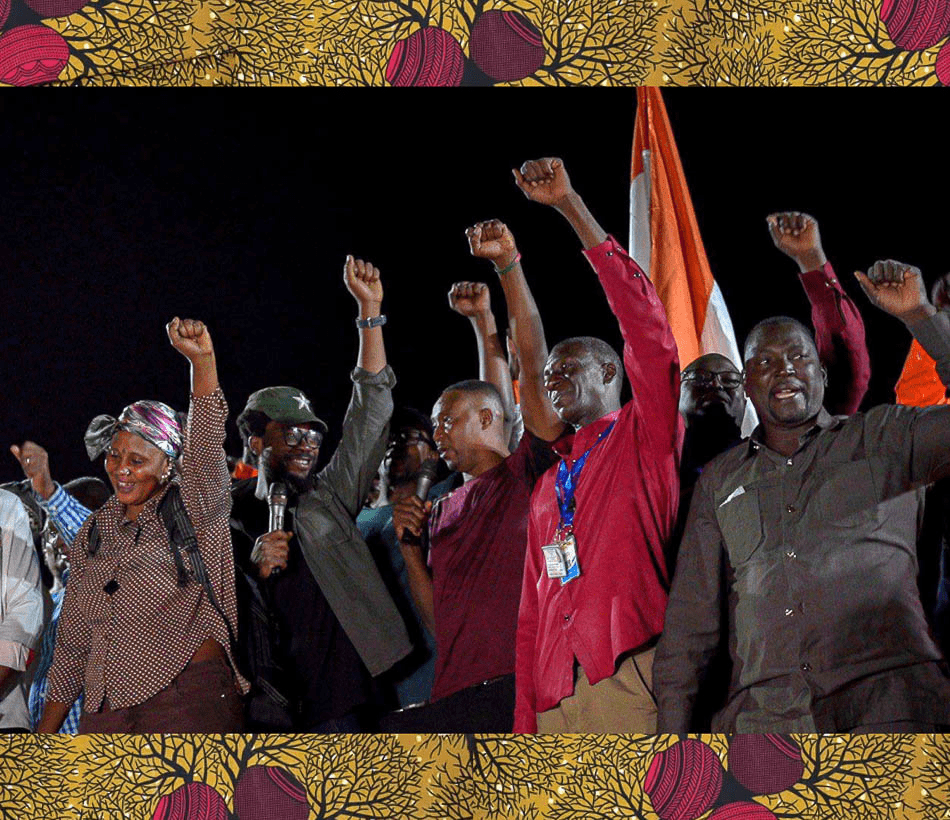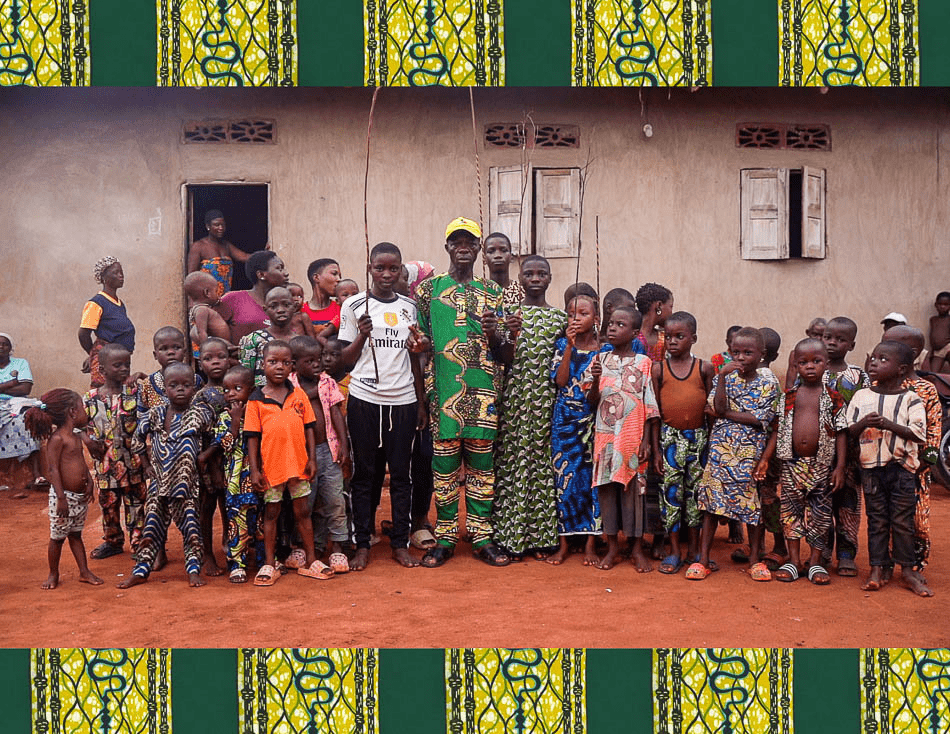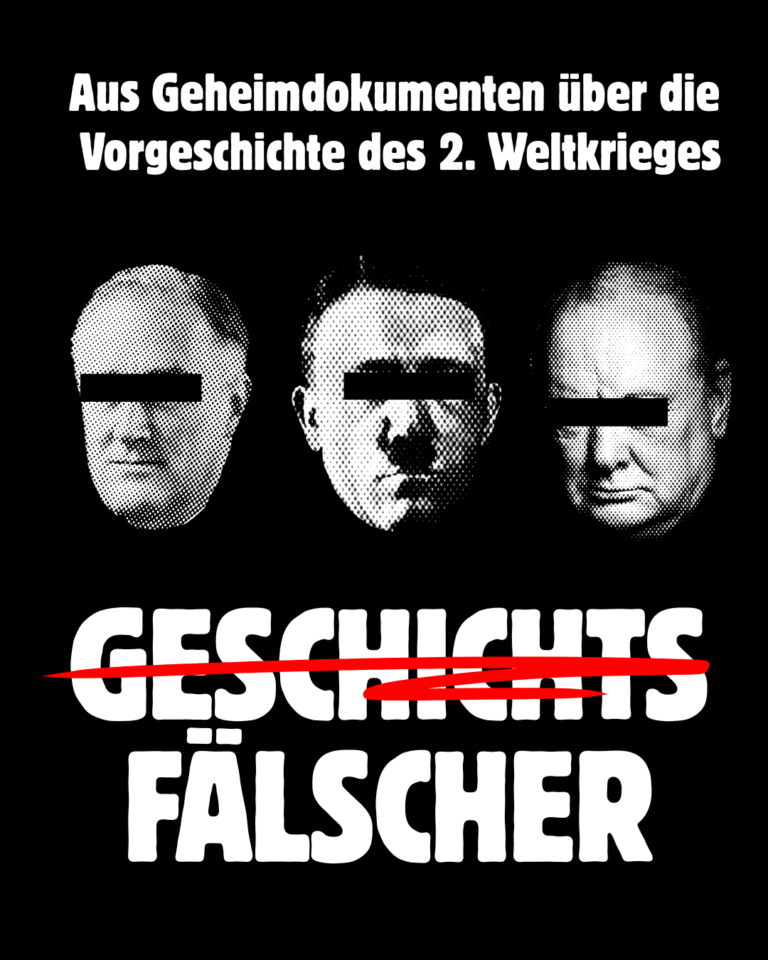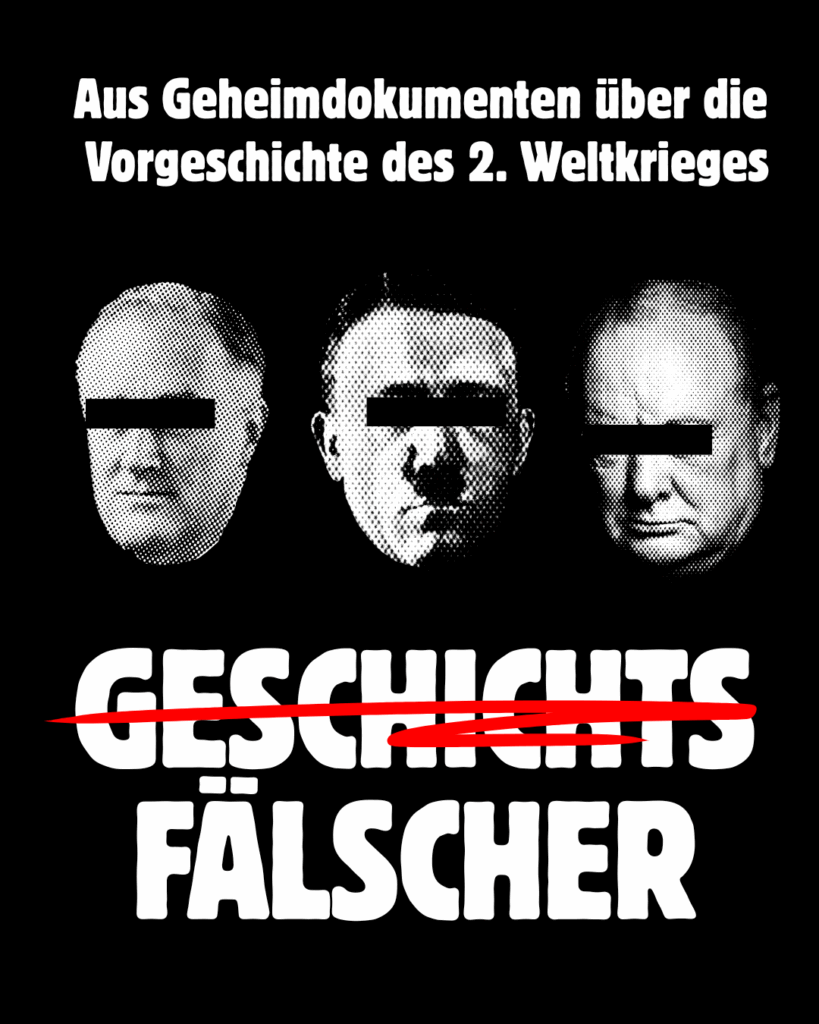El siguiente texto es una traducción del ensayo del camarada Noel Bamen titulado “15 gängige Mythen über die Hamas – und wieso wir gegen ihr Verbot kämpfen müssen!”. Ya ha sido traducido al inglés. La siguiente versión en español proviene del sitio web www.antiimperialistas.com y, al parecer, fue realizada directamente del alemán.
Agradecemos a los camaradas por la traducción y la difusión del texto.
Redacción de la KO
Acerca de este texto
El siguiente texto pretende cumplir una cosa por encima de todo: aclarar y refutar los mitos comunes que están muy extendidos sobre Hamás o que se han presentado contra él, y servir de ayuda a la argumentación. Debe quedar claro desde el principio que no todos los mitos tratados aquí son mentiras o afirmaciones falsas. Por el contrario, a menudo tienen al menos un aspecto verdadero. Desmitificar aquí significa concretamente: objetivar, corroborar, refutar argumentativamente y, en ciertos casos, también refutar. Esto se hace principalmente en el capítulo 4.
El texto fue escrito de tal manera que cada mito puede ser leído por sí mismo. Esto le permite “buscar“ el texto sin tener que leerlo (de nuevo) en su totalidad. Las repeticiones más pequeñas eran inevitables.
Al mismo tiempo, si el texto se lee en su totalidad (especialmente los capítulos 3 y 4), es de esperar que también proporcione una buena introducción y una visión general del tema de “Hamas”.
Las referencias no solo pretenden ser verificables y criticables, sino que también pretenden estimular una mayor discusión, al igual que la literatura y las recomendaciones de fuentes (Capítulo 2).
Sobre todo, la introducción y la conclusión se refieren a la lucha política en Alemania, están escritas como una contribución al debate, como crítica y autocrítica y están dirigidas al comunismo, a la izquierda, a la solidaridad con Palestina y al movimiento por la paz en la RFA.
1. Introducción
El 2 de noviembre de 2023, el Ministerio Federal del Interior anunció la prohibición de las actividades tanto de Samidoun como de Hamás. Tres semanas después, se produjeron redadas contra presuntos “simpatizantes” de Hamás. Además, el brazo armado de Hamás está en la lista de terroristas de la UE desde 2001 y la propia organización desde 2003. Si bien varias organizaciones de izquierda en todo el país condenaron la prohibición del samidoun y expresaron su solidaridad con los camaradas, casi nadie condenó públicamente la prohibición de Hamas.1
Por el contrario, grandes partes del movimiento de solidaridad con Palestina alemana se distancian claramente de Hamás, y esto no significa que quienes se defienden de la acusación de ser “partidarios de Hamás” o “simpatizantes”, sino organizaciones e individuos que atacan públicamente a Hamás, niegan que sea parte de la resistencia legítima de los palestinos, o lo acusan de ser una “organización terrorista” o similar.
El MLPD incluso exigió oficialmente la prohibición del “fascista Hamas”, poco después de que el Gobierno Federal anunciara tal prohibición.2
Es difícil imaginar cómo una organización que dice estar “incondicionalmente en solidaridad con la lucha de liberación palestina”3 aún más que apoya al Estado, aún más corrosivo para el movimiento de liberación palestino y aún más descaradamente en el sentido de la represión racista e imperialista de la RFA. Es curioso que el MLPD no haya celebrado la prohibición efectiva de las actividades de Hamás. Desde su punto de vista, este paso representó en última instancia una “victoria antifascista”.
Pero incluso nosotros, como Organización Comunista (KO), todavía no nos hemos posicionado abiertamente en contra de esta prohibición, a diferencia de Samidoun4 o con Hezbolá hace tres años y medio.5
Sin embargo, en mi opinión, tal condena de la prohibición es políticamente correcta.
A la defensa de Hamás contra la crítica injustificada e incluso contra la propaganda abierta y la represión se oponen a menudo varios argumentos desde una perspectiva de izquierda y comunista. En mi opinión, la mayoría de ellos son argumentos falsos o se basan en falsas suposiciones teóricas y relacionadas con los hechos. Estos errores conciernen tanto a la realidad en Palestina y sus alrededores en general, como a Hamás en particular. Por supuesto, también son a menudo una expresión de lo que considero una falsa comprensión de la liberación nacional y su relación con la lucha de clases. Pero no puedo entrar en este punto aquí, ya lo he hecho en otro lugar.6
Más bien, el presente texto tiene la intención de disipar los mitos sobre Hamas. Luego argumenta por qué tenemos que luchar contra la prohibición de Hamas.
2. Recomendaciones de lectura
Hay algunos buenos textos y también libros sobre Hamás, incluso en alemán. Me baso en estos escritos, los recomiendo a todos aquellos que quieran tratar el tema de manera objetiva y, por lo tanto, no pretenderé que este texto sea el primero y único útil sobre el tema. Por lo tanto, el presente texto no pretende ofrecer un análisis exhaustivo de Hamás, sino más bien refutar los mitos comunes sobre él.
Libros
Todos los títulos que se enumeran a continuación se pueden encontrar en la bibliografía y referencias adjuntas.
En primer lugar, se recomiendan las dos obras estándar alemanas de Helga Baumgarten de 2006 y 2013 y de Khaled Hroub (2011). Proporcionan una visión completa de la prehistoria, el desarrollo organizativo, político e ideológico, el carácter de la organización y los debates internos. Además, ambos autores no ocultan sus respectivas opiniones. Baumgarten procede cronológicamente, el libro de Hroub, en cambio, se ocupa de cuestiones complejas, similares a las del presente texto.
Los libros en inglés de Hroub (2002) y Tareq Baconi (2018) también son adecuados como introducción. Mientras que este último se basa en extensas fuentes de texto programático de Hamas, Hroub recurre repetidamente a información privilegiada de la organización. Lo mismo puede decirse de Azzam Tamimi (2007a), considerado un asesor no oficial de Hamás en el extranjero.7
Los libros de Imad Mustafa (2013) y Henrik Meyer (2010) son mucho menos extensos, pero ciertamente adecuados para una introducción, aunque cada uno de ellos dedica solo capítulos individuales a Hamas y también tratan de otras organizaciones político-islámicas.
Dos trabajos seminales sobre la política exterior de Hamás, de Daud Abdullah (2020) y Leila Seurat (2019), son relativamente nuevos.
Britt Ziolkowski (2020) echa un vistazo a un aspecto interesante y ampliamente subexpuesto de la organización con su estudio sobre el papel de las mujeres en Hamás. El libro se caracteriza por la objetividad y la simpatía crítica, sobre todo porque el autor trabaja ahora para la Oficina para la Protección de la Constitución.
Definitivamente no recomendaría el trabajo de Joseph Croitoru (2007). No es casualidad que el libro del autor germano-israelí no solo haya sido impreso por la Agencia Federal de Educación Cívica, sino que también haya sido reeditado por C.H. Beck Verlag para la primavera de 2024. Por lo tanto, este escrito, que no solo sigue una clara postura anti-Hamas, sino que también tiene errores de hecho,8 la “obra estándar” oficial sobre el movimiento de resistencia islámica en el mundo de habla alemana. Una denuncia de la pobreza y, por supuesto, una prueba más de hasta qué punto la clase dominante en Alemania se ha inclinado hacia el curso antipalestino.
Artículos en línea
Si quieres adquirir un conocimiento básico más profundo, no puedes evitar los libros. Para primeros buenos comienzos, evaluaciones realistas y análisis fácticos (especialmente para las personas a las que les gustaría animarse a pensar más críticamente, que no conseguirían un libro para esto, sino que harían clic en un enlace), puedo recomendar los siguientes textos: El artículo de Karin Leukefeld, publicado en noviembre de 2023 en la UZ,9 el artículo de la redacción de Marx21 de octubre de 202310 así como la entrevista con Tareq Baconi, que también apareció en Jacobin en noviembre de 2023.11
Medio
Además, los análisis, informes e investigaciones sobre el desarrollo en curso de Hamás son, por supuesto, enormemente importantes. Los medios de comunicación árabes como Al-Jazeera, Al-Mayadeen, Middle East Eye, Middle East Monitor, Palestinian Information Center, Quds News Network o The Palestine Chronicle, los medios de comunicación iraníes como Press TV, así como The Cradle, Mondoweiss, The Electronic Intifada, Red o Russia Today ofrecen repetidamente material interesante en inglés.
En alemán, la oferta es mucho menor. Pars Today, la agencia de noticias yemení Saba y la Agencia de Noticias de Qatar tienen páginas en alemán. Además, existe el conocido RT alemán y el menos conocido TRT alemán. El Linke Zeitung y la Magazin der Masse (MagMa) también traducen de vez en cuando artículos interesantes, por ejemplo, de The Cradle, Al-Mayadeen o The Electronic Intifada. Por último, pero no menos importante, aquí se recomienda Occupied News, que, al contrario de lo que sugiere el nombre, es un medio alemán y hace un muy buen trabajo.
Fuentes
Dado que Hamás se ha visto expuesto recientemente a una mayor represión y, por tanto, a una censura más estricta en Alemania, las fuentes no son tan fácilmente accesibles: el sitio web sólo es accesible a través de VPN y los canales de Telegram de las Brigadas Hamás y Qassam están bloqueados para los números de teléfono alemanes. Las citas de Hamás también son repetidas o al menos citadas por los medios de comunicación y canales de Telegram como Quds News Network, The Cradle o Resistance News Network, así como por agencias de prensa internacionales como afp, ap, IRNA, Qatar News Agency, Reuters, Saba o Tass.
Probablemente no sea una coincidencia que la tristemente célebre carta de Hamas de 1988, que se discute en el Mito 12, solo se pueda encontrar en alemán en sitios sionistas; No he verificado estas traducciones y, por lo tanto, no puedo juzgarlas. Una traducción completa y recomendable al alemán se puede encontrar en el apéndice de Baumgarten.12 El documento de política de 2017, que es interpretado por algunos como una nueva carta de Hamas (también Mito 12), ahora se puede encontrar en línea como una traducción no autorizada al alemán.13 Asimismo, el comunicado publicado el 21 de enero de 2024: “Nuestra visión de la operación “Inundación de Al-Aqsa“.14 El mérito de traducir y publicar estas dos importantes fuentes es para el MagMa. Además, Baumgarten también imprime el programa electoral de Hamás de 2006, con el que ganó las elecciones parlamentarias de la época.15 La posición de Mustafa sobre la llamada Primavera Árabe de 2011 y un comunicado de prensa de Hamás sobre la guerra siria de 2013 están traducidos al alemán.16
De hecho, las fuentes sobre Hamás traducidas al alemán están en gran medida agotadas en esto, lo que dice mucho sobre el limitado discurso en este país. En inglés, por otro lado, se pueden encontrar innumerables entrevistas, comunicados de prensa y otras fuentes de Hamas, si no a través de Google, al menos específicamente a través de los medios de comunicación árabes, iraníes y turcos, especialmente los enumerados anteriormente.
3. Breve reseña de la historia de Hamás
Hamás fue fundado en 1987 por líderes de la Hermandad Musulmana en Palestina.
a) Los Hermanos Musulmanes
La Hermandad fue fundada en Egipto en 1928 y más tarde fundó ramificaciones en varios países del mundo árabe. Probablemente porque fue la primera organización de este tipo con raíces masivas y debido a su difusión y creación de redes, se la considera la organización político-islámica o “islamista clásica”. La valoración de los Hermanos Musulmanes desde el punto de vista marxista es muy diferente: en las publicaciones de la RDA, por ejemplo, se les suele llamar “extremistas de derecha” (lo que parece cuestionable y problemático no sólo por la adopción del término “extremismo”); Se pueden encontrar evaluaciones más matizadas en algunos autores trotskistas y “neomarxistas”.17 No se puede hacer aquí un análisis de los HM, ya que la Hermandad es más que la suma de sus partes, lo que significa que primero habría que ocuparse de al menos sus subdivisiones nacionales más importantes (Egipto, Túnez, Palestina, Jordania y Siria) y de sus relaciones mutuas. (Ver también Mito 2)
En términos muy generales, se puede decir de ellos lo siguiente para esbozar a grandes rasgos su carácter: Su ideología es religiosa-nacionalista, lo que significa que, a diferencia del EI, por ejemplo, reconoce los Estados nacionales existentes y también el concepto de nación y no quiere abolirlo en favor de un califato (mundial); según Helga Baumgarten, el marco nacional está incluso por encima del panárabe y del de la umma, es decir, de la comunidad islámica mundial.18
La HM es culturalmente conservadora, económicamente liberal y anticolonialista en su autoimagen; surgió como respuesta a la dominación imperialista de Occidente en el mundo árabe y en esta lucha abogó por su propia “modernidad islámica”, es decir, no vinculó la lucha de liberación nacional centralmente con las ideas sociales revolucionarias (como los comunistas y, en cierta medida, también con los “socialistas árabes”), sino con una especie de “guerra cultural”. Todo esto corresponde al carácter (pequeño) burgués de clase de la HM y de su base (que, por supuesto, también incluye capas más amplias que la pequeña burguesía).19
b) Los Hermanos Musulmanes en Palestina (1935-1987)
El tema de Palestina ha desempeñado un papel importante para la HM desde su fundación y en 1935 se envió una primera delegación oficial.20 Pero no fue hasta la huelga general de 1936, que dio lugar a un levantamiento de tres años, que el tema despertó un mayor interés y, por primera vez, una simpatía más amplia en Egipto.21
La hermandad recaudó dinero para apoyar a los huelguistas y organizó una campaña mediática y de protesta. Y también se dice que se enviaron combatientes desde Egipto en ese momento. Inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, en el otoño de 1945, se fundó en Palestina la rama oficial de los Hermanos Musulmanes, primero en Jerusalén, luego en Haifa, Jaffa, Gaza y otras ciudades. Su número de miembros aumentó a 20.000 en 1947. Sin embargo, al principio siguió siendo comparativamente insignificante. El futuro político de Palestina está en el centro de su política. Con este fin, también cooperó con cristianos y comunistas. Después de perder su confianza en la ONU, los HM se prepararon para una lucha armada de liberación contra los británicos y los sionistas. Mientras tanto, en Egipto, la organización matriz entrenó a voluntarios árabes que querían luchar por Palestina, organizó armas y envió combatientes a la zona del mandato. En la defensa de Jerusalén, Belén y Faluya, cerca de Gaza, contra las tropas sionistas, los combatientes de los Hermanos Musulmanes jugaron un papel importante en los primeros meses de la guerra.22
“Los palestinos tenían a la Hermandad Musulmana en alta estima, independientemente de su afiliación política, debido a su compromiso con Palestina. A diferencia de los gobiernos árabes, no lo habían dejado en palabras, sino que habían traducido su apoyo en hechos, primero de 1936 a 1937, pero sobre todo durante la guerra de 1948”.23
Después de la Nakba, los Hermanos Musulmanes se desarrollaron de manera diferente en Cisjordania, anexionada por Jordania, y en la Franja de Gaza administrada por Egipto: en Jordania, los HM se ganaron el favor de la monarquía allí y, por lo tanto, en última instancia, también del imperialismo occidental; renunció a la resistencia armada contra el sionismo, el rey lo mantuvo atado y lo utilizó como competidor contra el nacionalismo árabe y el movimiento obrero socialista, y se limitó al papel de una oposición falsa cuando ocasionalmente llamaba a criticar la política exterior prosionista de Ammán o una política interna religioso-normativa más estricta. En este papel, los HM se volvieron cada vez más impopulares, especialmente entre los palestinos de Cisjordania y Jordania. Su base consistía en “comerciantes y propietarios de viviendas”. “A diferencia de Egipto, los empleados y autónomos apenas estaban representados […] Los alumnos, estudiantes y docentes también estaban infrarrepresentados”.24
En Gaza, por otro lado, los HM estaban formados principalmente por alumnos, estudiantes y empleados, lo que, junto con la conexión con Egipto (desde 1953) bajo Abdel Nasser, puede haber influido en el carácter más radical de los Hermanos Musulmanes en la Franja de Gaza. Entre los miembros de la Hermandad Musulmana que estudiaban en Egipto se encontraban Khalil al-Wazir (Abu Jihad), Salah Khalaf (Abu Iyad), Assad Saftawi, Yussef al-Najjar, Kamal Adwan y, dependiendo de cómo se lea, Yasser Arafat.25 que luego pertenecieron a los fundadores y en algunos casos a los líderes más importantes de Fatah.26
Mientras que Fatah (no como la única, sino como la organización más importante) ganó para la lucha armada a aquellos palestinos, en su mayoría jóvenes, que exigían soluciones radicales, los HM en Gaza, al igual que Cisjordania, se distanciaron de la lucha de liberación y, por lo tanto, también perdieron cada vez más su atractivo. Esta política fue continuada por los HM en Cisjordania y la Franja de Gaza, que se reunificaron organizativamente en 1967. En los 20 años previos a la fundación de Hamás, los Hermanos Musulmanes se concentraron primero en la construcción de mezquitas y luego en instituciones sociales con el fin de ampliar su influencia entre la población. Debido a esta política de no confrontación hacia la ocupación, los HM fueron vistos muy favorablemente por el régimen sionista como un competidor de la OLP y tratados en consecuencia.27 (Ver Mito 1)
c) Hamás (1987 hasta la actualidad)
Esto cambió a más tardar con el auge del Movimiento de Resistencia Islámica (acrónimo: HAMAS) desde finales de la década de 1980 y el acercamiento entre los líderes de Fatah y la OLP, por un lado, e Israel, por el otro: Hamas se fundó inmediatamente después del estallido de la Primera Intifada en diciembre de 1987. Participó activamente en este levantamiento popular y fue una de las críticas más duras de las llamadas negociaciones de paz de Oslo en la década de 1990. Desde 198928 En la Segunda Intifada, entre 2000 y 2005, fue la principal fuerza militar detrás del levantamiento, junto con las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, afiliadas a Fatah.
En las elecciones parlamentarias en los territorios ocupados en 1967 en 2006, Hamás ganó por goleada, pero no pudo formar un gobierno estable debido a la política de aislamiento de Israel y Occidente, así como a la postura de bloqueo de Fatah. En junio de 2007, Hamas dio un golpe de Estado en la Franja de Gaza, mientras que Fatah tomó el control de Cisjordania. (Ver Mito 10) Desde entonces, Gaza ha sido el principal bastión de la resistencia palestina, mientras que Cisjordania ha sido gobernada por el ejército israelí y el régimen títere de Mahmoud Abbas.
Israel ha librado cinco guerras hasta ahora (2008/09, 2012, 2014, 2021 y 2023) para debilitar o aplastar completamente a Hamas. La organización, por otro lado, ha perdido su impecable reputación en términos de corrupción y política de poder en la década y media que ha estado en el poder en la Franja de Gaza, por un lado, pero por otro lado se ha establecido como una fuerza líder de la resistencia palestina. Ha tratado de hacer la paz con Abbas y ha abandonado su rechazo constante a reconocer a Israel. (Mitos 9 y 11) Además, ha dado varios giros en política exterior, especialmente en lo que respecta a Siria. (Mito 13) En la actualidad, Hamás es el líder indiscutible del movimiento de liberación palestino: gobierna Gaza, lidera la resistencia allí, es, con mucho, la fuerza defensiva más fuerte militarmente y goza de un gran apoyo en su papel como tal no sólo en Gaza, sino también en Cisjordania y la diáspora, lo que se refleja en las victorias electorales en las universidades de Cisjordania.
4. Mitos sobre Hamás
Algunas de las leyendas que rodean a Hamas ya han sido mencionadas en el capítulo anterior. A continuación, sin embargo, ahora se enumerarán y refutarán explícitamente. Estas son las afirmaciones con las que uno se encuentra con más frecuencia, especialmente entre las personas que son fundamentalmente pro-palestinas. Pero la lista es, por supuesto, mucho más larga.
Mito 1: “Hamas fue construido por Israel”.
En el pasado, los círculos del ejército israelí y los medios de comunicación estadounidenses han difundido en parte que los Hermanos Musulmanes (HM) en Gaza en los años 1967-75, cuando construyeron principalmente mezquitas, fueron financiados por Israel “como contrapeso contra la OLP y los comunistas”.29 Helga Baumgarten escribe: “La Hermandad Musulmana palestina niega categóricamente haber recibido ayuda financiera de Israel. Lo que no se puede negar, sin embargo, es el manejo muy indulgente y abierto de todas las actividades de la Hermandad Musulmana en ese momento.30
Su evaluación es la siguiente: “Por lo tanto, la política israelí hacia los Hermanos Musulmanes probablemente pueda caracterizarse mejor como una política de tolerancia amistosa, aunque no se puede suponer que también hubo casos de apoyo directo”.31 Del mismo modo, Jean-Pierre Filiu dice de este período: “La potencia ocupante no llegó a dar apoyo oficial [a los Hermanos Musulmanes], sino que optó por una tolerancia benévola, pero por definición reversible”.32
Y Alexander Flores afirma: “Hamas no es una criatura de Israel, como a veces se afirma. Sin embargo, la política de ocupación israelí ha creado las condiciones que han ayudado a Hamas a alcanzar su estatura actual en dos aspectos. Dejó que la organización o su predecesora hicieran lo que quisiera cuando sus competidores fueron ferozmente reprimidos; y ha alimentado ese odio a la ocupación a través de la continua constricción y opresión de la sociedad palestina y mediante el trato violento y despectivo de la población”.33
Una ruptura con la vieja línea
Ya en la década de 1950, jóvenes ex miembros de la Hermandad Musulmana que estaban insatisfechos con la actitud pasiva de los HM habían participado en la fundación de Fatah como organización guerrillera y de liberación palestina. (Véase el capítulo 3 b) A principios de la década de 1980, el fenómeno se repitió con el establecimiento de la Yihad Islámica, que se inspiró en la revolución iraní. La yihad era mucho más pequeña y menos influyente que Fatah, pero a diferencia de Fatah, también se adhirió a su ideología islámica y, por lo tanto, se convirtió en un competidor de los HM en esta área. Por lo tanto, Hamas se encuentra en una situación en la que, por un lado, tiene una base consolidada, especialmente en la Franja de Gaza, pero por otro lado, su legitimidad como fuerza política palestina es cuestionada. El estallido de la Primera Intifada fue entonces la gota que colmó el vaso, y actuó como partera de Hamás, que surgió del centro político y de las estructuras armadas y de inteligencia ya existentes de los HM aproximadamente una semana después del comienzo del levantamiento popular.34
Glenn Robinson y Diaa Rashwan hablan de un “golpe” interno con respecto al cambio de rumbo y la fundación de Hamas35 o una especie de revuelta.36 Raif Hussein, por su parte, considera que estas interpretaciones son “exageradas”, ya que la dirección de los HM apoyó la decisión.37 Sin embargo, no cabe duda de que la fundación de Hamás marcó un cambio significativo en la política anterior de los Hermanos Musulmanes en Palestina. Pero no debes pensar en ello como un evento que sucedió de la noche a la mañana. Más bien, partes de la Hermandad Musulmana en torno a Shaykh Yassin se han estado preparando para este paso desde mediados de la década de 1980, por ejemplo, construyendo depósitos de armas y construyendo estructuras subterráneas.38
¿”Luna de miel”?
Baumgarten escribe sobre la moderación de la potencia ocupante sionista hacia Hamas en los primeros meses de su existencia: “En todo el período desde el comienzo de la Intifada hasta principios del verano de 1988, el ejército israelí, en contraste con las organizaciones de la OLP, todavía permitió que Hamas operara en gran medida libremente. Como confirman todos los análisis presentados, los llamamientos a los ataques de Hamás no fueron impedidos violentamente, los folletos de Hamás pudieron distribuirse en gran medida sin obstáculos y, al parecer, hubo relativamente pocas detenciones. Al comienzo de la intifada, sólo el Dr. Abd el-Aziz Rantisi y el Jeque Khalil al-Quqa fueron arrestados en Gaza. Nur al-Quqa fue finalmente deportado el 11 de abril. Un total de 32 palestinos fueron deportados en el primer año de la intifada, la mayoría de ellos miembros de las organizaciones nacionalistas de la OLP. La primera gran ola de arrestos contra Hamas comenzó a finales del verano de 1988, después de que el ejército israelí descubriera la existencia de células armadas de Hamas. Con la excepción de Sheikh Ahmad Yasin, todos los líderes de Hamas en Gaza han sido arrestados. […] Como resultado de las detenciones, el centro de mando de Hamás se trasladó a las prisiones israelíes. Ibrahim Yazuri […] fue arrestado el 12 de octubre de 1988, seguido en mayo de 1989 por el jeque Ahmad Yasin, junto con Ismail Abu Shanab, también de la dirección de los islamistas, así como otros 250 activistas de Hamas. A más tardar en ese momento, había quedado claro que la luna de miel entre Israel y los islamistas palestinos había terminado”.39
El lector atento se habrá dado cuenta de que el término “luna de miel” es en realidad una metáfora muy inapropiada, porque las lunas de miel siguen a una boda. Baumgarten, sin embargo, describe en realidad lo contrario, es decir, una especie de divorcio: después de la fundación de Hamas, hubo un breve período en el que el régimen sionista aún no había comprendido que los HM en Palestina se habían transformado de una organización quietista a una organización de resistencia. Sin embargo, desde 1989, Hamas ha sido considerado oficialmente una “organización terrorista” en Israel y la membresía por sí sola es suficiente para ser encerrado en prisión durante muchos años.40 Como resultado de esta represión, Hamás entró en una crisis existencial poco después de su fundación, es decir, en 1989, pero a más tardar en 1992.41
Resultado
En primer lugar, los Hermanos Musulmanes: hasta donde yo sé, hay ciertos indicios, pero ninguna prueba, de que hayan recibido apoyo directo de Israel; Desde mi punto de vista, sin embargo, este punto también es secundario. La tolerancia o la promoción directa o indirecta de los HM por parte de Israel tiene dos42 Razones: 1. Dividir y gobernar, y esto difícilmente se puede culpar a la MB, como también enfatiza Baumgarten.43 2. Este apoyo se basó esencialmente en el hecho de que los HM no se resistieron al régimen colonial, que a su vez puede y debe ser mantenido en su contra. Pero la fundación de Hamas fue precisamente una ruptura radical con esta política, que servía a los sionistas.44
Esto se hizo evidente en muy poco tiempo, cuando Israel procedió a una represión masiva contra los líderes de Hamas. En vista de esto y del hecho de que la tortura durante el interrogatorio de (supuestos) miembros de Hamas aparentemente se convirtió rápidamente en parte del repertorio estándar de las FOI y el Shin Bet, Baumgarten concluye: “Todo esto conduce indudablemente a ataques de la izquierda palestina contra los Hermanos Musulmanes o Hamas, que son colaboradores de la ocupación, ad absurdum”.45 Filiu también describe la representación de los Hermanos Musulmanes o incluso de Hamas como “herramientas de Israel” como una “caricatura”.46
En vista de la década y media de bloqueo y de las cinco guerras contra la Franja de Gaza, todas las cuales sirvieron y siguen sirviendo a la destrucción de Hamas, es realmente absurdo aferrarse a la acusación de supuesta cooperación entre Hamas o HM e Israel hace 40, 50 o 60 años. Pero hubo, por supuesto, quienes afirmaron que en 2021 los talibanes seguían siendo los mismos títeres de Estados Unidos que habían sido en la década de 1990. Al final, es una especie de cuestión de fe: ¿Creo que las relaciones pueden cambiar o no? ¿Creo que hay una especie de “pecado original” del que uno no puede limpiarse? ¿Creo que el imperialismo occidental o el sionismo son omnipotentes y controlan todo y a todos, independientemente de los hechos que estén sobre la mesa?
Creo que la cuestión está clara: los HM en Palestina fueron un movimiento domesticado desde la década de 1950 a más tardar, que por lo tanto gozaba de cierta buena voluntad por parte de los sionistas y, de manera realista, incluso contaba con el apoyo de una política de divide y vencerás. Hamas marcó el final de esta relación y, como resultado de Oslo y la Segunda Intifada, se convirtió en el enemigo mortal acérrimo del sionismo.
Mito 2: “Hamas es una organización islámica radical” o “fundamentalista”.
Comencemos con los términos:
a) Fundamentalismo
El término “fundamentalismo” proviene del contexto cristiano y se refiere a las corrientes protestantes que querían volver a los fundamentos ideológicos o literarios del cristianismo, es decir, a la Biblia, que trataban de interpretar literalmente. Los fundamentalistas cristianos más prominentes son los llamados evangélicos. Dado que los católicos han interpuesto una autoridad en la interpretación de la Biblia con la iglesia, las corrientes fundamentalistas lo tienen mucho más difícil.47 Lo mismo se aplica al islam chiíta, que no tiene una iglesia, pero sí un clero.48
El islam sunita, en cambio, no conoce ni lo uno ni lo otro y, por lo tanto, está más cerca del protestantismo. Se parece a esto en que tiene un flanco más abierto hacia el fundamentalismo, que en su caso significaría sobre todo la interpretación literal del Corán. Y, de hecho, siempre ha habido movimientos fundamentalistas de renovación en el Islam, que cuestionaban la ortodoxia en la forma de las llamadas escuelas de derecho (Madhahib), los eruditos religiosos tradicionales (Ulama’) e incluso las tradiciones transmitidas (Sunnah) y las tradiciones del Profeta y sus compañeros (hadices).49
b) Salafiyya
Al igual que el fundamentalismo protestante, estos movimientos no tenían automáticamente un carácter reaccionario: mientras que en los EE.UU., por ejemplo, partes de los evangélicos condenaban la esclavitud como un “pecado diabólico”,50 reformadores progresistas como Jamal ad-Din al-Afghani (1838-1897) o Muhammad Abdu (1849-1905) se opusieron a la ortodoxia conservadora y al colonialismo, abogaron por la democracia burguesa, el progreso científico y el racionalismo, citando el Islam primitivo en la época de los “antepasados justos”, en árabe: as-Salaf as-Salih.51
c) “salafismo“, “yihadismo“ y wahabismo
El término “salafitas”, derivado de este término, suele referirse a corrientes mucho más conservadoras en el sunnitismo actual, que también pueden describirse como fundamentalistas. En su caso, este fundamentalismo tiene poco de progresista: el anticolonialismo y el antiimperialismo se refieren principalmente al nivel cultural, suelen ser explícitamente apolíticos (no rezar y luchar, sino rezar en lugar de luchar) y, por lo tanto, no pesan más que el conservadurismo en otras cuestiones. En general, estos “salafistas” apenas difieren de los wahabíes saudíes: los primeros suelen rechazar a los segundos por su pacto con la monarquía saudí. Al mismo tiempo, sin embargo, ellos mismos están financiados por Arabia Saudita.52
Cuando el “salafismo” aparece políticamente, por lo general sólo trata de imponer su conservadurismo a toda la sociedad a través del Estado. El llamado “yihadismo” al estilo de Al Qaeda o EI es inicialmente la continuación de esta política por otros medios. Sin embargo, a más tardar con el auge del EI en Siria e Irak, y casi aún más desde su desaparición, ha quedado claro que este “yihadismo” es atractivo para las milicias, especialmente en el contexto de conflictos de soberanía territoriales y/o mayoritariamente étnicos y/o confesionales o guerras civiles, con el fin de legitimarse y reclutar combatientes (también a nivel internacional). Además de Irak y Siria, por ejemplo, en Afganistán, Yemen, el norte de África y la región del Sahel.
d) Hamás: un movimiento islámico-conservador de liberación nacional
Hamás no es ni “salafista”, ni wahabí, ni “yihadista”, ni es apolítico. Y tampoco es fundamentalista. Hay “salafistas” en sus filas, pero son comparativamente insignificantes.53 También sería extraño que no existiera dentro de Hamas, ya que es un movimiento popular y al mismo tiempo un partido islámico, en el que confluyen varias corrientes islámicas. Como se explicó anteriormente, desciende de los Hermanos Musulmanes (HM). Los HM tampoco son fundamentalistas, sino que, por el contrario, son relativamente pluralistas: sus ramificaciones o partidos subsidiarios en los distintos países son –como se ha mencionado en el capítulo 3– relativamente diferentes. En Túnez, se les considera comparativamente “liberales”,54 en Jordania siguen siendo un perrito faldero de la familia real,55 en Yemen, son muy inusualmente “salafistas” e incluso cuentan con el apoyo de los saudíes -aunque los saudíes y los Hermanos Musulmanes son archienemigos en casi todas partes-56 en Siria, han sido fuertemente influenciados por sus experiencias de opresión desde la década de 197057 y en Egipto, su país de origen, se han comportado a veces de oposición militante, a veces colaborando, a veces de oposición pacífica, dependiendo de las políticas del régimen de allí58 y desde el golpe de Estado del general al-Sisi, han sido en gran medida aplastados y desintegrados en facciones “pacificadas” o apáticas y radicalizadas.
Como ya se ha señalado anteriormente, todos ellos tienen un programa político religioso-conservador, que suele prever una forma de democracia burguesa y un capitalismo relativamente liberal. En primer lugar está su respectiva nación, luego la nación (pan)árabe, luego la Ummah musulmana. La posición de los “conservadores” o “liberales”, de la “democrática” o “teocrática” de los respectivos HM depende de las circunstancias nacionales, de la represión que les afecte y de los intereses de clase de sus bases.
Hamás no es una excepción en este sentido: su programa ideológico se adapta a las condiciones de Palestina, es decir, concretamente a la lucha de liberación nacional en el centro, que beneficia a todas las clases palestinas. Porque Hamás, como partido y movimiento pequeñoburgués, se apoya en estas mismas masas -pequeños empresarios, maestros, médicos, científicos, abogados, ingenieros, obreros, campesinos y la burguesía nacional-, también trata de representar sus intereses lo mejor que puede. Por supuesto, en su marco ideológico. Pero este marco es mucho más amplio de lo que sugerirían palabras de moda como “islamismo” y “fundamentalismo”, que son inherentemente esquematismo, idealismo y prejuicios eurocéntricos: Hamás hace tiempo que dejó de ver su lucha como una lucha religiosa; deriva su moral (combativa) de la religión, pero sabe que en Palestina no es una guerra entre religiones. (Ver Mito 3) Incluso su lengua ya se había “secularizado” a mediados de la década de 2000;59 y cualquiera que lea las publicaciones de hoy de Hamás o de las Brigadas Qassam se dará cuenta de que argumentan menos teológicamente y mucho más moralmente y bajo el derecho internacional. El gobierno de Hamás en Gaza, por otro lado, no es autoritario porque se vea a sí mismo como la autoridad que tiene que hacer cumplir regulaciones morales particularmente estrictas basadas en la religión – tales avances ciertamente han existido, pero a menudo han sido modificados o completamente abandonados, fracasando no solo debido a la resistencia o la desobediencia de la población;60 Al mismo tiempo, Hamás rechaza la acusación de que está imponiendo una política moral a la población61 – sino porque es el gobierno en una zona sitiada amenazada por un enemigo avasallador.
e) ¿”Khamas-IS”?
A diferencia del Estado Islámico y sus diversas ramificaciones, Hamas no es una milicia de guerra civil que vive al día o de la conquista y la adquisición, en lugar de representar un programa político real. Hamas es un partido político y un movimiento que trabaja de manera sostenible, con fuertes raíces en las masas populares, que debido a la situación concreta en Palestina, mantiene un brazo militar que forma parte de las guerrillas del movimiento independentista palestino por un lado y al mismo tiempo proporciona el ejército de Gaza de cierta manera. A diferencia del Estado Islámico, Hamás no busca la destrucción violenta de los Estados-nación existentes y el establecimiento de un califato mundial, ni persigue un curso sectario o incluso eliminatorio contra ningún grupo étnico de la región, porque pertenece a una religión falsa (judíos, cristianos, drusos o, en relación con Irak, yazidíes o similares) o denominación (chiítas o alauitas, que de todos modos no existe en Palestina). (Véase también el Mito 3.) Hamas tampoco se ha distinguido nunca por sus asesinatos particularmente brutales, ni siquiera los ha celebrado frente a la cámara. Al contrario: se honra a los mártires, se celebra la muerte de los enemigos en batalla y, por supuesto, también se burla del oponente. Por otro lado, no se sabe de ejecuciones masivas de israelíes por parte de Hamás, y mucho menos de que existan grabaciones de este tipo que circulan por él.
El aparato de propaganda sionista y la prensa mentirosa imperialista occidental han informado ampliamente que el propio Hamas documentó y difundió sus “masacres” y “actos de terror” el 7 de octubre. Pero yo mismo sólo conozco grandes imágenes que muestran cómo los luchadores por la libertad arrasan objetivos militares, toman prisioneros, etc., y cómo un pueblo vuela los muros de sus prisiones y vitorea a sus guerrilleros. Un artículo de verificación de datos de Occupied News dice: “Algunas imágenes de video muestran a combatientes de Hamas disparando o ejecutando a adultos no combatientes, principalmente mientras intentan escapar de la captura. Vale la pena señalar que, al menos en un video de este tipo, se pueden escuchar las voces claras de otros luchadores, gritando “¡NO!” y “¿Por qué?”. En otro video, se puede ver a un combatiente de Hamas impidiendo que un palestino vestido de civil humille a un israelí muerto”.62 Desafortunadamente, las fuentes correspondientes no están vinculadas. (Más sobre el “Diluvio de Al-Aqsa” en el Mito 15)
Por último, cabe mencionar que Hamás ha actuado en repetidas ocasiones contra las células “yihadistas” en la Franja de Gaza en el pasado: en 2009, un grupo afiliado a Al-Qaeda fue aplastado.63 En 2011, las fuerzas de seguridad de Gaza mataron a más “yihadistas”.64 En los años siguientes, el Estado Islámico y los partidarios de Al Qaeda fueron detenidos repetidamente en la Franja de Gaza65 y en algunos casos también asesinados por las autoridades.66 Por el contrario, Daesh declaró oficialmente la guerra a Hamas.67 Israel, a su vez, trató a más de 1.000 combatientes de los insurgentes sirios en 2014, incluidos presumiblemente bastantes combatientes del Frente Al-Nusra, la rama siria de Al-Qaeda, en hospitales del Golán, que ha estado ocupado desde 1967.68
f) Luchas de alas en el seno de Hamás
Hamás no es más monolítico que “fundamentalista” o “islámico radical”. Son varias las corrientes que luchan por influir en ella, lo que se nota especialmente en su orientación de la política exterior. A este respecto, Abdelrahman Nassar habla de tres polos relevantes que actualmente luchan por la hegemonía en Hamás: uno en torno al ex líder de Hamás Khaled Mash’al, que tal vez podría describirse como el “polo de los Hermanos Musulmanes“; un polo salafista-confesionalista o sectario, que, sin embargo, es comparativamente influyente; y un “ala militar” de brigadas Qassam y otras personalidades de la dirección que abogan por un acercamiento con el “eje de la resistencia”.69 (Ver Mito 13 para todo esto) Estas corrientes o alas se pueden identificar a partir de las posiciones mencionadas en esta pregunta específica y no necesariamente dicen nada sobre las posiciones políticas de los actores sobre otros temas.
Leila Seurat también comentó sobre este hecho: “Estas divergencias no pueden entenderse mirando solo las categorías normativas que oponen un liderazgo ‘radical’ desde afuera a un liderazgo ‘moderado’ desde adentro”, como suele ocurrir en la literatura. Antes de 2011, eran los dirigentes en el exilio los que rechazaban cualquier compromiso con la Autoridad Palestina; después de 2011 estaba dispuesto a hacerlo, pero los líderes en Gaza se resistieron; Desde entonces, el primero ha seguido un curso “sunita-internacionalista”, el segundo un curso nacional y anticonfesionalista. Por lo tanto, afirma Seurat: “No hay una correspondencia estricta entre las divisiones geográficas e ideológicas”.70 Aún menos útiles son frases como “línea dura”, como los conocemos con demasiada frecuencia en la prensa occidental con respecto a este o aquel político de Hamas.
En general, siempre intentamos ser lo más específicos posible y trabajar con etiquetas lo menos posible.
Mito 3: “Hamás es antisemita”.
a) Definición de antisemitismo
Aquí primero hay que definir lo que realmente significa el antisemitismo. Si uno sigue la definición de la IHRA, como hacen las autoridades en Alemania, o incluso la llamada prueba 3-D, entonces, en última instancia, cualquier crítica a Israel es antisemita. Este es precisamente el significado de estas definiciones infundadas, que no tienen nada que ver con la ciencia y todo que ver con la propaganda en el sentido del sionismo y el imperialismo occidental. La situación es similar con el entendimiento de que el antisemitismo es una ideología independiente y no tiene nada que ver con el racismo; esta idea proviene de Moshe Postone, fue adoptada por los llamados “anti-alemanes” (sionistas, generalmente pseudo-izquierdistas “bio-alemanes”) y se puede encontrar hoy en día en el discurso dominante de los medios de comunicación alemanes, en las universidades, etc.71
El antisemitismo sólo puede definirse significativamente como el racismo contra los judíos por ser judíos o porque son judíos. Como toda forma de racismo, el antisemitismo tiene diferentes especificidades, tiene su propia historia -que en su caso está estrechamente ligada al antijudaísmo cristiano-, es adaptable a los intereses momentáneos de los racistas, etc. Y como todo racismo, no se trata sólo de ideología, prejuicio y odio o de violencia inmediata e individualizada, sino en particular de una relación de poder, de violencia estructural y sistemática, etc.72 Esto significa que el racismo en su significado completo no es recíproco, sino unilateral. En definitiva, esto significa que en el mundo tal y como lo conocemos, con su historia, su realidad, etc., no hay racismo de negros contra blancos, sino al revés; no hay racismo de los judíos contra los alemanes, sino al revés, etc. Y si una persona negra dice: “Putos blancos” es algo completamente diferente a si una persona blanca dice: “Malditos negros”, etc.
b) El antisemitismo en el contexto de Palestina
Para Palestina, esto significa que cuando un palestino dice: “Que se jodan los judíos”, esto es, en primer lugar, algo completamente diferente a cuando un israelí dice: “Que se jodan los palestinos” o “Que se jodan los árabes”. Y en segundo lugar, también es algo completamente diferente a cuando un alemán dice: “Judíos de mierda”. Porque en Palestina la historia real y el presente son completamente diferentes de los de Alemania, especialmente de los años 1933-45: mientras que en Europa y especialmente en la Alemania nazi los judíos eran una minoría oprimida y perseguida, en Palestina son los colonos sionistas los que oprimen, expulsan y asesinan a los palestinos. Además, estos colonos no sólo son judíos según su propia imagen, sino que, como sionistas, también afirman actuar en el espíritu y en nombre de todos los judíos del mundo.
Esto significa: 1. que los palestinos están luchando en la vida real contra personas que los confrontan como judíos; por lo tanto, cuando los palestinos hablan de “los judíos”, corresponde a la realidad en cierto modo. En los oídos de muchos alemanes, la frase “los judíos” despierta inquietud debido a nuestra propia historia. Sin embargo, hay que distanciarse de este punto de vista alemán cuando se trata de Palestina o de Oriente Medio, porque al final esta frase es tan generalizante, pero también tan comprensible y, en última instancia, tan poco el verdadero núcleo de los problemas reales como cuando se habla de “los alemanes”, “los americanos”, “los chinos”, “los palestinos”, etc. en la vida cotidiana. El lenguaje y la conciencia cotidianos no suelen ser análisis políticos precisos.
2. En el discurso alemán, algunos llegan a decir que cualquier acción contra una persona judía sería antisemita, especialmente si es violenta. Los palestinos, sin embargo, están luchando en la vida real contra personas que suelen ser judías, pero sólo “por casualidad” en la medida en que no son los palestinos los que los declaran opositores por su judaísmo. Más bien, son los sionistas quienes, debido a su judaísmo, se sienten con el poder de atacar, oprimir y expulsar a los palestinos. Los palestinos no pueden evitar que sus opresores sean judíos y, por supuesto, tienen derecho a defenderse de ellos. Además, como ya he dicho, un acto sólo puede entenderse como antisemita si se dirige contra una persona judía, únicamente porque es judía, y no si resulta ser judía.
3. Si se equipara a los sionistas y a los colonos de Palestina con el judaísmo en su conjunto, esto es, por supuesto, erróneo y bastante peligroso. La culpa de esto, sin embargo, no radica en un antisemitismo específico entre palestinos, árabes o musulmanes, sino que es todo lo contrario, el resultado de la propaganda sionista: equiparan el judaísmo y el sionismo, los sionistas y los colonos con los judíos per se. La propaganda occidental los sigue, y se enreda en contradicciones abiertas: por ejemplo, a los gobernantes de Alemania les gusta explicar que es antisemita equiparar a Israel con el judaísmo (lo cual es correcto), solo para difamar cualquier crítica a Israel como antisemita en el siguiente aliento. En resumen, sionistas y antisemitas acuerdan equiparar a Israel y al judaísmo (y no sólo en esto, por cierto).
¡Es absolutamente cínico acusar a las víctimas del sionismo, es decir, a los palestinos y, en última instancia, a los árabes en su conjunto, de antisemitismo porque repiten como loros esta mentira de los sionistas y del imperialismo occidental! En realidad, en diferentes épocas diferentes partes de la población del mundo árabe equipararon el judaísmo con el sionismo, a veces más, a veces menos. Según Gudrun Krämer, hasta 1948 “sólo unos pocos periodistas, escritores y activistas políticos árabes distinguían entre judíos y sionistas; el Partido de la Izquierda era el más probable que lo hiciera, y tampoco fue coherente. La mayoría hablaba de los judíos, aunque sólo se refirieran a los sionistas”. También se refiere al hecho de que los propios sionistas difuminaron esta distinción en términos de lenguaje y contenido.73
Además, esta falta de diferenciación siempre se ha producido desde la posición de debilidad y opresión en la que los palestinos y el mundo árabe se han encontrado permanentemente frente a Israel desde 1947 a más tardar.
Esta posición también explica por qué los mitos conspirativos son tan virulentos, especialmente en relación con el sionismo. Los sionistas y los cazadores de pseudo-antisemitas ven esto -insuperablemente eurocéntrico e ignorante como siempre- simplemente un rasgo típico del antisemitismo europeo. Sin duda, también se pueden encontrar elementos del antijudaísmo y el antisemitismo europeos en el mundo árabe y musulmán. Pero, por un lado, hay que demostrar de manera muy concreta hasta qué punto se trata realmente de exportaciones antisemitas, y no de (supuestas) similitudes superficiales que luego se reinterpretan (por ejemplo, cuando se presenta el eslogan “Israel asesino de niños” como una nueva edición de la leyenda del asesinato ritual de la Edad Media cristiano-europea). Y, por otro lado, estos elementos también adquieren un carácter diferente en el contexto del colonialismo sionista y de las relaciones de poder reales.
Alexander Flores escribe: “No es casualidad que no sea tanto la idea racial del antisemitismo como sus elementos de teoría de la conspiración […] aceptadas en el contexto árabe. El hecho de que el […] Los judíos se vieron fortalecidos por la inmigración masiva y pudieron establecerse como el grupo dominante, incluso para fundar su propio estado y ganar el apoyo de las principales potencias, primero Gran Bretaña, luego Estados Unidos, muchos palestinos y otros árabes solo pudieron explicarse con la ayuda de teorías de conspiración.74
Por supuesto, esto no cambia el hecho de que tal pensamiento místico de la conspiración debe ser combatido. Sin embargo, principalmente porque, como escribe Helga Baumgarten, se trata de un “[…] engrandecimiento del enemigo”,75 lo que, en última instancia, fomenta la pasividad, ya que -todos conocemos este argumento- “de todos modos no se puede cambiar nada”. Sin embargo, esta lucha contra la falsa conciencia, contra los argumentos derrotistas, contra las reducciones y los prejuicios es completamente diferente de cuando se trata de luchar contra una relación racista de dominación.
También está claro que los elementos antijudíos y antisemitas del antisionismo, que es legítimo en sí mismo, también deben ser combatidos en interés de la protección de los judíos y desde un principio antirracista e “ilustrado”. Sin embargo, hay que subrayar que el antisemitismo entre palestinos y árabes, y en última instancia también entre musulmanes de todo el mundo, es ante todo el resultado de los crímenes y la propaganda sionista. Sólo cuando el sionismo sea derrotado desaparecerá el verdadero caldo de cultivo de esta hostilidad. Esta no es la única razón por la que la superación del sionismo también está en el interés de los judíos de todo el mundo.
c) Los judíos y el antisemitismo en el mundo árabe
Desde el surgimiento del Islam hasta el siglo XX, no ha habido antisemitismo en los países de mayoría musulmana que se acerque a lo que conocemos de Europa: ni guetos, ni pogromos, ni racismo. Los judíos, como todas las minorías religiosas, estaban a veces más o menos desfavorecidos.76 Pero como bien escribe Kai Hafez: “Difícilmente puede haber una disputa sobre el hecho de que los judíos han podido vivir mucho más seguros en el mundo musulmán que en Europa durante los últimos dos mil años. Mientras que el motivo de los “asesinos de Cristo” tuvo un efecto duradero en el mundo cristiano, el judaísmo como religión del libro (ahl al-kitab) está expresamente reconocido en el Corán.77 Bajo el dominio musulmán, el judaísmo experimentó varios días de apogeo, como en la Andalucía española. Incluso un sionista acérrimo y neoconservador como el historiador Bernhard Lewis habla de una “tradición judeo-islámica” que sólo se rompió en el siglo XX.78
La ideología antisemita llegó de Europa al mundo árabe a finales del siglo XIX, es decir, como una exportación colonial. Las primeras traducciones de panfletos antisemitas europeos fueron generalmente hechas por cristianos árabes.79 En vista de la colonización sionista y del abierto apoyo de Gran Bretaña a este proyecto, los motivos antisemitas europeos cayeron en terreno fértil en Palestina al comienzo del período del Mandato. Por lo tanto, como escribe Flores, hubo declaraciones antijudías “entre los palestinos incluso en el período temprano del Mandato; En el curso del mandato se hicieron más frecuentes. Pero solo procedían de algunos palestinos; afectó aún menos a los demás árabes: con algunas excepciones, su coexistencia con los judíos allí permaneció inalterada durante el período del Mandato. Fue sólo a raíz de la fundación del Estado de Israel, la primera guerra árabe-israelí y la catástrofe que la acompañó para los palestinos que una actitud marcadamente antiisraelí y a menudo antisemita se extendió en el mundo árabe”. 80
Las razones de la falta de diferenciación entre judíos y sionistas por parte de las víctimas del sionismo ya han sido discutidas anteriormente. Aquí de nuevo en palabras de Flores: “1. La intensidad del daño causado por el sionismo y la fundación del Estado de Israel, que lleva a sus víctimas a tonos estridentes, exageraciones y generalizaciones; 2. La persistencia del pensamiento en categorías comunitarias (“los judíos”) en la descripción de los acontecimientos políticos y el consiguiente descuido de la diferenciación dentro de las comunidades; 3. La afirmación vehementemente afirmada de los sionistas o de los líderes israelíes de hablar y actuar en nombre de todos los judíos en todo el mundo, y su éxito de largo alcance en marginar a todas las voces judías no sionistas o antisionistas. Esto difuminó la diferencia entre sionismo y judaísmo en gran parte de la percepción pública; 4. La forma en que el proyecto sionista o Israel fue y está incrustado en la política mundial. El movimiento sionista siempre ha sabido presentarse como un puesto de avanzada de las principales potencias mundiales en la confrontación con sus oponentes, y así ha ganado su apoyo. Pero el éxito del sionismo […] habría sido impensable sin ellos. Y este apoyo parece ser muy estable: Israel puede permitirse incluso los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos más flagrantes sin que nadie caiga en sus brazos. Muchos palestinos y árabes sólo pueden imaginar esta enorme historia de éxito como el resultado de una gran conspiración, en la que, además (¡véase la tercera razón que acabamos de mencionar!) Los judíos juegan un papel importante en todo el mundo. Todos estos factores conducen al hecho de que la distinción entre sionismo y judaísmo se difumina a los ojos de muchos árabes y su feroz hostilidad hacia Israel se convierte en antisemitismo. En este proceso, se utilizan todas las fuentes posibles para ilustrar la hostilidad hacia los judíos que ha surgido de esta manera, especialmente toda una serie de piezas del antisemitismo de origen europeo, por lo que llama la atención que no sean tanto sus aspectos racistas los que se reproducen como las fantasías de la conspiración mundial judía”.81
d) Hamás y el antisemitismo
Dicho todo esto, llegamos ahora a Hamás.
Las declaraciones antijudías se pueden encontrar en las primeras publicaciones de Hamás y, sobre todo, en la tristemente célebre carta de 1988, cuyo significado es muy exagerado en Occidente (Mito 12).82 Además, como subraya Hafez,83 en ella no hay un momento eliminatorio frente a los judíos; ni siquiera la “aniquilación” o la “destrucción” de Israel ha sido mencionada en ninguna publicación de Hamás, sino sólo de la “liberación de (enteramente) Palestina”.84 Además de los mitos conspirativos de los que Hamás se ha distanciado durante mucho tiempo85 y de la que hoy no se encuentra nada en sus publicaciones, lo que queda por encima de todo es la interpretación religiosa del conflicto palestino y la falta de distinción entre sionistas y judíos.
Como se explica en el Mito 2, el discurso político de Hamás ya se había “secularizado” fuertemente en el momento de su victoria electoral en 2006. Lo mismo se aplica a su diferenciación entre judaísmo y sionismo, aunque los primeros esfuerzos en esta dirección se pueden ver ya en 1990.86
En el nuevo documento de política de 2017 (Mito 12), se hace una distinción en consecuencia. El punto 16 dice: “Hamás afirma que su conflicto es con el proyecto sionista y no con los judíos a causa de su religión. Hamas no está luchando contra los judíos porque son judíos, sino que está luchando contra los sionistas que ocupan Palestina. Sin embargo, son los sionistas los que constantemente identifican al judaísmo y a los judíos con su propio proyecto colonial y entidad ilegal”. En el párrafo 17 se declara: “Hamas rechaza la persecución de cualquier ser humano o el menoscabo de sus derechos por motivos nacionalistas, religiosos o sectarios”. También critica la tradición antisemita europea, de la que también se distancia, declarando que “no está conectada con la historia de árabes y musulmanes ni con su herencia”. Por último, define el sionismo como una forma de colonialismo de asentamiento, como ya ha existido en otras partes del mundo.87
Cualquiera que lea regularmente las publicaciones de Hamás y las Brigadas Qassam encontrará la confirmación de que hablan constantemente de “sionistas” y “colonos”, pero no de judíos o de un conflicto religioso. Este discurso sobre el colonialismo de asentamiento es ahora en gran medida un consenso entre los grupos de resistencia: todas las organizaciones, desde Hamás y la Yihad hasta Areen al-Usud, pasando por el FPLP y el FDLP, utilizan estos términos y este análisis.
Por supuesto, se puede suponer que estas organizaciones parecen más reflexivas como actores políticos que las amplias masas: Khaled Hroub señala que Hamás y sus dirigentes diferencian mucho más conscientemente entre judíos y sionistas que entre sus partidarios o entre la población palestina ordinaria. Al igual que en el apartado b), sin embargo, también argumenta que tal “uso impreciso” es “lamentable”, pero “en vista de la continua presencia de una fuerza de ocupación israelí agresiva e ilegal, cuya identidad es indudablemente judía (así como sionista así como israelí) a pesar de todos los sutiles criterios de distinción”, es absolutamente subordinado, por no decir, como él lo hace, “irrelevante”.88
Hroub casi resume: “Aunque Hamás hizo pocos esfuerzos en los primeros años después de su fundación para hacer una distinción entre el judaísmo como religión y el sionismo como movimiento político, más tarde -y especialmente recientemente- ha aclarado su posición sobre esta cuestión. La organización debe ser caracterizada como antisionista, pero no antijudía”.89
e) Comparaciones históricas
Por último, hay que señalar aquí que la práctica de Hamás (y de todos los demás grupos de resistencia) de situar a los sionistas en la tradición de los nazis no debe evaluarse como antisemita ni como relativización del Holocausto, como les gusta hacer a los grupos de presión israelíes y a los sionistas alemanes. Por el contrario, una interpretación completamente diferente es mucho más obvia: porque la persecución de los judíos europeos precisamente no se niega, sino que se toma en serio como un crimen contra la humanidad. En el segundo paso, los palestinos se identifican con estos judíos perseguidos, a pesar de que algunos de ellos se han convertido en sus propios opresores en el presente real. No hay nada presuntuoso en esto, sino más bien un acto antisectario e internacionalista que al mismo tiempo libera a la historia judía de la verdadera presunción sionista. En abril de 2008, dos años después del inicio del bloqueo contra la Franja de Gaza, el alto portavoz de Hamás, Mahmoud al-Zahar, declaró en una entrevista: “Hace 65 años, los valientes judíos del gueto de Varsovia se levantaron en defensa de su pueblo. Los residentes de la Franja de Gaza, la prisión al aire libre más grande del mundo, no podemos quedarnos atrás”.90 Un líder de una organización de resistencia palestina eleva la resistencia antifascista de los judíos europeos a un modelo para su propio pueblo. ¡Un gran gesto respetuoso!
Mito 4: “Hamas es fascista”.
Esta acusación la hace toda una serie de “críticos”: desde islamófobos radicales abiertamente derechistas hasta “críticos del islam” pseudoizquierdistas y el MLPD maoísta. Dado que el pueblo burgués no tiene un concepto significativo del fascismo, la acusación de este lado no se abordará aquí; es un término puramente combativo y sólo se utiliza para añadir otra no-palabra a la acusación de “fundamentalismo” e “islamismo” (mito 2).
Los marxistas, por otro lado, deberían satisfacer la afirmación de que el término fascismo no debe usarse de una manera inflacionaria o moral, sino de una manera científica y bien fundada. A continuación se examinará si este es el caso con respecto a Hamas. A modo de ejemplo, se examinan aquí dos actores de la izquierda radical alemana que tienen una autoimagen marxista: el MLPD y la Construcción Comunista (KA).
MLPD
El MLPD es la fuerza de izquierda que más vehementemente levanta la acusación de fascismo contra Hamas. Incluso pidió públicamente la prohibición de la organización, y eso en una situación en la que el Ministerio del Interior ya lo había anunciado. El MLPD ni siquiera se avergonzó de acusar al Estado alemán de no haber tomado medidas anteriores y más duras contra Hamás: “Es escandaloso que sus actividades hayan sido toleradas por el gobierno durante años”.91
Desde el 7 de octubre, el MLPD ha publicado innumerables declaraciones y artículos en su sitio web y en su órgano, la Rote Fahne, en los que Hamás (al igual que la Yihad Islámica y Hezbolá) siempre es calificado de “fascista”, a veces también de “fascista islámico”. (Por cierto: Netanyahu, en cambio, sólo asigna el atributo de “fascistoide” al MLPD.92Veamos ahora cómo el MLPD “demuestra” el “carácter fascista” de Hamás.
De hecho, el MLPD sólo ha publicado un texto en el que justifique por qué Hamás es fascista desde su punto de vista.93 Esto se publicó el 26 de octubre de 2023, en un momento en que el partido no solo había estado pregonando durante mucho tiempo su evaluación del Movimiento de Resistencia Islámica como “fascista” ante el mundo, sino que también había respaldado la prohibición anunciada por el gobierno alemán a Hamas. Por supuesto, es posible que los miembros ya hayan recibido un apoyo de argumentación internamente; sin embargo, el MLPD no ha justificado previamente su difamación de Hamas ante el mundo exterior. No quiero andarme con rodeos: este folleto del 26 de octubre es tan absurdamente malo y estúpido que consideré seriamente borrar todo el mito. El MLPD basa su “argumentación” únicamente en los estatutos de Hamás de 1988. Al hacerlo, está haciendo lo mismo que sólo hacen los sionistas, los islamófobos, los neoconservadores y otros derechistas en su propaganda contra Hamás. Este documento nunca tuvo la importancia que se le atribuye en Occidente y hace tiempo que quedó obsoleto. (Mito 12) Con eso, ya se ha descalificado todo el periódico y podríamos terminar aquí con las críticas.
Sin embargo, uno u otro pasaje debe ser citado aquí, para que los lectores puedan convencerse de la insuficiencia de la argumentación del MLPD sin tener que leer todo el documento por sí mismos. Sigo las afirmaciones del texto en orden:
“Hamas es profundamente racista”, nos enteramos allí. Porque: “Palestina queda entonces completamente ‘legada’ a ‘todas las generaciones de musulmanes’”. Nótese que el “completo” no es una cita de la Carta, sino que proviene del propio MLPD. Presumiblemente, quería resumir el concepto islámico del waqf (sistema de fundación), como se denomina a Palestina en la carta de Hamas. Sin embargo, no sabemos qué tiene que ver todo esto con el racismo.
Además, el MLPD afirma que Hamás “rechaza esencialmente la lucha política por la liberación nacional y social”. Dejemos por un momento a un lado la lucha por la liberación social (ver Mitos 7, 8 y 14): el MLPD “fundamenta” la afirmación de que Hamas no lucharía por la liberación nacional con la siguiente frase de la Carta: “En las mentes de las próximas generaciones musulmanas, es imperativo anclar la idea de que la cuestión palestina es una cuestión religiosa”. (Artículo 15) Una vez más, surge la pregunta de por qué esto debería ser evidencia de un “carácter fascista”, pero bueno. Sin embargo, hay que contrarrestar la afirmación del MLPD de que el patriotismo y la lucha de liberación nacional pueden basarse ideológicamente en diferentes fundamentos ideológicos, religiosos y morales. En el artículo 12, la propia carta de Hamás afirma precisamente este hecho: “Si otros patriotismos están relacionados con motivos materiales, humanos y territoriales, entonces el patriotismo del Movimiento de Resistencia Islámica posee todo esto y, además, y esto es lo más importante, tiene motivos divinos que le dan espíritu y vida”.94
El texto continúa: “Es fascista misógina”. Por fin algo tangible de nuevo. “La mujer musulmana desempeña un papel tan importante en la lucha de liberación como el hombre, porque produce hombres, y su papel en la orientación y educación de las próximas generaciones es importante”. Sin embargo, según la ideología de Hamás, el papel de la mujer se refiere exclusivamente a la esfera familiar. Aquí se supone que ella debe dar a luz a niños y adoctrinarlos en el sentido de la ideología fascista, y al hacerlo se supone que debe dar a luz al Islam [¡sic!] que el hombre sea sumiso”. De acuerdo, la imagen familiar de Hamas es obviamente patriarcal-conservadora, pero ¿es eso sinónimo de fascista? Lo único “fascista” que se cita aquí es la ideología de Hamás, con la que hay que “adoctrinar” a los niños. Sin embargo, hasta este momento del texto, el MLPD no ha aportado ninguna prueba de que esta ideología sea fascista. Además, hay que mencionar aquí otro pasaje de la Carta, que llama a las mujeres a luchar por la liberación nacional. Porque en el caso de que un enemigo ocupe la patria, dice: “[Incluso] la mujer sale a pelear contra él sin el permiso de su marido”.95 No hay que sobreestimar esta frase y, por supuesto, no abolió la imagen patriarcal de la familia de Hamás, pero está claramente en contradicción con la total sumisión de las mujeres a los hombres.
“Los programas de ayuda social con los que Hamás ganó influencia son racistas y están orientados hacia la “comunidad nacional”: “La sociedad musulmana es una sociedad solidaria entre sí”. Es terrible que los musulmanes se solidaricen unos con otros… Pero en serio: sólo he conocido la equiparación de la comunidad musulmana con una comunidad nacional fascista de los sionistas “antialemanes”. En lo que se refiere a la relación de Hamás con los palestinos no musulmanes, Khaled Hroub subraya: “Hamás ha demostrado una sensibilidad extraordinaria en su comportamiento hacia los cristianos palestinos” y “ha establecido con éxito relaciones amistosas con los cristianos palestinos”.96
Que yo sepa, Hamás no hace distinciones entre musulmanes y cristianos en su labor caritativa. Por cierto, los no musulmanes también pueden convertirse en miembros de Hamas97 y en las elecciones de 2006, apoyó a dos candidatos cristianos independientes.98 “En la práctica, sin embargo, la sociedad musulmana supuestamente solidaria entre clases se reduce a limosnas sociales”, concluye el MLPD. Esto no es del todo cierto, pero tampoco del todo erróneo, pero, sobre todo, no tiene nada que ver con el fascismo o el racismo. Las limosnas son la respuesta de todos los actores burgueses (con la excepción de los darwinistas sociales más descarados y los ultraliberales) al empobrecimiento derivado del capitalismo.
Y por último: “Hamás representa los mitos conspirativos fascistas y es extremadamente antirrevolucionario y anticomunista”. Para los mitos de la conspiración, véase el Mito 3 y el Mito 14 para la verdadera relación de Hamás con la izquierda política. De lo contrario, hay que subrayar aquí una vez más que Hamás se ha distanciado hace mucho tiempo de la Carta o de sus pasajes problemáticos. (Mito 12) Y, por último, el MLPD también plantea la acusación de antisemitismo. (Mito 3 de nuevo) Eso fue todo. Eso es todo lo que hay que hacer.
Construcción comunista
El KA ha levantado la acusación de fascismo contra Hamas mucho menos histéricamente que el MLPD. De hecho, solo se le puede encontrar a simple vista en sus publicaciones. En un texto de 2018, describe el “fundamentalismo islámico” en su conjunto como fascista. A Hamás sólo se le menciona de pasada como uno de los varios grupos de “fundamentalistas exiliados”.99 El texto citado aquí es la segunda parte de una serie de dos artículos del KA sobre el “fundamentalismo islámico”. En la primera parte, se presenta la “tesis central” de los textos, según la cual el “fundamentalismo islámico” es “una ideología fascista”.100 Todos los actores islámicos están subsumidos bajo este término, desde los Hermanos Musulmanes y Hamás hasta el Hezbolá libanés y los talibanes, pasando por Al Qaeda y el Daesh.101 El segundo artículo, en particular, se lee en gran parte como un informe (pintado de rojo) de la Oficina para la Protección de la Constitución. El primero, en cambio, es sobre todo una serie de ejemplos muy diferentes, en los que una gran variedad de actores de diferentes países, que de alguna manera se agrupan como “fundamentalistas islámicos”, han hecho cosas que nosotros, como comunistas, consideramos políticamente malas (política capitalista, pactos con los imperialistas, persecución de los comunistas, etc.). Entre ellos se encuentran los clásicos: la revolución iraní de 1979 (véanse también los mitos 13 y 14), el apoyo de Occidente a los muyahidines afganos, las monarquías petroleras árabes y la colaboración de Amin al-Hussayni, el llamado Gran Muftí de Jerusalén, con los nazis, y la supuesta proximidad de los Hermanos Musulmanes al fascismo europeo.102 (Para esto último, véase Mito 5)
No hay una argumentación real, como tampoco hay un análisis más profundo de uno solo de los eventos que se mencionan allí. Sobre el trasfondo de este panorama histórico tan cuestionable, la tesis se justifica en última instancia por el hecho de que el “fundamentalismo islámico” es ante todo una “ideología fascista”. A diferencia del MLPD, el KA ni siquiera intenta probar esta afirmación con argumentos concretos como el supuesto racismo o similares. En su lugar, presenta un mosaico de escenas teóricas inconexas, puntos ideológicos destacados y fragmentos históricos, lo que da como resultado una imagen general muy borrosa de momentos reaccionarios, que de alguna manera se vende bajo la etiqueta de “fundamentalismo islámico” como un supuesto análisis.
Sin embargo, es posible que el KA haya cambiado su posición sobre este tema en los últimos años. Recientemente, en 2021, acusó a Hamás y a la Yihad Islámica de “posiciones fundamentalistas islámicas, antisemitas y fascistas, como pedir la aniquilación del pueblo israelí o la expulsión de los judíos de Asia Occidental”.103
Ambas son tonterías absolutas y corresponden a las mentiras propagandísticas más descabelladas (pro)sionistas.104 El 9 de octubre, sin embargo, describió a Hamas, o las Brigadas Qassam, como una de varias “organizaciones de resistencia palestina”. Aunque aquí se habla de “características reaccionarias del nacionalismo burgués palestino y del fundamentalismo islámico”, el KA se expresa de manera completamente diferente al MLPD sobre el 7 de octubre: “Tanto en lo que se refiere a los medios utilizados y a los combatientes de la resistencia como en el [sic!] En términos de los éxitos militares tácticos logrados, esta operación no tiene parangón en las últimas décadas”.105
Una pequeña señal de esperanza de que se alejará de su posición absurda y por lo tanto dejará al MLPD completamente solo dentro de la izquierda política en Alemania (y presumiblemente en todo el mundo) en lo que respecta a la difamación de Hamas como “fascista”.
Mito 5: “Los Hermanos Musulmanes tenían contactos con la Alemania nazi”.
Si a Hamás no se le puede llamar fascista hoy en día, los Hermanos Musulmanes (HM) son al menos culpables de colaborar con los fascistas europeos, ¿no es así? (Ver también Mito 4)
Los Hermanos Musulmanes y el fascismo
Esto tampoco es correcto. En la década de 1930, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, la HM recibió varios fondos de las autoridades alemanas, pero esto no era inusual. Durante la guerra, “algunos miembros de la Hermandad” también distribuyeron panfletos pro-alemanes. Hassan al-Banna, el fundador de la Hermandad Musulmana, se vio entonces presionado y declaró públicamente su lealtad a los gobiernos egipcio y probritánico.106
Dado que no hay evidencia de ninguna cooperación significativa, a menudo se construye un “parentesco” entre los HM y los movimientos fascistas en Europa. Los argumentos suelen basarse en superficialidades, como la estructura organizativa y la apariencia o el “radicalismo” o el “totalitarismo”. En realidad, sin embargo, al-Banna ya estaba tratando de distanciarse del fascismo en 1934. Consideraba estos movimientos como “fenómenos completamente extraños que eran incompatibles con los fundamentos religiosos y culturales del Islam”, como escriben Israel Gershoni y Götz Nordbruch. La denuncia de estos modelos de gobierno como paganos y satánicos proporcionó a la alternativa islámica propagada una legitimidad adicional. Además, estaba la caracterización de las formas de sociedad en Europa y Estados Unidos como la base de la amenaza imperialista a la comunidad islámica. Según los Hermanos Musulmanes, el impulso de expansión territorial, económica y cultural era parte de la esencia de las sociedades occidentales […] El fascismo italiano y el nacionalsocialismo no fueron una excepción desde este punto de vista”.107 El colonialismo italiano en África y las ideologías raciales de los fascistas en particular fueron objeto de un rechazo total;108 Gudrun Krämer enumera numerosas declaraciones de al-Banna de los años 1934-48 en las que se opone al racismo.109
De hecho, había muchos más miembros nacionalistas del ejército, que más tarde también mantuvieron contacto con agentes alemanes durante la campaña germano-italiana del norte de África en el círculo o en el círculo de los llamados Oficiales Libres en torno a Gamal Abdel Nasser, que fueron clasificados como nacionalistas de izquierdas a árabes-socialistas. Una figura clave es Anwar al-Sadat, sucesor de Abdel Nasser, quien alejó al país del “socialismo árabe”, lo acercó a Occidente e hizo la paz con Israel en Camp David en 1978, convirtiendo a Egipto en el primer país árabe en reconocer a la entidad sionista como Estado. Pero ni siquiera él siente simpatía por la ideología de los nazis, y él, como la mayoría de los egipcios nacionalistas y patriotas, no confiaba en una victoria alemana para expulsar a los amos coloniales británicos, sino que esperaba mantener a su país fuera de la guerra mundial.110
Amin al-Hussayni como testigo clave
La figura central que acusa a los palestinos o incluso a todos los árabes o incluso a los musulmanes colectivamente de estar cerca del fascismo es Hajj Amin al-Hussayni, uno de los líderes del movimiento independentista palestino durante el dominio colonial británico. De hecho, fue probablemente el único palestino que se puede demostrar que cooperó con la Alemania nazi.111 Fue culpable de esta colaboración entre 1941 y 1945 y presumiblemente también sabía sobre el Holocausto. Sin embargo, la acusación derivada de esto por Netanyahu, entre otros, de que fue él quien le dio a Hitler la idea de genocidio en primer lugar, es ridícula.112 Más bien, al-Hussayni se dejó explotar por el ejército fascista para la propaganda y el reclutamiento, especialmente en los Balcanes y la Unión Soviética, mientras que los nazis ni siquiera le prometieron apoyo oficial para su verdadero objetivo, la liberación de los países árabes del colonialismo.113 Como señala Ilan Pappe, la obra de al-Hussayni debe ser vista y juzgada en el contexto de la lucha anticolonial de los palestinos: “Luego miró a su alrededor en busca de los enemigos de su enemigo, y ellos, es decir, Alemania e Italia, hicieron lo mismo. Después de dos años bajo la influencia de la Alemania nazi, ya no veía ninguna diferencia entre el judaísmo y el sionismo. Sólo unas pocas fuerzas, ciertamente no el movimiento sionista, insistieron en tal diferencia en ese momento. La voluntad de Amin de trabajar como comentarista de radio para los nazis y ayudarles a reclutar musulmanes en los Balcanes para el esfuerzo bélico alemán es un punto negro en su carrera. Pero al hacerlo, no actuó de manera diferente a los líderes sionistas en la década de 1930”.114
La última observación de Pappe alude al hecho de que los sionistas hicieron un pacto con los nazis, entre otras cosas, al concluir el notorio Acuerdo de Ha’avara con los fascistas alemanes en 1933, que tenía como objetivo persuadir a los judíos alemanes para que huyeran a Palestina (y lo hicieron), que bloquearon la lucha contra la Alemania nazi a nivel internacional y que colaboraron con los servicios de inteligencia alemanes contra los británicos.115 Al mismo tiempo, también hay que subrayar aquí que antes de caer en desgracia en Londres y posteriormente pasarse a las potencias del Eje, al-Hussayni colaboró con la potencia colonial británica, fue nombrado muftí de Jerusalén por ella en primer lugar (aunque su formación religiosa no era suficiente para ello) y la sirvió en la medida en que ayudó a dividir el movimiento nacional palestino y a luchar exclusivamente contra la población judía. pero no contra los británicos.116 Una discusión multifacética de al-Hussayni como persona se puede encontrar en Rainer Zimmer-Winkel,117 el trotskista libanés Gilbert Achcar le da un ajuste de cuentas fáctico pero tajante.118
Al-Hussayni probablemente había estado en estrecho contacto con los Hermanos Musulmanes en Egipto y Palestina desde la década de 1920, pero nunca perteneció a ellos.119 Más bien, era una figura central en el movimiento nacional palestino, provenía de una familia influyente y ocupaba un papel formal de liderazgo religioso, lo que lo convertía en una figura positiva. El historiador sionista Joseph Croitoru muestra cómo se están haciendo intentos para construir una conexión entre la Alemania nazi y los Hermanos Musulmanes hasta Hamas con la inclusión de al-Hussayni: Escribe sobre “indicios” de que los nazis “tenían sus dedos en el pastel” en la construcción de ramas paramilitares de la Hermandad Musulmana; informa -sin dar la hora exacta- sobre los fondos alemanes que fueron a parar a los Hermanos Musulmanes y afirma que al-Hussayni, que supuestamente “trabajó estrechamente con los nacionalsocialistas ya entonces”, actuó “obviamente” como intermediario. Debido a que todo el asunto es demasiado delgado, Croitoru continúa: “Sea lo que sea que haya sido esta cooperación” -en otras palabras, realmente no importa cómo fue realmente-, “los Hermanos Musulmanes y los nacionalsocialistas […] un objetivo común”, a saber, la “liberación de Palestina del dominio británico”.120 El hecho de que los nazis quisieran heredar a los británicos como potencia colonial, mientras que los palestinos luchaban por su independencia nacional, no es una diferencia digna de mención para el sionista Croitoru. La lucha de Hamás por la liberación de Palestina del dominio sionista es, por supuesto, Croitoru no deja lugar a dudas, la continuación de esta “guerra santa” conjunta (el título imaginativo del subcapítulo de su libro) entre los nazis y los Hermanos Musulmanes. El hecho de que los izquierdistas en solidaridad con Palestina, como Construcción Comunista, también argumenten de manera similar (ver Mito 4) es alarmante.
En realidad, al-Hussayni no desempeña un papel importante ni para los HM ni para Hamás en la actualidad; este último hace una referencia mucho más positiva a los líderes guerrilleros y héroes populares de la década de 1930, como Izz ad-Din al-Qassam, que da nombre al ala militar de Hamas, o Abdul Qader al-Hussayni.121 Achcar,122 Flores123 Abacero124 Motadel,125 Cartón126 Pesca salvaje127 y muchos otros están de acuerdo en que el papel y la influencia del muftí en el discurso occidental están ampliamente sobreestimados; René Wildangel habla incluso de una “verdadera “muftización” de la historia árabe-palestina del período del Mandato en la historiografía.128 A propósito, el muftí tiene este énfasis excesivo políticamente motivado en su papel por parte de los actores occidentales pro-sionistas en común con la notoria carta de Hamas (Mito 12).
Mito 6: “Hamas es una organización terrorista”.
a) ¿”Organización terrorista“?
En primer lugar, hay que cuestionar el término aquí, porque “terror” todavía se puede definir hasta cierto punto. Pero con una “organización terrorista” se hace difícil. El terror puede definirse en términos muy generales como “[la diseminación sistemática] del miedo y el terror a través de acciones violentas (especialmente para lograr objetivos políticos)”.129
Es evidente de inmediato que, en realidad, este tipo de violencia política no solo es utilizada por actores no estatales, que son lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en “organizaciones terroristas”, sino también por actores estatales, y a una escala mucho mayor. Basta pensar en las guerras coloniales de conquista y opresión, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, las guerras anticoloniales de liberación, Vietnam, Afganistán, Irak, etc., y por último, pero no menos importante, las acciones de los sionistas en Palestina, Líbano o Siria. Por lo tanto, hay un amplio terror de Estado. Sin embargo, la designación de “Estado terrorista” es bastante rara y tiene un evidente significado moral, propagandístico o polémico.
Por el contrario, la mayoría de las organizaciones de lucha armada que son realmente relevantes en la historia tenían un programa político, y la violencia no era más que la continuación de esta política por otros medios. Por cierto, en el siglo XIX e incluso en el siglo XX, “terrorista” era una autodesignación positiva de los grupos políticos, especialmente en contraste con la violencia de las organizaciones criminales.130
Hoy, en cambio, el término tiene connotaciones claramente negativas. Por lo tanto, reducir a estos grupos al uso de la violencia, es decir, a calificarlos de “organización terrorista”, no sólo es peyorativo, sino también superficial y, en última instancia, dirá poco sobre su carácter político. Se puede criticar o rechazar la violencia (desproporcionada) como herramienta política, pero un objetivo político o una ideología siguen siendo buenos o malos por el momento, independientemente de los medios por los que se impongan: un racista pacifista es menos peligroso, pero aun así su ideología es errónea y hay que combatirla; Y un movimiento que lucha contra la opresión nacional o social no pierde automáticamente su legitimidad solo porque use la violencia para hacerlo.
Sin embargo, nos encontramos con el término “organización terrorista” una y otra vez en el discurso político y mediático y, por lo tanto, también en el habla cotidiana. Obviamente, se trata de una cuestión de política de dominación: la política y los medios de comunicación dictan quién debe ser considerado un “terrorista” y quién no. Uno de los ejemplos más famosos es el de Nelson Mandela, que estuvo en la lista de terroristas de Estados Unidos hasta 2008, una década y media después del fin del apartheid, su elección como presidente de Sudáfrica y su nombramiento como Premio Nobel de la Paz. Desde el punto de vista discursivo, también es emocionante seguir el apoyo de los medios de comunicación de Occidente a los “muyahidines” en Afganistán: el asesinato de “infieles” se celebró en Der Spiegel en ese momento y los combatientes de la yihad fueron honrados como “luchadores por la libertad”.131 De este modo, la revista estaba en línea con el discurso y la política predominantes en la RFA y en Occidente.
Este poder estatal, que ya se puede notar en la soberanía del discurso, se despliega plenamente cuando la clasificación como “organización terrorista” también ha llegado al campo legal, por ejemplo, en forma de las listas de terroristas de la UE y los párrafos 129a y b del Código Penal. Entonces los oponentes políticos pueden ser reprimidos a voluntad. La arbitrariedad se demuestra mejor con la prohibición del PKK en la RFA: las banderas del PKK están prohibidas en Alemania debido a la clasificación como “organización terrorista extranjera” y la prohibición de actividades de 1993. Enarbolar la bandera de las YPG, la organización hermana del PKK en Siria, lógicamente no está prohibido porque las YPG colaboran con la OTAN, a menos que la lleves como “reemplazo” de la bandera del PKK. El momento en que se aplica este caso es una “cuestión de discrecionalidad”, es decir, jerga legal para la arbitrariedad. Al igual que el término “terrorismo”, los párrafos 129 a y b también pueden modificarse a voluntad.
Personalmente, por lo tanto, soy fundamentalmente escéptico sobre el uso del término “organización terrorista” en un sentido analítico. Por supuesto, la NSU o las SS y SA pueden ser descritas como organizaciones terroristas fascistas y ciertamente no se equivocan, ya que como brazo armado de los fascistas tenían la tarea principal de sembrar el terror. Llamar a las FOI una milicia terrorista con el fin de irritar y recoger las narrativas existentes y darles la vuelta deliberadamente también puede tener sentido desde el punto de vista propagandístico. En ambos casos, sin embargo, el análisis político del contenido está al principio. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la designación como “terrorista” siempre está determinada políticamente y que normalmente son los gobernantes los que determinan quién es “terrorista” y quién no.
b) Violencia contra la población civil
Por lo tanto, si ahora hemos rechazado el término “organización terrorista”, todavía es posible que Hamás esté cometiendo actos de violencia terrorista. Hay que distinguir entre dos cosas: en primer lugar, los atentados que pueden clasificarse como terroristas (al menos desde el punto de vista jurídico) suelen ser equivalentes a crímenes de guerra según el derecho internacional. Los crímenes de guerra concretos deben presentarse ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional (si se la reconoce) o, según el Código Penal Internacional, también ante los tribunales alemanes. Pero los cargos contra cualquier persona clasificada como “partidarios del terrorismo” o incluso “simpatizantes” en los tribunales alemanes son absurdos. O cometes un crimen de guerra tú mismo o proporcionas ayuda e instigación, o no lo haces.
En el caso de Palestina, la acusación más común contra Hamás es que ataca a civiles. Sin embargo, en el contexto de los asentamientos coloniales, se trata de una cuestión complicada, porque los colonos son objetivamente parte de la ocupación, por no mencionar el hecho de que un número extremadamente grande de ellos están armados y casi todos los israelíes están haciendo el servicio militar. El asentamiento de personas en territorios ocupados es un crimen de guerra.132
Un movimiento de liberación nacional plantea un dilema a este crimen, porque si se usa la violencia contra esta población, también se está cometiendo un crimen desde el punto de vista jurídico puramente formal, y un crimen no justifica ningún otro crimen; Sin embargo, si se les permite hacerlo, la liberación es prácticamente imposible. Aquí es donde la ley llega a sus límites. Moral y políticamente, por supuesto, se vuelve pérfido sobre todo cuando esta población de colonos también se esconde detrás de su “civilidad”, mientras que al mismo tiempo está muy consciente y por razones ideológicas detrás del acaparamiento (ilegal) de tierras.
En vista de esto, está muy extendido en el discurso actual de la resistencia palestina que todos los colonos (adultos) son generalmente considerados objetivos legítimos. Hasta 1994, el propio Hamás hacía una distinción estricta entre los soldados sionistas, por un lado, y los colonos “civiles”, por el otro. La masacre de Hebrón en 1994, en la que el asesino en masa Baruch Goldstein disparó y mató a 29 palestinos que rezaban en una mezquita, cambió eso. A partir de este período, Hamás también atacó por primera vez a no combatientes. En aquella época, eran principalmente los llamados atentados suicidas los que tenían un gran efecto psicológico y se llevaban a cabo en situaciones excepcionales, como en respuesta al asesinato de líderes de Hamás o durante la Segunda Intifada.133
Más tarde, fueron principalmente ataques con cuchillos y hoy en día son principalmente ataques con automóviles o armas de fuego contra colonos, que deberían considerarse “ataques contra civiles” en el sentido del derecho internacional, pero que gozan de gran apoyo entre la población palestina y también entre todas las organizaciones de resistencia. Tenemos que lidiar con este hecho como un movimiento de solidaridad. El hecho de que la nueva situación legal y la actual represión en la RFA restrinjan descaradamente un debate porque rápidamente se acusa a uno de “aprobar delitos” según el artículo 140 del Código Penal alemán, nos presenta obstáculos aún mayores en esta disputa que la presión pública del actual discurso moralmente enormemente inflado y completamente histérico sobre el 7 de octubre y Hamas. Cabe señalar aquí que el propio Hamás, en su descripción de la “inundación de Al-Aqsa”, distingue entre combatientes (israelíes armados) y civiles (israelíes desarmados).134
Mahmood Mamdani, sin embargo, señala que el “dilema civil” se aplica a ambos bandos en el contexto del colonialismo de asentamiento y el movimiento de liberación nacional: “Al igual que las guerrillas de izquierda, los colonos de derecha difuminan los límites entre lo civil y lo militar”.135 Recientemente, en el contexto de la solidaridad con Palestina, se ha escuchado repetidamente la advertencia de que hablar de “mujeres y niños” “normaliza” el asesinato de hombres palestinos. Parte de este problema es también que tenemos que recordar que los guerrilleros palestinos no son generalmente soldados clásicos que están a sueldo de un ejército permanente y que han decidido más o menos voluntariamente ir a la guerra. Son hombres (a menudo muy jóvenes) que se sienten obligados a defender su patria y arriesgan sus vidas para hacerlo. Por lo tanto, debemos pensar detenidamente si distinguimos entre los combatientes de la resistencia palestina y los civiles. Ahora se puede objetar que esto le haría el juego a los sionistas, que declaran “culpable” a toda la población de Gaza y la equiparan con Hamás. Pero nuestra respuesta debe ser fundamentalmente opositora: ni los palestinos en su conjunto, ni Hamás ni el resto de la resistencia son “culpables”, ¡sólo lo son los sionistas! Incluso los combatientes de la resistencia no son asesinados, sino asesinados, ¡porque el régimen sionista y su violencia no tienen legitimidad!
c) “Atentados suicidas“
Innumerables textos y películas se han escrito y se han hecho películas sobre este fenómeno en Occidente. No porque sea particularmente relevante política o legalmente, sino sobre todo porque aparentemente fascina y asusta a muchas personas: una persona mata a otras y acepta su propia muerte. Pero al final, esto sucede en una de cada dos películas de guerra: un “héroe” se lanza contra una fuerza enemiga superior y hacia una muerte segura. Solo se vuelve espeluznante y extraño o “fascinante” cuando la persona abnegada es musulmana y usa explosivos en lugar de un arma de fuego o una espada.
Mamdani escribe: “A menudo me he preguntado si el sorprendente término ‘terrorista suicida’ describe adecuadamente la práctica y la motivación detrás de ella. Claramente, el objetivo principal del terrorista suicida no es acabar con su vida, sino con la de otros que se definen como enemigos. Ante todo, debemos entender al terrorista suicida como una especie de soldado. […] El atentado suicida debería ser clasificado como una forma de violencia política moderna y menos estigmatizado como un signo de barbarie”.136 Y también él señala que el martirio se celebra ciertamente en Occidente: “Recuerdo cómo, cuando era estudiante de secundaria en Uganda, tuve que memorizar un poema de Tennyson en el que el poeta elogiaba el heroísmo de los soldados británicos que iban “a las garras de la muerte” con los ojos abiertos”.137
Dejando a un lado la psico-frivolidad exotizante, el asunto se aclara rápidamente: las operaciones de los mártires no son crímenes de guerra en sí mismas. No está prohibido forzar la propia muerte, ni está prohibido el uso de explosivos. Lo único que importa es el objetivo de la operación: si es militar y, por lo tanto, legítima o civil y, por lo tanto, ilegítima (en el sentido del derecho internacional). Por supuesto, estas operaciones son también social y psicológicamente una expresión de algo. Desde el punto de vista de la sociedad, sin embargo, si se producen con más frecuencia, probablemente testimonian menos un “fanatismo religioso” que una inferioridad militar y una situación social desesperada.
Por último, algunos datos sobre Hamás y los llamados atentados suicidas: Como se mencionó en el apartado b), comenzaron después de la masacre de Goldstein y luego tuvieron lugar en situaciones excepcionales. Además de Hamás, la Yihad Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa también llevaron a cabo operaciones de martirio con explosivos. En abril de 2008, Hamás se atribuyó la responsabilidad de una última operación de mártires, en la que los combatientes se inmolaron. Sólo hirieron a soldados israelíes,138 Es por ello que esta operación era indudablemente legítima según el derecho internacional.
d) “Toma de rehenes“
Si bien los combatientes de Hamas generalmente habían matado a soldados capturados en años anteriores, se han utilizado para liberar a sus propios prisioneros desde 1992 a más tardar.139 La experiencia ha demostrado que los detenidos por las Brigadas Qassam son bien tratados –a diferencia de los rehenes palestinos en las cárceles sionistas– incluso si están detenidos durante años, como Gilad Shalit, o en las circunstancias más adversas, como el 7 de octubre.
La captura arbitraria, especialmente de no combatientes, puede ser problemática desde el punto de vista jurídico y moral. Sin embargo, hay que señalar aquí cuatro puntos: 1. el dilema descrito en el apartado b). 2. El hecho de que la toma de rehenes es una práctica relativamente común, especialmente en guerras entre oponentes desiguales o en guerras de guerrillas. 3. al hecho de que en estas tomas de rehenes el “mayor valor” de los colonos sobre los pueblos indígenas puede volverse contra los amos coloniales: un solo colono capturado puede ser intercambiado por muchas veces el número de rehenes palestinos. Por cierto, esta práctica no sólo es perseguida por Hamás, sino que en el pasado también ha sido llevada a cabo principalmente por el FPLP, pero también por Fatah, el FDLP, la Yihad, el FPLP-GC, etc. Y 4. Hay que subrayar que la política de arrestos sionistas no es más que una toma de rehenes por parte del Estado, y a una escala mucho mayor de lo que Hamás podría hacerlo. Decenas de miles de niños y jóvenes palestinos siempre se han visto afectados por esto y lo siguen siendo hoy en día.
e) Clasificación de Hamás como “organización terrorista”
Por último, algunos datos sobre la clasificación de Hamás como “terrorista”: Hamás está catalogado como “organización terrorista” exclusivamente por los Estados occidentales, es decir, Israel, los Estados de la UE, EE.UU., Gran Bretaña, Canadá, Australia y Japón, así como Paraguay.140 Por lo tanto, estamos hablando de una minoría que se desvanece de 33 en comparación con los 160 estados miembros de la ONU. E incluso países europeos como Noruega y Suiza o Turquía, miembro de la OTAN, no criminalizan a Hamas. Por cierto, la inclusión de Hamás en la lista de terroristas de la UE en 2003 fue inicialmente sólo el resultado de un enorme cabildeo israelí.141
El hecho de que varios líderes de Hamás también hayan sido añadidos a la lista como individuos desde el 7 de octubre subraya que se trata principalmente de una herramienta de arbitrariedad política y simbolismo.
f) Conclusión
Hamas no es una “organización terrorista”, sino 1. una parte elemental del movimiento de liberación palestino (mitos 8 y 9) y 2. el único gobierno de los palestinos en los territorios ocupados en 1967 que hasta ahora ha sido legitimado por elecciones. (Mito 10) El hecho de que las potencias imperialistas occidentales y el régimen colonial sionista lo califiquen de “terrorista” es, por un lado, lógico y, por otro, completamente inaceptable. Debemos denunciar esta difamación como lo que es: una expresión de arrogancia colonial y, sobre todo, una deslegitimación y deshumanización de la resistencia palestina dirigida a la eliminación. Porque tenemos que darnos cuenta de que no se trata de una sola palabra: “Los terroristas”, según el discurso predominante y la práctica común, pueden ser asesinados sin peros. Por lo tanto, la designación de “terrorista” legitima directamente el asesinato de luchadores por la libertad palestinos y políticos (gubernamentales). Por ejemplo, la inclusión de Hamás en la lista de terroristas de la UE dio luz verde al asesinato de Shaykh Yassin y Abdel Aziz Rantisi (así como de numerosos familiares y transeúntes) por parte de Israel, que se llevó a cabo poco después.142 En la actualidad, tenemos que experimentar que los sionistas incluso legitiman un genocidio al equiparar al pueblo de Gaza con su gobierno. La respuesta, sin embargo, no puede ser una separación artificial entre los palestinos y su organización de liberación más popular y su gobierno electo, sino el rechazo consecuente a la denigración de Hamas como una “organización terrorista”.
Mito 7: “Hamas es reaccionario”.
Entonces, si Hamas no es ni fundamentalista (mito 2) ni fascista (mito 4), antisemita (mito 3) ni terrorista (mito 6), al menos es reaccionario, ¿no es así? Después de todo, como se describe en el Mito 2, ella es religiosamente conservadora. La respuesta es: Sí y no, pero principalmente no. Sí, en la medida en que se quisiera calificar al conservadurismo de “reaccionario” en principio. Un sí “potencial”, en la medida en que Hamás, como fuerza burguesa y conservadora, por supuesto siempre puede asumir un papel reaccionario en el futuro –por ejemplo, como traidor a la causa nacional palestina– o en el futuro si se opone activamente a una revolución socialista. Esto último podría suceder incluso antes de la liberación nacional de Palestina, si fuerzas como el FPLP o el Partido Comunista Palestino tomaran la iniciativa en el movimiento de liberación palestino, pero este escenario es actualmente muy poco probable. O -y esto es mucho más probable- después de la liberación nacional, cuando la lucha por el socialismo debe ponerse más claramente en el orden del día. Un rotundo no, en la medida en que la cuestión nacional es actualmente claramente la contradicción principal en Palestina y Hamás se presenta claramente como una fuerza relativamente fiable y coherente en esta lucha en comparación con otras fuerzas burguesas. (Ver Mitos 8, 9, 10, 11 y 14)
En última instancia, este mito puede ser refutado menos con hechos que con argumentos. Los hechos se encuentran en los mitos 1 a 6 y en los mitos 9, 10, 11 y 14. Al final, la pregunta es sobre todo esto: ¿A qué se refiere la categoría “reaccionario”? ¿Se refiere exclusivamente a la ideología o a toda la naturaleza, especialmente social, de un actor? ¿Se entiende en relación con las relaciones sociales, es decir, dialécticamente-materialista? ¿O pretende ser esencialista, es decir, supone la inmutabilidad y, por lo tanto, es idealista y dogmática? En mi opinión, Hamás sólo puede ser evaluado en relación con la situación social histórica real en Palestina. Con respecto a los temas sociales y culturales, solía mantener fuertes posiciones conservadoras, pero hoy en día tiende a mantener posiciones conservadoras moderadas, y está expuesta a estados de ánimo sociales a los que es muy receptiva.143
Por otra parte, ciertamente no es social-revolucionario, sino que aboga por una sociedad capitalista-burguesa, aunque la lucha contra la pobreza en el sentido de medidas caritativas y una política social fuerte juegan un papel central en ella, al igual que la independencia económica del régimen sionista y una mejor política comercial en comparación con los estados imperialistas y vecinos.144 En relación con la lucha central en Palestina, la revolución nacional, por otro lado, es en gran medida consistente, muy abnegada, relativamente inteligente y fuertemente anclada en las masas, en otras palabras, revolucionaria. Así que es a la vez: burgués-conservador y revolucionario. Al final, las etiquetas siempre son peores que los análisis. Pero la etiqueta de “reaccionario” en relación con Hamás es, en cualquier caso, errónea.
Por último, un comentario sobre el elefante en la habitación cuando se trata de este tema: En este debate, siempre surge la sospecha de que al final se trata menos del carácter burgués de Hamas que de su color religioso. El movimiento también comparte su carácter burgués con otras organizaciones de liberación, como Fatah en las décadas de 1960 a 1980, el ANC antes del fin del apartheid, etc. Dado que la hostilidad latente hacia la religión y especialmente la islamofobia es, por desgracia, un gran problema entre los izquierdistas, hay que señalar aquí que una crítica marxista de la religión es algo completamente diferente del chovinismo hacia las personas religiosas. En mi opinión, este último está desgraciadamente mucho más extendido entre los izquierdistas que el primero. (Véase también el Mito 14)
Mito 8: “Hamas no es un movimiento de liberación”.
Siguiendo con el Mito 7, uno puede seguir argumentando aquí. Hamas lucha por la liberación nacional de Palestina; lucha contra el colonialismo de asentamiento y el imperialismo occidental que lo respalda. Su objetivo es un país liberado de la ocupación extranjera, el apartheid, el racismo y la opresión nacional, donde la población tenga los mismos derechos independientemente de su afiliación religiosa y donde los pueblos indígenas desplazados gocen del derecho al retorno. ¿Por qué una organización, un partido y un movimiento que persigue ese objetivo, que está anclado en las masas populares y goza de un apoyo mucho más allá de su base directa (también entre la población cristiana, entre los laicos y los izquierdistas), no debería ser un movimiento de liberación?
Si uno se ha distanciado de los mitos 1 a 7, no se adhiere a las ideas románticas de guerrilleros y partisanos, y no confunde la liberación nacional con la revolución socialista, no queda ningún argumento de por qué Hamas no debería ser un movimiento de liberación.
Mito 9: “Hamás divide la resistencia”.
En los Mitos 1 y 14 se explica cómo los sionistas utilizaron a la Hermandad Musulmana para debilitar el movimiento de liberación palestino. En este último, también se menciona que Fatah también apoyó a veces a los HM contra las fuerzas de izquierda. Y el Mito 1 también trata de la relación competitiva entre los HM o Hamas, por un lado, y la Yihad Islámica, por el otro. En ambos mitos, también se afirma que Hamás también rompió con su pasado con respecto a este sectarismo hacia las fuerzas de resistencia nacionales, aunque no de inmediato.
Hamás y la OLP
Durante la Primera Intifada, inicialmente compitió con el Liderazgo Nacional Unido de la Intifada (VNFI) de Fatah, el FPLP, el FDLP, el Partido Comunista y la Yihad Islámica.145 No fue sino hasta finales de 1992 que se emitió por primera vez una declaración conjunta con la VNFI y la OLP, en respuesta a la deportación de 415 (supuestos) miembros de Hamas por parte de Israel.146
Sin embargo, la relación de Hamás con la OLP siguió siendo ambivalente: en sus estatutos, se refería a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como “padre, hermano, pariente o amigo” y “más cercano a ella”.147 Sin embargo, el propósito de la OLP como frente popular no era precisamente “estar cerca” de una organización de liberación palestina, sino unir a todos bajo su techo. En 1990, Hamás había “pedido” ser admitido en la OLP o en el Consejo Nacional Palestino por primera vez, y modestamente exigió entre el 40 y el 50 por ciento de los mandatos, lo que la OLP naturalmente rechazó.148 En el período que siguió, se habló repetidamente de una admisión, pero al final nunca llegó a buen término. En 2005, parecía que finalmente podría tener éxito en el curso de una reestructuración de la OLP. Sin embargo, la victoria electoral de Hamás en 2006 marcó el principio del fin de estos esfuerzos: su aplastante victoria reforzó la confianza de Hamás en sí mismo y “desafió el estatus de la OLP como único representante legítimo del pueblo palestino de una manera sin precedentes. En su programa de gobierno, Hamás se negó una vez más a reconocer el único reclamo de legitimidad de la OLP, lo que enfureció a Fatah y a muchos palestinos, que respondieron que la OLP está por encima de todas las rivalidades entre facciones”, según Khaled Hroub.149 La política de la dirección de Fatah en los meses siguientes, que apuntó al sabotaje, la subversión y la traición, que resultó en la lucha abierta por el poder entre Hamas y Fatah y la división entre Gaza y Ramallah (mito 10), finalmente enterró una posible adhesión de Hamas a la OLP por el momento.
Hamás y la resistencia
Pero más allá de la OLP, Hamás demostró que estaba dispuesto a cooperar con otras fuerzas de resistencia: en la década de 1990, se organizó junto con el FPLP, el DFLP, el FPLP-GC, la Yihad y otros en el frente de rechazo contra la traición de Oslo.150 Después de su victoria electoral en 2006, Hamas buscó un gobierno de unidad nacional a pesar de que solo él tenía mayoría absoluta en el parlamento.151 Aunque Hamás ha gobernado la Franja de Gaza en solitario desde 2007, coopera con las otras fuerzas de resistencia: en los últimos años, por ejemplo, ha tratado de mantener a la Franja de Gaza al margen de nuevos combates con Israel en un acto de cuerda floja hasta el 7 de octubre, mientras que al mismo tiempo da a organizaciones como la yihad las manos libres posible; además, es muy probable que el dinero fluyera desde Gaza hacia la resistencia en Cisjordania.152 También ha estado enviando fondos desde el extranjero a otras organizaciones de liberación en Gaza durante algún tiempo.153 Por último, en 2018, junto con las demás organizaciones, lanzó elEspacio de Operaciones Conjuntas de los Grupos de Resistencia Palestinos, que ha ampliado su cooperación en los últimos años, y ha estado luchando codo con codo con la Yihad Islámica, el FPLP, el FDLP y otros grupos armados en la “Inundación de Al-Aqsa” desde el 7 de octubre de 2023.
Hamás y Fatah
Al mismo tiempo, Hamás se ha declarado en repetidas ocasiones dispuesto a sentarse de nuevo a la mesa con Fatah: declaró deliberadamente que la lucha por el poder en la Franja de Gaza en 2007 (mito 10) no era una lucha contra Fatah, sino contra la milicia del líder local de Fatah, Muhammad Dahlan.154 En 2013, Hamás dio un paso simbólico hacia Fatah al permitirle celebrar públicamente el día de su fundación en Gaza por primera vez.155 Al año siguiente, incluso se negoció un gobierno de unidad entre Hamás y Fatah. En el acuerdo adjunto, Hamás acordó entregar el poder político en la Franja de Gaza a Fatah, con la condición de que no fuera desarmado y, por lo tanto, no fuera aplastado como organización de resistencia. Con ello se pretendía reunificar políticamente la Franja de Gaza y Cisjordania. El acuerdo finalmente fracasó debido a la renuencia de los líderes de Fatah en torno a Mahmoud Abbas a aceptar a Hamas como una fuerza de resistencia legítima a cambio de una transferencia de poder en Gaza.156 En 2017, además del nuevo documento político de Hamás (mito 12), se alcanzó un acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamás, al que Hamás dice que se adhirió hasta las elecciones previstas para 2021.157 Sin embargo, estas elecciones fueron canceladas de nuevo por Abbas, que (con razón) esperaba ser destituido por las urnas.158 Fue elegido presidente en 2003 y su mandato expiró en 2009; desde entonces, ha dirigido la AP sin legitimidad y de manera extremadamente autoritaria.
Tel Aviv y Washington siempre han estado implicados en todo esto, presionando a este último cada vez que ha habido un acercamiento entre Hamás y Fatah. Helga Baumgarten resume esta estrategia de la siguiente manera: “Israel y Estados Unidos están impidiendo sistemáticamente cualquier acercamiento entre Ramala y Gaza para mantener la división palestina y el conflicto entre Fatah y Hamas. Con esta política de “divide y vencerás”, se espera que el control sobre los palestinos se logre con la sumisión más o menos completa de Ramallah […] Gaza, por otro lado, es bombardeada regularmente cada pocos años”.159
Mito 10: “Hamas tomó el poder en un golpe de Estado”.
Hamas ganó las elecciones de 2006 al Consejo Legislativo Palestino, el parlamento en los territorios ocupados en 1967: 74 de los 132 escaños, es decir, la mayoría absoluta, fueron para él; Fatah solo obtuvo 45 escaños.160 Ni ellos ni Fatah, que ha gobernado hasta ahora, ni Israel ni Occidente esperaban esta victoria. El líder de Hamás, Ismail Haniya, “declaró inmediatamente su intención de formar un gobierno de unidad nacional”. Sin embargo, debido principalmente a la presión de los EE.UU. y de Mahmoud Abbas, al final ni siquiera se formó un gobierno de coalición. “Contrariamente a sus intenciones declaradas, Hamas tuvo que formar un gobierno puro de Hamas con unos pocos tecnócratas independientes”.161
Muriel Asseburg declara: “En general, en el primer año de su mandato, Hamás no logró establecer un gobierno efectivo, ni obtener el control de la situación de seguridad, y mucho menos implementar su ambicioso programa de reformas. Esto también puede deberse al hecho de que el movimiento no estaba suficientemente preparado para gobernar. Sin embargo, ante todo, tuvo que luchar con bloqueos […] Por un lado, esto incluía la actitud de bloqueo de Fatah, que de ninguna manera estaba dispuesto a aceptar su derrota electoral y renunciar al poder o cooperar con el gobierno. Sin embargo, esto significó que el gobierno, que se formó en marzo de 2006, no tuvo acceso a las instituciones del poder ejecutivo que habría necesitado para gobernar realmente, porque la oficina del presidente, todo el aparato de seguridad de la Autoridad Palestina y los ministerios estaban y siguen estando ocupados predominantemente por gente de Fatah, la mayoría de los cuales se negaron a cooperar con Hamas siguiendo las instrucciones del presidente Abbas. Por otro lado, el gobierno liderado por Hamas fracasó debido a la política de aislamiento (o cada vez más embargo) de Israel y Occidente, que privó al gobierno de su base financiera […] En la lucha por el poder dentro de los palestinos, Occidente se puso del lado del presidente y presidente de Fatah, Abbas, a quien no solo apoyó diplomáticamente, sino también […] fondos. Al mismo tiempo, Occidente también toleró que el presidente Abbas diera marcha atrás a las medidas de reforma anteriores tras la victoria electoral de Hamás para consolidar su poder”.162
En respuesta, Hamás trató de construir sus propias fuerzas de seguridad leales. “Fatah, con el apoyo de los países vecinos y la ayuda financiera estadounidense, también aumentó su arsenal de armas y comenzó a fortalecer sus fuerzas de seguridad a través de medidas de entrenamiento adicionales. El resultado fueron enfrentamientos cada vez más violentos entre los grupos armados, las fuerzas de seguridad y las milicias de ambos bandos. En el año siguiente a la toma del poder, murieron alrededor de 200 palestinos”.163
Una vez más, Abbas resultó ser un hombre de Occidente. Helga Baumgarten describe: “Para el observador no involucrado, tuvo lugar una lucha de poder, como había tenido lugar en 2003 entre el Presidente Arafat y su Primer Ministro Mahmoud Abbas, solo que con los signos opuestos. Mientras que Abbas, con el apoyo masivo de Occidente, había tratado de arrebatar al entonces presidente Arafat el mayor control posible sobre los órganos de seguridad de la Autoridad Palestina, Abbas ahora intentaba ejercer la mayor influencia posible sobre los órganos de seguridad del gobierno de Haniyeh y especialmente del ministro del Interior, una vez más con el pleno apoyo de Occidente.164
En marzo de 2007, se formó un gobierno de unidad nacional con la mediación de Arabia Saudita, en el que se sentaron Hamas, Fatah, el FDLP, el Partido del Pueblo Palestino (anteriormente Partido Comunista) y otros partidos más pequeños. Sin embargo, este gobierno pronto colapsó debido al continuo bloqueo de Fatah, que quería mantener el poder sobre los órganos de seguridad, y la política de Occidente, que seguía dependiendo del aislamiento de Hamas.165
“En la primavera de 2007, Estados Unidos comenzó a suministrar directamente a Fatah dinero, entrenamiento y equipo militar”. El apoyo también llegó desde Europa. “Hamas se sintió cada vez más presionado por el establecimiento de nuevas milicias de Fatah. Cuando Israel dio luz verde para suministrar armas pesadas a las unidades de Fatah en la Franja de Gaza y, al mismo tiempo, los líderes de Fatah y otros representantes del gobierno de unidad estaban fuera del país, aprovechó la oportunidad para deshacerse del peligro”.166 Tareq Baconi habla de un “cheque en blanco” que Estados Unidos emitió al líder de la milicia Fatah, Dahlan, en 2007 por sus acciones contra Hamas.167 Y Baumgarten aparentemente asume que Hamas reaccionó en el último segundo: “Este golpe no sucedió, porque Hamas obviamente se adelantó a los escuadrones de seguridad de Fatah bajo Mohammad Dahlan”.168
El 10 de junio de 2007, la Brigada Qassamatacó a las tropas de Dahlan. Los combates duraron hasta el 14 de junio. Al final, las milicias de Fatah en la Franja de Gaza fueron aplastadas y 161 personas murieron. Al parecer, hubo crímenes en ambos bandos, como ejecuciones extrajudiciales. El ataque preventivo dañó la reputación de Hamas entre muchos palestinos. Además, ahora ha perdido finalmente el poder en Cisjordania. Desde entonces, ha gobernado Gaza en solitario, mientras que Abbas ha establecido un régimen autoritario en Ramala.169
En resumen, el golpe de Estado de Hamas fue el intento de un partido elegido por mayoría absoluta, que había hecho todo lo posible para crear un gobierno en interés del pueblo y, junto con todos los demás actores políticos, para mantener su posición frente a un golpe de Estado instigado por el imperialismo occidental y el régimen de ocupación sionista. En vista del hecho de que la Franja de Gaza sigue siendo la capital del movimiento de liberación palestino, mientras que el régimen títere de Abbas está haciendo todo lo posible para ahogar la resistencia en Cisjordania, la evaluación solo puede ser positiva en retrospectiva: ¡Solo porque Hamas golpeó a tiempo en ese momento, la resistencia en Palestina hoy tiene la fuerza que demostró tan impresionantemente el 7 de octubre!
Mito 11: “No se puede negociar con Hamas”.
Esta acusación la hacen sobre todo los opositores a la causa palestina. Sin embargo, hay que discutirlo aquí, ya que también es un mito lamentablemente muy extendido entre las personas solidarias con Palestina. La acusación también se combina a menudo con la supuesta intransigencia de Hamás. Esto también es un mito.
En primer lugar, hay que argumentar aquí que ser intransigente no es algo malo en sí mismo. Siempre depende de lo que se trate específicamente; Depende del tema y de la otra persona. El hecho de que Hamás esté dispuesto a hacer concesiones, que sea pragmático y adaptable en su política hacia los palestinos, y que también se haya desarrollado significativamente en estas y muchas otras cuestiones, puede leerse en varias partes de este texto. (Mitos 1, 2, 9, 10, 12 y 14)
Solución de facto de dos Estados
Además, no sólo ha cambiado en términos de su actitud fundamental hacia el sionismo y el judaísmo (Mitos 3 y 12), sino que también se ha mostrado repetidamente dispuesto a comprometerse y negociar con el Estado israelí: aunque aboga por la liberación de toda Palestina, ha anunciado repetidamente que a cambio de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 está dispuesto (al menos a medio y largo plazo) a: Depongan las armas. La primera propuesta de este tipo data de 1988 y fue hecha por los dos líderes de Hamas, Mahmoud al-Zahhar y Shaykh Ahmad Yassin, ambos en conversaciones directas con políticos sionistas de alto rango y con la prensa israelí. La segunda oferta data de 1991. Ambos intentos fracasaron porque el régimen sionista se negó a responder a la demanda de Hamás de que las FOI se retiraran primero de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este y transfirieran la zona al control de la ONU.170 A principios de 1993, en vísperas del inicio del llamado “Proceso de Paz de Oslo”, la organización declaró que estaba dispuesta a apoyar una vía pacífica con la condición, en primer lugar, de que las FOI se retiraran de los territorios ocupados en 1967 y, en segundo lugar, de que Hamás no reconociera a Israel.171 Helga Baumgarten ve este último paso en particular como una oportunidad para una inclusión pacífica de Hamas en un posible proceso de solución, pero esto fue destruido por la clasificación de la organización como “terrorista” (mito 6) por parte de los EE.UU. en el mismo período.172
Hamás rechazó la traición de Oslo, al igual que la abrumadora mayoría de los partidos palestinos –con la excepción del Partido del Pueblo Palestino (el antiguo Partido Comunista de Palestina), Fidaa (una escisión del FDLP) y, por supuesto, la dirección de Fatah– por los mismos motivos que todos los demás: los palestinos reconocieron a Israel y no obtuvieron nada a cambio. excepto por más y más asentamientos sionistas en su supuesto futuro territorio nacional.173
Por lo tanto, el rechazo a Oslo no debe equipararse en modo alguno con un rechazo a la llamada solución de dos Estados, tal como se presenta tan a menudo en Occidente. Por el contrario, el sistema de Oslo ha hecho imposible una solución de este tipo para siempre debido a la creciente colonización de Cisjordania.174 En los años que siguieron, Hamás declaró repetidamente su voluntad de reconocer un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, por ejemplo en su programa de gobierno de 2006175 y en su programa político para 2017.176 Imad Mustafa incluso escribe: “Todas las declaraciones de los líderes de Hamas y los documentos desde 2006 se refieren a la solución de dos Estados en las fronteras de 1967 con respecto a un Estado palestino”.177
En este contexto, en primer lugar, hay que señalar que tal solución no es sólo una oferta increíblemente generosa de los palestinos indígenas a los colonos coloniales en sus tierras, sino que también es una oferta increíblemente generosa de los palestinos indígenas en sus tierras.178 pero también que tal Estado palestino es significativamente más pequeño que el previsto por la ONU en 1947: en el curso de la Nakba, los sionistas expandieron el territorio que les concedieron las Naciones Unidas del 56 por ciento a alrededor del 80 por ciento de toda Palestina a través de la conquista y la anexión.179
Además, hay que subrayar aquí que el hecho de que Hamás esté dispuesto a participar en una solución de dos Estados no es en absoluto positivo para mí. Ya he dicho en otro lugar que considero que la llamada solución de dos Estados es políticamente incorrecta y también completamente irreal por varias razones.180 Sin embargo, la posición de Hamás está más en línea con el programa interino defendido por el FDLP entre 1973 y 1994 y la OLP entre 1974 y 1993.181 y menos de la solución final de dos Estados, como está representada oficialmente hoy por Fatah, el FDLP y algunos grupos más pequeños.
Cesación del fuego
Además, Hamás ha ofrecido en repetidas ocasiones ceses el fuego o los ha declarado unilateralmente y también se ha adherido a ellos. Por regla general, fueron interrumpidos por ataques directos israelíes contra Hamas o por otras provocaciones masivas del lado sionista. Alexander Flores escribe tanto con vistas a estos verdaderos altos el fuego, como a las promesas de Hamás, un alto el fuego duradero con Israel, interpretado por muchos observadores como un reconocimiento de facto de Israel182 – si a cambio los territorios ocupados en 1967 fueron limpiados de las tropas y colonos sionistas: “La experiencia enseña que se puede confiar en las promesas de Hamás”.183
Intercambios de prisioneros
Por cierto, la toma de rehenes es también una expresión de la voluntad de Hamás de negociar: mientras que los soldados capturados solían ser asesinados al principio, Hamás pronto los utilizó para imponer demandas políticas legítimas, normalmente la liberación de los prisioneros. Los prisioneros israelíes, a diferencia de los rehenes en las prisiones de tortura sionistas, solían ser tratados con total corrección. (Ver Mito 6)
Mito 12: “Los estatutos de Hamás dicen…”
La Carta es el “testigo clave” más popular utilizado contra Hamas, como también se puede ver en el Mito 4. Sin embargo, no se trata tanto del contenido de la carta, ya que generalmente se pone en juego en relación con la acusación de antisemitismo contra Hamas. (Mito 3) Más bien, se trata del significado de la Carta misma.
Completamente sobrevalorado
Porque en Occidente, a la gente le gusta fingir falsamente que los estatutos de Hamas son la clave para entender la organización. Dabei betonen Asseburg,184 Arboreto185 Felsch,186 Hroub,187 Meyer188 Mustafá189 y Tsiolkovsky,190 que la Carta ha desempeñado durante mucho tiempo poco o ningún papel en la práctica de Hamás, o de hecho nunca lo ha hecho. Khaled Hroub, por ejemplo, escribe: “Irónicamente, la Carta nunca ha ocupado un lugar central en el pensamiento político de Hamas; Pasó desapercibido después de su publicación y apenas fue citado. Muchos líderes de Hamas dentro y fuera de Palestina sintieron que era demasiado simplista y que contenía afirmaciones y argumentos que hacían que Hamas pareciera ingenuo y atrasado en lugar de una organización moderna. Varios líderes de Hamas le han dicho al autor en entrevistas que la carta fue escrita por un solo líder de la organización en la Franja de Gaza y luego publicada prematuramente y sin suficiente consulta”.191
Helga Baumgarten lo describe de manera similar en una entrevista publicada recientemente.192 Según ella, los miembros de Hamás nunca estuvieron obligados a conocer la carta, y no se difundió en Palestina después de 1988, mientras que se hizo notoria en Occidente.193 Maximilian Felsch confirma: “En las entrevistas con el autor, los partidarios de Hamás, así como los miembros de Hamás, a menudo confiesan que no saben de la existencia de una carta fundacional”.194
Son numerosas las posiciones oficiales del movimiento que contradicen la Carta,195 así como declaraciones de líderes que relativizan su importancia.196 Azzam Tamimi, afiliado a Hamás, calificó de “ridículas” las declaraciones antijudías y de teorías conspirativas de la carta.197 Según él, en la primera mitad de la década de 2000 surgió un debate en la dirigencia sobre los problemas del documento, al final del cual estaba “el mandato para el borrador de una nueva carta”.198
Sin embargo, esta iniciativa fue finalmente abandonada.199 ¿Por qué? Hay diferentes respuestas a esto. Hroub escribe: “Cambiarlos o reemplazarlos, sin embargo, sería un paso muy difícil y delicado que Hamas aún no ha tenido el coraje de tomar. Sus líderes temen que tal medida sea interpretada por muchos como un abandono de los principios básicos de la organización. En cambio, Hamás se ha limitado hasta ahora a dejar que la carta muriera en silencio, recurriendo a otras cosas e ignorándola con la esperanza de que finalmente desaparezca de la conciencia. Sin embargo, el precio de limitarse a restar importancia a su existencia en lugar de revocar la Carta sigue siendo alto”.200
Gilbert Achcar201 y Tilman Seidensticker202 Formularlo de manera similar. Raif Hussein también cita este aspecto, pero añade otro: Los Hermanos Musulmanes, como “organización madre” de Hamás, “todavía no están preparados en este momento para hacer tal corrección de rumbo de una de sus secciones […] .”203
Una nueva carta (?)
Sin embargo, Hamás se distanció de los Hermanos Musulmanes en su declaración política de 2017. Este documento también difiere fundamentalmente de la carta fundacional en puntos clave. Por ejemplo, afirma inequívocamente: “Hamás afirma que su conflicto es con el proyecto sionista y no con los judíos a causa de su religión. Hamas no está luchando contra los judíos porque son judíos, sino que está luchando contra los sionistas que están ocupando Palestina. Sin embargo, son los sionistas los que constantemente identifican al judaísmo y a los judíos con su propio proyecto colonial y entidad ilegal”.204 Además, Hamás ya no se dirige exclusivamente a los musulmanes, sino también a los palestinos cristianos.
Sin embargo, es controvertido si la Carta ha sido sustituida por este nuevo documento o no. Asseburg,205 Baconi206 y Hussein207 decir no y hablar de un “suplemento”; Azzam Tamimi, que ha trabajado durante mucho tiempo como asesor de Hamas, dijo que el documento reemplaza “prácticamente” a la carta;208 Hroub también cree que el documento es “de facto la nueva carta de Hamás”209 y Ali Abunimah210 y Helga Baumgarten211 incluso se refieren a ella simplemente como la “nueva carta”.
Por su parte, el alto representante de Hamás, Jalid Mashal, no quiso hablar del nuevo documento que declara inválida la antigua carta: “Hamás se niega a someterse a los deseos de otros Estados. Su pensamiento político nunca es el resultado de presiones externas. Nuestro principio es: no hay cambios en el documento. Hamás no olvida su pasado. La Carta ilustra el período de la década de 1980 y el documento de Principios Generales representa nuestra política en 2017. Cada documento pertenece a un período de tiempo específico”.212 En su naturaleza contradictoria con lo predicho, las dos últimas frases dan una pista de la clave intelectual de este dilema: Hamás no ha cometido históricamente ningún error en su auto-representación (pero menos en su autopercepción), ni tampoco los Hermanos Musulmanes: las rupturas reales de su historia son negadas y presentadas como un cambio armonioso. Esta idealización de la propia historia y la consiguiente incapacidad demostrativa para autocriticarse no es atípica ni inexplicable para los actores políticos, especialmente en una posición como la de Hamás; Sin embargo, no deja de ser problemático y lamentable.
Sea como fuere, el documento base de 2017 también fue ampliamente recibido, discutido e interpretado. Ambos documentos son bastante interesantes de leer, aunque solo sea para poder formarse su propia opinión. También se pueden encontrar buenas discusiones y clasificaciones de la Carta en Baumgarten,213 Hroub,214 Meyer215 y Mustafá.216 Interesantes discusiones sobre el documento básico están disponibles en línea en Abunimah, entre otros217 y Langthaler.218
Mito 13: “Hamas es un títere de Irán”.
Esta acusación se hace no solo contra Hamas, sino también contra Hezbollah en el Líbano, Ansarallah (conocidos en Occidente como “hutíes”) en Yemen y varios actores en Irak y Siria. Curiosamente, se plantea con mucha menos frecuencia contra la Yihad Islámica (en Occidente), aunque está mucho más estrechamente vinculada a Irán que a Hamás. Por supuesto, esto puede explicarse, entre otras cosas, por el hecho de que Hamas es mucho más grande, más fuerte y más relevante. Pero también muestra simplemente la ignorancia en Occidente de los palestinos y sus organizaciones.
De hecho, la relación entre Hamás e Irán es bastante compleja y contradictoria, y son cualquier cosa menos aliados “naturales”. Leila Seurat escribe: “Hamás ha buscado a lo largo y ancho para encontrar partidarios materiales que no sean Irán. El apoyo de otros lugares podría eliminar todos los inconvenientes de una alianza con la República Islámica, una alianza que sigue siendo bastante impopular en Palestina”. Sobre todo, Hamás (al igual que la Yihad) es acusado por el lado salafista de hacerse dependiente de los “persas chiítas”. El propio Sheij Yassin había declarado en 1989 que los chiítas no eran (verdaderos) musulmanes.219
Acercamiento (1990-2011)
A principios de la década de 1990, Hamas e Irán se acercaron debido a varias circunstancias favorables. Desde entonces, no ha habido más arrebatos sectarios de este tipo por parte de los representantes de Hamás. También hubo declaraciones positivas sobre el concepto de “revolución islámica” del ayatolá Jomeini de vez en cuando, pero Hamas, a diferencia de Hezbollah en sus primeros días, nunca lo adoptó.220 Hamás sigue siendo un movimiento con pretensiones reformistas islámicas, no revolucionarias.
El acercamiento entre Irán y Hamas se produjo en un momento en que este último reemplazó a Fatah como el mayor receptor de fondos de las monarquías árabes del Golfo. El trasfondo era que, a diferencia de Arafat, Hamás no se puso del lado de Bagdad en la primera guerra de Irak.221 Esta actitud también fue bien recibida en Irán, ya que el país acababa de salir de una sangrienta guerra de ocho años (guerra Irán-Irak) con su vecino. Poco después de la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990, una delegación de la Hermandad Musulmana jordana viajó a Teherán y pidió armas (aparentemente para los hermanos y hermanas de Palestina), pero sin éxito. Pero ya en octubre de 1991, Hamás fue invitado oficialmente a abrir una oficina en Teherán. Este paso fue el primero para Hamás; Las representaciones en otros países musulmanes no siguieron hasta 1993-97. Además, según un informe secreto del Congreso de EE.UU. de 1993, ya existían estrechas relaciones militares, de inteligencia y financieras entre Hamás y Teherán. En consecuencia, Daud Abdullah considera a Irán entre los “aliados más cercanos” de Hamas durante este período.222
Al mismo tiempo, desde finales de 1992, cientos de miembros de Hamas también estaban en el Líbano porque el régimen sionista los había deportado allí. Allí se establecieron estrechos contactos con Hezbolá.223
Sin embargo, las relaciones entre la República Islámica y el Movimiento de Resistencia Islámica volvieron a acelerarse a mediados de la década de 2000.224 Este acercamiento tuvo varios trasfondo: Hamas ganó primero las elecciones en los territorios ocupados en 1967 en 2006 y tomó el poder en la Franja de Gaza en 2007 (mito 10), lo que le dio un mayor peso político. Durante la lucha por el poder con Fatah en el curso de 2007, Irán ayudó a Hamas a establecer y armar unidades de combate.225
Al mismo tiempo, el “eje de la resistencia” entró en una confrontación cada vez mayor con el imperialismo occidental: Israel y los EE.UU. seguían un curso de guerra cada vez más agresivo contra Irán bajo el presidente Ahmadinejad; el régimen sionista invadió el Líbano en 2006 y tuvo que admitir la derrota ante Hezbolá; En diciembre de 2008, los sionistas atacaron Gaza y bombardearon la zona durante casi un mes, con el objetivo declarado de aplastar a Hamas.
Según Seurat, la contribución financiera de Teherán a Hamás después de 2006 fue de un promedio de 120 millones de dólares al año, una suma “absolutamente vital”. Sin embargo, había más en juego: “Además del apoyo financiero, Irán también ha apoyado militarmente a Hamas a través de la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos. Gracias a la estrecha cooperación con Teherán, que también suministra armas y entrena a los combatientes, la industria militar de Hamás parece estar en pleno apogeo. A nivel organizativo, el movimiento se parece cada vez más a Hezbolá”.226
Rupturas y acercamientos (2011 a la actualidad)
Estas estrechas relaciones se vieron gravemente afectadas por la guerra en Siria: los Hermanos Musulmanes en su conjunto se basaron en el establecimiento de un eje suní (no wahabí) desde Túnez y Libia, pasando por Egipto, hasta Gaza, Siria y Turquía, así como Qatar. En consecuencia, Hamás se puso del lado de los insurgentes sirios, que estaban formados principalmente por suníes y a los que pertenecían los Hermanos Musulmanes sirios. Según un artículo de referencia en The Cradle, Qatar, Turquía y los miembros de la oposición siria presionaron deliberadamente al primer ministro de Hamas, Ismail Haniya, y al miembro del Politburó, Mousa Abu Marzouk, quienes se mostraron reacios a romper con el “eje de la resistencia”, mientras que un círculo alrededor del presidente del Politburó, Khaled Mash’al, ya se había inclinado hacia la “línea de los Hermanos Musulmanes“.227 El “eje de resistencia” entre Gaza, Beirut, Damasco, Bagdad y Teherán finalmente se rompió por líneas sectarias; Mash’al trasladó su sede extranjera de Damasco a Doha en 2012. Contrariamente a las amenazas anteriores, Teherán no cortó inicialmente todo el apoyo financiero y militar a Hamás, pero los dirigentes iraníes redujeron los fondos de 150 millones a 75 millones de dólares en 2012 y los recortaron en el verano de 2013, cuando los combatientes de Hamás en Siria participaron en una batalla contra las tropas sirias y los combatientes de Hezbolá. otra vez a medias. Finalmente, en 2016, los líderes de Hamas afirmaron que Irán había suspendido los pagos por completo.228
Abdullah, por otro lado, escribe que Irán nunca ha terminado completamente su apoyo.229 De cualquier manera, las restricciones de Teherán no tuvieron el efecto de simplemente cambiar el curso político de Hamas sobre Siria.
Pero con el derrocamiento de Muhammad Morsi en Egipto en el verano de 2013 y la estricta política anti-Hermandad Musulmana del nuevo régimen militar y del general al-Sisi, Hamas se encontró con problemas que favorecieron su acercamiento a Irán.230 Además, los Hermanos Musulmanes fueron expulsados del poder en Túnez en 2014, Libia quedó completamente desmembrada como consecuencia de la guerra de la OTAN, el fracaso del cambio de régimen en Siria y el aislamiento de Qatar dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, que comenzó en 2014 y culminó en 2017 con la ruptura de relaciones entre Doha, por un lado, y Abu Dhabi, El Cairo, Manama y Riad, por el otro.231 Los líderes de Hamas ahora intentan limitar el daño, pero Khaled Mash’al, quien ha sido responsable del curso desde 2011, ya no era bienvenido en Teherán. No fue hasta 2015 que hubo un acercamiento gradual y nada sencillo entre Hamás, por un lado, e Irán y Hezbolá, por el otro.232
En todo esto, las Brigadas Qassam jugaron un papel especial: debido al apoyo financiero y militar que recibieron de Irán, se opusieron estrictamente desde el principio a cualquier curso que condujera a una ruptura con el “eje de resistencia”. Y, de hecho, la línea política en los años posteriores a 2011 trajo reveses para el pueblo y la resistencia en Gaza, ya que desde Doha -que a pesar de todo mantiene buenas relaciones con Washington- y Ankara -miembro de la OTAN- fluyó mucho menos dinero desde Teherán.233
Sin embargo, el continuo apoyo de Irán al brazo armado de Hamás lo ha fortalecido no solo militarmente, sino también políticamente, ampliando así su poder y el de la dirección de Gaza en su conjunto: Tradicionalmente, la “dirección externa”, es decir, la parte de la dirección que vivía fuera de Palestina, había podido hacerlo gracias a la ocupación sionista y posteriormente reforzada por el aislamiento forzado de Gaza. mantuvo la hegemonía política en la organización y, no menos importante, proporcionó la presidencia del Politburó durante décadas.234 Ahora esto ha cambiado: en 2017, Yahya al-Sinwar, uno de los cofundadores de las brigadas, reemplazó a Haniya como primer ministro de Gaza, quien a su vez fue elegido para suceder a Mash’al como jefe del Politburó. Esta es la primera vez desde 2004, cuando el poder cambió a favor de los líderes extranjeros después del asesinato de los dos líderes de Hamas, Shaykh Yassin y Abdel Aziz Rantisi, por Tel Aviv, que el centro de poder de Hamas se trasladó de nuevo a Gaza. A este respecto, Abdelrahman Nassar habla de un “ala militar” formada por las Brigadas Qassam y otros dirigentes, que actualmente se están afirmando contra un segundo polo en torno a Mash’al, una especie de “polo de los Hermanos Musulmanes“, así como un tercer polo salafista-confesionalista y forzando un acercamiento con el “eje de resistencia”.235 Debido al hecho de que esta “ala militar” se centra en la liberación nacional de Palestina y persigue una política de alianzas aconfesional y antisectaria en la región, también podría describirse como un “polo nacional” o un “polo del eje de la resistencia” según su contenido.
¿Una guerra de poder por parte de Teherán?
Si se observan los acontecimientos desde el 7 de octubre, se puede ver, por un lado, que este “eje de resistencia” ha tomado forma (de nuevo) de cierta manera, y que, como antes de 2011, vuelve a ser predominantemente chiíta (Irán, Irak, Siria, Ansarallah y Hezbollah) por un lado y aconfesional por el otro (doce chiítas en Irán, Irak y Líbano, zaiditas en Yemen, Alauitas en Siria, suníes en Palestina). Las heridas y cicatrices infligidas en Siria están actualmente cubiertas por la “inundación de Al-Aqsa” y la sangre que corre en Gaza.
Por otro lado, no parece en absoluto que el levantamiento del 7 de octubre haya sido estrechamente coordinado entre Gaza y el “Eje”. No sólo hay indicios de que la decisión de lanzar la operación fue “cien por cien palestina”, como dijo el secretario general de Hezbolá, Shaykh Hassan Nasrallah,236 Reuters informó el 15 de noviembre: “El líder supremo de Irán envió un mensaje claro al jefe de Hamas cuando se reunieron en Teherán a principios de noviembre, según tres altos funcionarios: Usted no nos advirtió sobre su ataque a Israel el 7 de octubre, y no entraremos en la guerra en tu nombre”.237
A pesar de que Hamás y un portavoz de alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní negaron inmediatamente el informe,238 este informe podría ser un indicio de desacuerdos tácticos o incluso estratégicos entre Gaza y Teherán.
Hamás: un actor relativamente independiente
En cualquier caso, parece obvio que las relaciones entre Hamás e Irán son complejas y no están exentas de contradicciones. Llamar a Hamas un “títere” de Irán es completamente absurdo solo por esta razón. Seurat rechaza tales insinuaciones con agudas polémicas por no estar basadas en hechos, no ser científicas y ser sospechas y prejuicios francamente colonialistas que sirven al objetivo de desacreditar a Hamas.239
Es obvio que Hamás debe entenderse en primer lugar a partir de la historia y la sociedad de Palestina de la que procede. (Ver Capítulo 3 y Mito 1) Sus políticas están determinadas principalmente por la dinámica de la lucha de liberación palestina y los intereses de los sectores de la población que representa. La ideología (mito 2) y las influencias de la política exterior, por otro lado, están aguas abajo, aunque, por supuesto, no dejan de ser importantes.
Hamás depende en gran medida de los actores extranjeros. Pero esta afirmación es relativa. Al fin y al cabo, esto se aplica en última instancia a todos los actores políticos pertinentes y, especialmente, a todos los Estados que se mueven en el escenario político y económico internacional. Los actores no estatales, especialmente los movimientos de liberación nacional, son fundamentalmente más dependientes, porque mientras no ganen, por lo general no tienen su propio Estado y, por lo tanto, sus recursos son limitados. La relativa independencia de estos actores radica sobre todo en el hecho de que parecen seguros de sí mismos, no se dejan enganchar al carro de otro actor y persiguen sus propios intereses a través de la diplomacia en lugar de venderlos a favor de los intereses de otros. Sin querer aprobarlas, la política de Hamás en Siria a partir de 2011 ha demostrado al menos que pone sus (supuestos) intereses por encima de las relaciones con Teherán o Damasco cuando lo considera necesario, al igual que relativizó su relación con los Hermanos Musulmanes en su nuevo documento base de 2017. (Mito 12)
¡Por más armas y más dinero de Teherán!
Hasta aquí los hechos. En conclusión, ha llegado el momento de recoger los garrotes del apoyo iraní a Hamás: Irán, en su función de proveedor de dinero y armas, así como de protector político y militar de la resistencia islámica y, por tanto, de fuerza dirigente del movimiento de liberación palestino, ha heredado en cierto modo la Unión Soviética. Este último había apoyado a Fatah en particular, pero también al FPLP y al FDLP.240
Y esto a pesar de que todas estas fuerzas no eran partidos hermanos del PCUS y aunque ciertamente había críticas de Moscú a las respectivas políticas de estas organizaciones. Irán está procediendo de manera similar: no sólo la Yihad Islámica, que es ideológicamente cercana a Irán, sino también Hamas y, por cierto, el FDLP241 y el FPLP242 recibir ayuda financiera y militar de Teherán. Por lo tanto, no se trata simplemente de una cuestión de similitudes ideológicas, sino de cooperación estratégica y táctica.
Los izquierdistas ahora argumentan mayoritariamente que Irán no es un país socialista, sino un régimen burgués, que no actúa por “amabilidad” sino por cálculos políticos de poder, etc. Sí, y de hecho no. La República Islámica es un país capitalista bajo el dominio de un régimen burgués que reprime descaradamente a las fuerzas sociales revolucionarias. Pero también surgió de una revolución popular antiimperialista contra el régimen del Sha, que dependía de Occidente, y la toma del poder por parte de Jomeini no fue la contrarrevolución (completa) como la pintan muchos izquierdistas. Aunque muchos de los logros de esta revolución se han perdido y se siguen perdiendo, uno que ha sobrevivido hasta ahora es el pronunciado antiimperialismo en forma de “antiamericanismo” y antisionismo. Para los liberales occidentales y, por desgracia, para muchos izquierdistas occidentales, esta “cultura política” no es más que folclore y, sobre todo, “reaccionaria” hasta la médula. En realidad, sin embargo, es una expresión de una conciencia política que se origina en la época de la revolución y que todavía está viva en partes de las masas iraníes. Por otra parte, este antiimperialismo no se limita a nivel nacional, sino que tiende a ser internacionalista. Así que en realidad es incluso más que “amabilidad”. Es la “ternura de los pueblos”, como lo expresó tan bellamente el Che Guevara. Y esta ternura es una promesa hecha a las masas durante la revolución. No todo el mundo sigue exigiendo esta promesa hoy en día; Y muchas otras promesas ya se han incumplido. Pero, de hecho, es esta conciencia política en partes todavía significativas de la población lo que literalmente está obligando al régimen iraní a apoyar a los palestinos contra Estados Unidos e Israel y más allá.
Además, están los propios intereses regionales y geopolíticos de Irán, que persigue a través de su política de alianzas en Palestina, Líbano, Siria, Irak y Yemen. Pero incluso esta política es antioccidental y, por lo tanto, siempre antiimperialista, al menos en ciertas partes, porque la revolución del pueblo iraní fue antioccidental y antiimperialista. En cualquier caso, la burguesía iraní como tal se haría la vida mucho más fácil si abandonara el antiimperialismo y a los palestinos y buscara un apretón de manos con Occidente. Y ciertamente hay suficientes círculos dentro de la clase dominante iraní que están más que dispuestos a hacerlo. Además, también hay bastantes iraníes que rechazan por completo el apoyo a los palestinos, a menudo argumentando de manera chovinista y anti-Arably, señalando los altos costos financieros y políticos.
¿Qué nos dice todo esto? La ayuda iraní no es una cuestión de rutina. Y al mismo tiempo, el movimiento de liberación palestino es muy dependiente de ellos. La solución no puede ser “exigir” que los palestinos dejen de depender de fuerzas como Irán. No se trata de una exigencia, sino de un deseo. ¿Y cómo podría hacerse realidad sin un estado propio con industria pesada? Todo lo que queda es la “crítica” de que es de alguna manera problemático que la resistencia palestina sea tan dependiente. Esto, a su vez, no es una crítica constructiva, sino una afirmación que es tan correcta como una frase. Entonces, ¿cuál es la “solución”? No existe “la” solución a corto plazo. Tenemos que tomar el mundo tal como es. Y en este momento, el mundo parece que Irán no solo es el socio más confiable de los palestinos, sino mucho más el único que puede y al mismo tiempo está dispuesto a apoyarlos en un sentido tan amplio. Su ayuda es generosa, sobre todo porque el pueblo iraní exige este acto de solidaridad internacional y está dispuesto a hacer sacrificios por él. La solución a largo plazo, por supuesto, radica en la liberación nacional de Palestina. Y en este momento, cada rial, cartucho y cohete que va de Teherán a Palestina es una contribución práctica a esto.
De nuestra limitada opción de acción en Alemania, sólo podemos esperar en este sentido: a saber, que no haya una contrarrevolución proimperialista en Irán, que el pueblo no pierda su ternura por los palestinos y que Teherán sea capaz y esté dispuesto a enviar más y más armas y más dinero a la resistencia, a apoyarla políticamente y a educarla militarmente. La tarea que tenemos para nosotros en Alemania es clara: debemos apoyar la lucha de aquellos sectores del pueblo iraní que no han abandonado el camino antiimperialista, así como debemos apoyar la lucha de liberación de los palestinos. Porque ambas luchas están conectadas. Y eso incluye defender políticamente el apoyo de Irán a los palestinos contra los ataques.
Mito 14: “Hamas está luchando contra la izquierda palestina”.
La época de los Hermanos Musulmanes
De hecho, los Hermanos Musulmanes (HM) en Gaza, como en otros países árabes, no sólo competían con la izquierda política, sino que también se oponían abiertamente a ella en determinadas etapas, a veces incluso combatiéndola militantemente. Sin embargo, también ha habido contraejemplos una y otra vez, por ejemplo, cuando los HM cooperaron con los comunistas en Palestina después de la Segunda Guerra Mundial.243
Aunque la Franja de Gaza era un bastión tradicional de los HM, el FPLP y el Partido Comunista también eran relativamente fuertes allí en las décadas de 1970 y 1980, lo que los puso en competencia con los HM. En diciembre de 1979, por ejemplo, se presentó una Hermandad Musulmana –por cierto, con el apoyo de Fatah, que también veía a la izquierda como un competidor que había que debilitar– contra el presidente de la Media Luna Roja, que era cercano a los comunistas. Cuando el candidato fue derrotado por los HM, sus partidarios se amotinaron en las oficinas de la media luna, así como en tiendas y cafés que vendían alcohol, cines, etc. La IOF intervino enfáticamente tarde. En los años siguientes se produjeron incidentes similares, no sólo en la Franja de Gaza sino también en Cisjordania, donde las fuerzas nacionalistas se convirtieron cada vez más en objetivos u opositores, además de las fuerzas decididamente de izquierda.244
Sin embargo, esta violencia sectaria contra los palestinos coincidió con la abstención de los HM de cualquier resistencia a los sionistas. Está bastante claro que estaba actuando objetivamente en interés de Israel. El hecho de que el poder colonial apoyara, al menos pasivamente, este comportamiento ya ha sido descrito en el Mito 1; al igual que el hecho de que Hamas representaba una ruptura con esta política antipopular, por no decir traidora.
Hamás y la izquierda
Un acercamiento con el FPLP se produjo incluso más rápido que con Fatah debido a la postura común de “intransigente”: ya a principios de 1990, el secretario general del FPLP, George Habash, declaró que cualquiera que comparara las posiciones de los antiguos Hermanos Musulmanes y los primeros Hamas con las “posteriores a la Intifada notará una gran diferencia y debe dar una calurosa bienvenida a su entrada en el movimiento nacionalista”. “No hay duda de que la participación de Hamás” y de la Yihad Islámica “en la batalla representa una victoria para la lucha nacionalista y un auge para el levantamiento popular”.245
En 1991-92, Hamás, la Yihad, el FPLP, el FDLP, el Partido Comunista Revolucionario y otras seis organizaciones formaron una alianza de rechazo contra la inminente traición de Oslo.246 Durante las elecciones locales de 2005, Hamás también apoyó a un candidato cristiano a la alcaldía cercano al FPLP.247 Y después de ganar las elecciones de 2006, Hamás pidió a todos los partidos, incluidos el FPLP, el FDLP y el Partido del Pueblo Palestino (PPP), el antiguo Partido Comunista, que trabajaran con él en un gobierno de unidad nacional.248 Sin embargo, los tres se negaron inicialmente, hasta que el FDLP y el PPP finalmente se unieron a dicho gobierno mediado por Arabia Saudita en la primavera de 2007.249 El FPLP, por su parte, continuó boicoteándolo: el primer gobierno de Hamás lo había “apoyado”, pero no se había unido a él debido a las diferencias sobre la postura de Hamás sobre la OLP y la cuestión de los refugiados. Acogió con beneplácito el acuerdo de La Meca entre Fatah y Hamas debido a la solución provisional de la lucha por el poder, pero al mismo tiempo lo vio como una rendición de Hamas al curso de Oslo.250
Hubo tensiones con las organizaciones de izquierda, sobre todo por la cuestión de la actitud de Hamás hacia la OLP. (Ver Mito 9) Sin embargo, debido al hecho de que la OLP fue y sigue siendo dominada por el liderazgo de Fatah, y que éste a su vez ha mutado en un régimen títere traicionero desde Oslo y aún más desde 2007, la pregunta de quién tiene la razón aquí no puede responderse de manera inequívoca: Hamas juzgó mal a la OLP desde el principio, y por las razones equivocadas. El hecho de que la OLP haya perdido mucha legitimidad con el tiempo no hizo más que reforzarla en esta actitud. “Las facciones de izquierda”, por otro lado, “nunca cuestionaron su pertenencia a la OLP”, como señala Raif Hussein. “Tenían que tener cuidado de no convertirse en cómplices de la abolición del mayor logro del pueblo palestino”.251
“Por su parte, sin embargo, [Hamas] desesperó de la izquierda, que permaneció neutral o tácitamente se puso del lado de la organización de Arafat en cada enfrentamiento entre Hamas y Fatah“, dijo Khaled Hroub.252 “Después de las elecciones de enero de 2006, la relación de Hamás con la izquierda palestina se ha deteriorado aún más. Ninguno de los tres grupos de izquierda […] estaba dispuesto a unirse al gobierno de Hamas. Esto culpó a la izquierda por el fracaso de los esfuerzos de Hamas para formar un gobierno de coalición nacional”.253 y, por lo tanto, en última instancia, también en la lucha por el poder con Fatah, que condujo a la división entre Gaza y Ramala. (Mito 10) La izquierda debe ponerse este zapato. E incluso durante la lucha por el poder entre Hamás y Fatah, el FPLP se posicionó claramente contra Hamás y condenó el “golpe de Estado”.254
Desde entonces, sin embargo, la proporción ha mejorado significativamente. Ya en 2011, Hroub habló de “relaciones relativamente estrechas” con el FPLP y el FDLP.255 Especialmente en los últimos años, las organizaciones de liberación islámicas y de izquierdas se han acercado cada vez más sobre la base de la resistencia conjunta contra los regímenes sionista y de Oslo: estudiantes de izquierdas e islámicos llevan a cabo acciones conjuntas en universidades de Cisjordania,256 en brigadas interorganizacionales y contracorrientes en Cisjordania, comunistas e islamistas luchan codo con codo257 y lo mismo se aplica en Gaza en el marco del Espacio de Operaciones Conjuntas de las Facciones de la Resistencia y la “Inundación de Al-Aqsa”. Pero organizaciones como la red de solidaridad con los prisioneros Samidoun o proyectos de información como Resistance News Networks también son una expresión de estos esfuerzos de unidad contracorriente.
La relación entre las fuerzas de izquierda y Hamás está marcada por la omnipresente cuestión estratégica de la liberación nacional de Palestina. Ni Hamás ni la izquierda han respondido a esta pregunta de manera impecable en el pasado. Por lo tanto, sería absurdo acusar a Hamás de haber actuado de manera diferente al FPLP o al FDLP en esta o aquella cuestión, o incluso de combatirlos en esta o aquella cuestión. Las críticas de Hamás a la no participación de los dos partidos en la formación del gobierno en 2006, por ejemplo, estaban justificadas, y el comportamiento de los dos en la lucha por el poder entre Hamás y Fatah también debe ser criticado en retrospectiva.
Resultado
Por lo tanto, la acusación de que Hamás está “luchando” contra la izquierda política se reduce a) a la época de los Hermanos Musulmanes o b) a un futuro posible, siempre según el lema: “¡No se puede confiar en los islamistas!”
(El dicho de que “los islamistas” traicionan a los comunistas tan pronto como pueden hacerlo es citado por muchos en la izquierda como una “lección” de la revolución iraní. Todo lo que puedo decir es que no es así como funcionan las enseñanzas históricas. La lección de la Revolución de Noviembre fue no cooperar con los socialdemócratas; La lección del fascismo fue hacerlo, después de todo. ¿Qué es lo correcto ahora? Ambas cosas en cierto modo. Estas enseñanzas no deben generalizarse inadmisiblemente. En primer lugar, está la experiencia histórica, y dudo que todos los que hablan de la “lección histórica de la revolución iraní” estén tan bien informados sobre este tema que realmente puedan sacar lecciones de él. El hecho de que los camaradas que realmente saben cómo moverse a su vez saquen las lecciones correctas depende, en el segundo paso, de si abordan el mundo dogmática y esquemáticamente o científica y dialécticamente. Volvamos al tema real.)
O c) a la afirmación banal de que Hamas es una fuerza burguesa con la que los actores de izquierda o comunistas asumen fundamentalmente una relación de oposición de clase y con la que tienen que luchar por la hegemonía social. Sin embargo, esto no distingue a Hamas de otras organizaciones burguesas de liberación, como Fatah en las décadas de 1960 a 1980, el ANC antes del fin del apartheid, etc. Así que surge inevitablemente la sospecha de que se trata una vez más de una islamofobia latente cuando se invoca este “argumento”. Porque en el caso de las organizaciones burguesas seculares en el contexto de la liberación nacional, esta objeción se escucha con mucha menos frecuencia. (Ver también Mito 7) El FPLP y el FDLP, al menos eso parece, se han librado afortunadamente de esta enfermedad izquierdista de la islamofobia y el chovinismo antiislámico, respectivamente. De lo contrario, sería casi imposible que alguna vez obtuvieran una influencia masiva, y mucho menos una hegemonía política, en una sociedad como la palestina.
Mito 15: “El 7 de octubre fue un ataque terrorista de Hamas”.
Esta acusación también se plantea en otras variantes: por ejemplo, el 7 de octubre fue una “masacre”, un “pogromo”, etc. Estas formulaciones pretenden acusar implícita o explícitamente a la resistencia palestina de terrorismo o crímenes de guerra (mito 6) y antisemitismo (mito 3).
Valoración general
La “inundación de Al-Aqsa” fue o es ante todo una operación militar dirigida por Hamás: comenzó como una ofensiva que estalló en la cárcel al aire libre de Gaza y puso zonas de Palestina, ocupada en 1948, bajo el control de la resistencia palestina durante muchas horas. Se atacaron, destruyeron o capturaron objetivos militares, y cientos de combatientes israelíes resultaron muertos y detenidos. Todo esto está indudablemente amparado por el derecho internacional, moralmente legítimo y políticamente sensato.
2. Al mismo tiempo, fue un levantamiento popular armado, al que se unieron otros grupos de resistencia en la Franja de Gaza y Cisjordania. Pero los palestinos no combatientes también participaron en ella, tanto en forma de ataques contra soldados y colonos como en forma de manifestaciones.
3. Además, el “diluvio” tiene repercusiones mucho más allá de las fronteras de Palestina. Como resultado, tiene el potencial de convertirse en una conflagración que amenace tanto la presencia de Estados Unidos en la región como el régimen colonial sionista como tal.
En la actualidad, sin embargo, la “inundación de Al-Aqsa” es sobre todo una batalla defensiva para defender a Gaza contra el genocidio que el régimen sionista lleva a cabo allí desde octubre.
Crimen de guerra
Para la cuestión general de los civiles, véase el Mito 6.
Aparte de eso, sólo hay que subrayar aquí que los informes de atrocidades como la violación (masiva), decapitada o quemada en el horno, etc., algunos de los cuales todavía son difundidos por la prensa mentirosa alemana hoy en día, han sido desterrados hace mucho tiempo al reino de los mitos, sobre todo por los medios de comunicación israelíes.258 Desde hace mucho tiempo se sabe que muchos de los no combatientes muertos en el lado israelí son responsabilidad del ejército sionista y de su tristemente célebre “Doctrina Aníbal”, según la cual un israelí muerto es mejor que uno en cautiverio palestino. Algunos artículos también señalan que, además de los combatientes de la Qassam y otras brigadas palestinas, numerosos palestinos “normales” también salieron de la Franja de Gaza, y que es muy posible que entre estas personas hubiera algunos cuyo odio hacia los colonos, que había sido reprimido a lo largo de los años, se convirtiera en una violencia desenfrenada.
Recomendamos los artículos de Electronical Intifada,259 Mondoweiss,260 Noticias Ocupadas261 y La cuna,262 que disipan numerosos mitos sobre el 7 de octubre. El propio Hamás también se ha pronunciado sobre las acusaciones de crímenes de guerra: las ha negado repetidamente, pero en su declaración del 21 de enero de 2024 también admitió que pueden haber ocurrido acciones indebidas en relación con el levantamiento y el caos que siguió: “Es posible que se hayan cometido algunos errores en la conducción de la Operación Inundación de Al-Aqsa, que se debieron al rápido colapso del sistema militar y de seguridad israelí y al caos de la en las zonas fronterizas con la Franja de Gaza”.263
Las guerras de liberación también son guerras. Ellos también son feos y violentos. La liberación del fascismo fue acompañada por el bombardeo de las principales ciudades alemanas y la violación de miles de mujeres y niñas alemanas. Sin embargo, nadie, excepto los fascistas impecables y los revisionistas históricos, negaría que los Aliados liberaron a Alemania, Europa y el mundo del fascismo alemán en primer lugar.
Otros actores
La narrativa difundida en Occidente de que la “inundación de Al-Aqsa” fue un “ataque de Hamas” atestigua la estrechez del discurso local y, en última instancia, es una frase propagandística antipalestina.
En realidad, además de Hamás, todas las demás organizaciones de resistencia en la Franja de Gaza participaron o siguen participando hoy en día. Un portavoz del izquierdista Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), por ejemplo, dijo con respecto a las Brigadas Nacionales de Resistencia, el brazo armado del FDLP: “Las brigadas participaron en la operación de Hamas “Inundación de Al-Aqsa” una hora después del inicio y dispararon varias salvas de cohetes. El primer día, siete camaradas fueron martirizados”.264 A principios de noviembre, el FDLP y el FPLP ya habían “perdido unas dos docenas de miembros cada uno”, según Dieter Reinisch.265
Al parecer, el inicio de la operación no fue coordinado con los otros grupos de resistencia en la Franja de Gaza, ni con los de Cisjordania, ni con los aliados en Líbano e Irán (véase el mito 13). Sin embargo, ha habido resonancia en todas partes: en Cisjordania, ha habido innumerables otras batallas desde entonces, pero están claramente eclipsadas por la escala de lo que está sucediendo en Gaza.
Desde el extranjero, la “inundación de Al-Aqsa” está flanqueada por operaciones del Hezbolá libanés, el Yemení Ansarallah y otros grupos armados en Irak y Siria. En Egipto también se llevaron a cabo acciones armadas de solidaridad.266 Y en octubre, cientos de voluntarios de Irak viajaron a la frontera jordano-palestina para exigir que se les permitiera pasar para ayudar a sus hermanos y hermanas a luchar. Además, se produjeron manifestaciones de solidaridad en numerosos países árabes y musulmanes, las mayores de ellas en Yemen e Indonesia. Pero también hubo manifestaciones en Egipto, Marruecos y Jordania, donde están en el poder regímenes extremadamente represivos y abiertamente prosionistas, algunos de los cuales los participantes tuvieron que pagar con encarcelamiento en las cárceles de tortura de las dictaduras.
5. Conclusión: ¡Por qué tenemos que luchar contra la prohibición de Hamas!
Cualquiera que haya leído el texto anterior debería tener claro, a más tardar cuando haya llegado aquí, que la prohibición de Hamas no es una “victoria antifascista”, como probablemente evaluará el MLPD; y que esta prohibición de las organizaciones comunistas, de izquierda y democráticas no puede ser simplemente indiferente, porque no afecta a ninguna organización “progresista”. Por el contrario, esta prohibición es un ataque flagrante contra el movimiento de liberación palestino en su conjunto, porque ilegaliza completamente a la fuerza más importante y política y militarmente más fuerte de la resistencia en este país.
Sabemos hasta qué punto se pueden interpretar estas prohibiciones, especialmente a partir de la represión contra el movimiento kurdo. No se trata solo de que los (supuestos) miembros de Hamas, que no está activo en este país, sean restringidos o procesados. Más bien, puede afectar a cualquiera que se pronuncie a favor del legítimo derecho de los palestinos a resistir. Incluso la falta de distanciamiento, el cuestionamiento público de la propaganda, la llamada “publicidad simpática”, la crítica a las prohibiciones o la solidaridad con los afectados por la represión, etc., todo esto puede ser y será puesto en posición por las autoridades contra nosotros como movimiento de solidaridad con Palestina. El hecho de que el samidoun también haya sido prohibido al mismo tiempo que Hamás es una prueba viviente. Porque los camaradas fueron tratados oficialmente como apéndices del FPLP, pero en el espectáculo propagandístico en torno a esta prohibición -y sobre todo eso cuenta, porque nunca se trató de verdad o argumentos, sino sólo de mucho ruido y muchas mentiras- se acercaron permanentemente a Hamas – la única organización palestina que la corriente principal alemana todavía conoce hoy en sus completas limitaciones.
Por cierto, esto también debe ser reconocido por aquellos sectores de los movimientos comunistas, de izquierda, de solidaridad con Palestina y por la paz, que no comparten todos o quizás ninguno de los argumentos presentados en este texto sobre los 15 mitos tratados aquí. Incluso cualquiera que se oponga rotundamente a Hamás, que no apoye la resistencia armada de los palestinos y que no abogue por una solución de un solo Estado, debe reconocer dos cosas: 1. La criminalización total de la resistencia palestina sólo puede tener la intención de socavar cualquier solución justa en Palestina, independientemente de lo que pueda parecer en última instancia. 2. Esta criminalización no solo afectará al propio Hamás, sino que, al final, puede que le afecte menos, porque -gracias a Dios, se quiere decir- no depende de Alemania y, como he dicho, no está activo aquí en absoluto. Más bien, golpea al movimiento de solidaridad con Palestina y es un ataque a los derechos democráticos básicos de todos nosotros. Porque con las actuales prohibiciones, restricciones, denuncias masivas, etc., todas ellas inseparables de la criminalización de Hamás, se están creando hechos y precedentes. Estamos en una lucha defensiva por nuestros derechos fundamentales. ¡El ataque es la mejor defensa! ¡Avancemos resueltamente y luchemos por la despenalización de toda la resistencia palestina y, por lo tanto, por la despenalización de la solidaridad internacional y las posiciones antiimperialistas!
En este sentido:
¡Defienda y luche por los derechos democráticos básicos!
¡Fuera las prohibiciones de Hamas y Samidoun!
¡Fuera los párrafos 129 a y b! ¡Fuera la lista de terroristas de la UE!
¡Viva la resistencia palestina!
¡Viva la ternura de los pueblos!
¡Viva la solidaridad internacional!
Fuentes
[1] La única excepción que conozco es el Palestine Solidarity Duisburg (2023).
[2] MLPD (2023 a).
[3] Bandera Roja (2022).
[4] Organización Comunista (2023).
[5] Organización Comunista (2020).
[6] Bamen (2023 a). Bamen (2023 b).
[7] Baumgarten (2006), p. 65.
[8] Felsch (2011), Pág. 102.
[9] Leukefeld (2023).
[10] Marx21 (2023).
[11] Baconi (2023).
[12] Baumgarten (2006), págs. 207-226.
[13] Hamás (2017).
[14] Hamás (2024).
[15] Baumgarten (2006), págs. 227-241.
[16] Mustafa (2013), pp. 221-224, 229 y ss.
[17] Los folletos de Johansen (1982) y Harman (2012), por ejemplo, son apasionantes, aunque Hamás no aparezca en ninguno de los dos.
[18] Baumgarten (2006), pág. 10.
[19] Johansen (1982), p. 27. Seidensticker (2015), p. 72.
[20] Baumgarten (2006), p. 11 y ss.
[21] Gershoni / Nordbruch (2011), p. 219 y ss.
[22] Baumgarten (2006), págs. 12-14, 18-20.
[23] Ibíd., p. 17.
[24] Ibíd., págs. 21 a 28, cit.: p. 27.
[25] Es probable que el propio Arafat nunca haya sido miembro de la Hermandad Musulmana, pero mantuvo estrechos contactos con ella, luchó en sus filas en Palestina en 1948 y fue miembro o incluso presidente de organizaciones cercanas a ella.
[26] Baumgarten (2006), p. 29 y ss.
[27] Ibíd., págs. 31 a 34.
[28] Mustafá (2013), p. 122.
[29] Baumgarten (2013), p. 64.
[30] Ibíd., p. 65.
[31] Ibíd., p. 66.
[32] Filiu (2012), p. 64.
[33] Flores (2009), p. 95 y ss.
[34] Baumgarten (2006), pp. 34-36, 45, 49 y ss. Hroub (2011), p. 41 y ss. Filiu (2012), p. 66.
[35] Robinson (2004), pág. 123.
[36] Rashwan (2007), pág. 107.
[37] Hussein (2019), p. 76 y ss. Cita, p. 76.
[38] Baumgarten (2006), pp. 45 y ss., 48-50.
[39] Ibíd., p. 57 y ss.
[40] Ibíd., p. 78.
[41] Ibíd., p. 91.
[42] Baumgarten menciona otra razón, a saber, que Israel no tenía ningún interés en cargar el conflicto colonial con demasiada religiosidad, razón por la cual había existido durante mucho tiempo una “táctica de no intervención” hacia las mezquitas” (ibíd., p. 73), que, sin embargo, ya no se puede decir que sea el caso hoy.
[43] Ibíd., p. 49.
[44] Esto no cambia por el hecho de que el propio Hamás niegue cualquier ruptura en su historia y, en cambio, lo presente como un desarrollo estricto y armonioso desde Izz ad-Din al-Qassam a través de los HM hasta el día de hoy. (Filiu, 2012), p. 54.)
[45] Baumgarten (2006), p. 76.
[46] Filiu (2012), p. 66.
[47] Kienzler (1996), págs. 17, ss. 28 y ss. 56.
[48] Halm (1988), págs. 89 y 130 y ss.
[49] Para una comparación entre las reformas protestante y salafista, véase Murtaza (2016), pp. 106 y ss.
[50] Hochgeschwender (2018), p. 84.
[51] Seidensticker (2015), págs. 39-42.
[52] Lohlker (2017), pp. 52-54, 106-112. Seidensticker (2015) pp. 24-27.
[53] Nassar (2022).
[54] Seidensticker (2015), p. 82.
[55] Baumgarten (2006), págs. 20-28. Metzger (2005), págs. 58-63.
[56] AlDailami (2019), p. 67 y ss. Partrick (2016).
[57] Metzger (2005), págs. 70-73. Seidensticker (2015), págs. 75 y ss.
[58] Ibíd., págs. 72 a 74.
[59] Mustafá (2013), p. 70.
[60] Ziolkowski (2020), págs. 171-74.
[61] Hroub (2011), p. 109 y ss.
[62] Noticias ocupadas (2024).
[63] Beaumont (2009).
[64] Isacarov (2011).
[65] Reed (2015). Staff (2017).
[66] Ynet (2015).
[67] Abuheweila / Kershner (2018).
[68] Leukefeld (2017), p. 183 y ss.
[69] Nassar (2022).
[70] Seurat (2019), p. 31.
[71] Estos y otros aspectos que rodean la acusación de antisemitismo, otro texto sobre la A continuación, se publicará la ayuda a la argumentación.
[72] Kilani (2021).
[73] Krämer (2011), p. 165.
[74] Citado de Baumgarten (2006), p. 62.
[75] Ibídem.
[76] Krämer (2011), págs. 150-157.
[77] Hafez (2009), p. 175.
[78] Lewis (1987).
[79] Ibíd., p. 165.
[80] Flores (2008), p. 153.
[81] Ibíd., p. 153 y ss.
[82] Mustafá (2013), p. 72.
[83] Hafez (2009), p. 180.
[84] Hroub (2011), págs. 60 y 74.
[85] Ibíd., págs. 55 y 69.
[86] Ibíd., págs. 60 y 69.
[87] Hamás (2017).
[88] Hroub (2011), p. 70.
[89] Ibíd., p. 68.
[90] Citado en Hroub (2011), p. 21.
[91] MLPD (2023 a). Al mismo tiempo, en esta declaración subordinada, se sitúa en a su manera típica como víctimas de la agitación “anticomunista”, mientras que ella, insignificante como es, al mismo tiempo contra los más fuertes el poder del movimiento por la libertad palestino.
[92] MLPD (2023 b).
[93] MLPD (2023 c).
[94] Citado de Baumgarten (2006), p. 213.
[95] Ibídem.
[96] Hroub (2011), p. 130.
[97] Baumgarten (2006), p. 59. Hroub (2011), p. 132.
[98] Ibídem.
[99] Construcción comunista (2018 b).
[100] Construcción comunista (2018 a).
[101] Ibíd. Construcción comunista (2018 b).
[102] Construcción comunista (2018 a).
[103] Construcción comunista (2021).
[104] Hroub (2011), p. 71 y ss. Wild (2015), p. 154.
[105] Construcción comunista (2023).
[106] Motadel (2017), p. 139 y ss.
[107] Gershoni / Nordbruch (2011), p. 137 y ss.
[108] Ibíd., p. 288 y ss.
[109] Krämer (2022), p.198 y ss.
[110] Achcar (2012), pp. 84-86.
[111] Flores (2009), p. 48.
[112] Scher (2015).
[113] Motadel (2017), pp. 56-58.
[114] Pappe (2017), p. 47 y ss.
[115] Véase Brenner (2007). Brentjes (2001). Krammer (2010). Nicosia (2012).
[116] Achcar (2012), pp. 129-131.
[117] Zimmer-Winkel (1999). Con contribuciones de Gerhard Höpp (ex erudito de la RDA en Oriente Medio), Danny Rubinstein (Haaretz), Suleiman Abu Dayyeh (Fundación Friedrich Naumann en Jerusalén) y Wolf Ahmet Aries (erudito islámico en Kassel),
[118] Achcar (2012), pp. 123-166.
[119] Ibíd., p. 157 y ss., Baumgarten (2006), p. 18.
[120] Croitoru (2007), pág. 32.
[121] Achcar (2012), p. 158.
[122] Ibíd., págs. 158 a 166.
[123] Flores (2009), pp. 48-50.
[124] Krämer (2011), p. 165.
[125] Motadel (2017), p. 57 y ss.
[126] Pappe (2017), p. 48.
[127] Ángel Salvaje (2005), p. 115 s.
[128] Ibíd., p. 119.
[129] Amigo.
[130] Reinisch (2023 b), p. 11 y ss.
[131] Hack (1983).
[132] Estatuto de Roma (1998).
[133] Hroub (2011), pp. 87-90. Baumgarten (2013), pp. 115, 133 ss.
[134] Hamás (2024).
[135] Mamdani (2006), pág. 239.
[136] Ibídem.
[137] Ibíd., p. 305, nota 294.
[138] Ministerio de Relaciones Exteriores (2008).
[139] Baumgarten (2006), pág. 85.
[140] Singh (2023).
[141] Baumgarten (2006), p. 159 y ss.
[142] Ibíd., p. 160.
[143] Asseburg (2008), p. 87.
[144] Mustafá (2013), pp. 170-177.
[145] Baumgarten (2006), p. 55. Flores (1988), pp. 86-88.
[146] Baumgarten (2006), p. 86.
[147] Citado en ibíd., p. 221.
[148] Ibíd., p. 83.
[149] Hroub (2011), p. 123.
[150] Hussein (2019), págs. 139-149.
[151] Baumgarten (2013), p. 156.
[152] Hajjaj (2023).
[153] Khalil (2010), p. 102.
[154] Baumgarten (2013), p. 164.
[155] Ibíd., p. 193.
[156] Baconi (2018), p. 223 y ss.
[157] Asseburg (2021), p. 198 y ss.
[158] Poppe (2021).
[159] Baumgarten (2021), p. 158.
[160] Baumgarten (2013), p. 152.
[161] Ibíd., p. 156 y ss.
[162] Asseburg (2008), p. 89.
[163] Ibíd., p. 90.
[164] Baumgarten (2013), p. 159.
[165] Asseburg (2008), p. 90. Baumgarten (2013), p. 162 y ss.
[166] Asseburg (2008), p. 91.
[167] Baconi (2018), p. 124.
[168] Baumgarten (2013), p. 163.
[169] Ibíd., págs. 163 a 166.
[170] Baumgarten (2006), pág. 92.
[171] Ibíd., p. 93.
[172] Ibíd., p. 94.
[173] Ibíd., págs. 97 a 101.
[174] Salvaje (2015), págs. 17-19.
[175] Mustafá (2013), p. 130 y ss.
[176] Hamás (2017).
[177] Mustafá (2013), p. 132.
[178] Bamen (2023 b). Salvaje (2015), p. 139.
[179] Pappe (2007), págs. 58 y 61.
[180] Bamen (2023 b).
[181] Ibídem.
[182] Asseburg (2008), p. 86 y ss. Baumgarten (2006), p. 189. Flores (2009), p. 96. Künzl (2008), p. 120 y ss.
[183] Flores (2009), p. 96.
[184] Asseburg (2008), p. 86 y ss.
[185] Baumgarten (2006), pág. 58.
[186] Felsch (2011), p. 106.
[187] Hroub (2011), págs. 55 y 68.
[188] Meyer (2009), p. 95 y ss.
[189] Mustafá (2013), p. 67.
[190] Ziolkowski (2020), p. 131.
[191] Hroub (2011), p. 55.
[192] Baumgarten (2024).
[193] Baumgarten (2006), págs. 58 y 198, nota 47.
[194] Felsch (2011), p. 106.
[195] Asseburg (2008), p. 87. Hroub (2011), pp. 60, 69, 185-90. Hussein (2019), p. 98 y ss.
[196] Asseburg (2008), p. 86 y ss. Baumgarten (2006), p. 65 y ss. Hroub (2011), p. 68. Hussein (2019), p. 98 y ss. Mustafa (2013), p. 67.
[197] Tamimi (2007b), pág. 155.
[198] Ibíd., p. 150.
[199] Achcar (2012), p. 238.
[200] Hroub (2011), p. 60.
[201] Achcar (2012), p. 238.
[202] Seidensticker (2015), p. 90.
[203] Hussein (2019), p. 98 f. 277 s., cita p. 277.
[204] Hamás (2017).
[205] Asseburg (2021), p. 198.
[206] Baconi (2018), p. 245.
[207] Hussein (2019), p. 105.
[208] AlJazeera (2017)
[209] Hroub (2017), p. 102.
[210] Abunimah (2017).
[211] Baumgarten (2019), p. 85.
[212] Citado en Seurat (2019), p. 18.
[213] Baumgarten (2006), págs. 58-66.
[214] Hroub (2011), págs. 54-60
[215] Meyer (2009), págs. 94-125.
[216] Mustafá (2013), pp. 67-74, 119-122.
[217] Abunimah (2017).
[218] Langthaler (2017).
[219] Seurat (2019), p. 177 y ss.
[220] Seurat (2019), pp. 22, 178 y ss.
[221] Baumgarten (2006), pág. 83.
[222] Abdullah (2020), pp. 34 y ss., 63, 83 y ss., 91 y ss., cit., p. 84.
[223] Baumgarten (2006), p. 85. Abdullah (2020), p. 22, nota 106.
[224] Ibíd., p. 107. Se
Bibliografía
Abuheweila, Iyad / Kershner, Isabel: ISIS declara la guerra a Hamas, y las familias de Gaza repudian a sus hijos en el Sinaí (2018), https://www.nytimes.com/2018/01/10/world/middleeast/isis-hamas-sinai.html.
Abunimah, Ali: ¿Qué hay detrás de los nuevos estatutos de Hamás? (2017), https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/whats-behind-hamas-new-charter.
Achcar, Gilbert: Los árabes y el Holocausto. La guerra árabe-israelí de la historiografía, Nautilus Verlag (2012).
AlDailami, dijo: Yemen. La guerra olvidada, C.H. Beck (2019).
Al Jazeera: Hamas acepta un Estado palestino con fronteras de 1967, https://www.aljazeera.com/news/2017/5/2/hamas-accepts-palestinian-state-with-1967-borders.
Al-Monitor: Irán aumenta la ayuda al FPLP gracias a la postura de Siria (2013), https://www.al-monitor.com/originals/2013/09/iran-pflp-gaza-palestine-syria.html.
Asseburg, Muriel: El Hamas palestino entre el Movimiento de Resistencia, el Partido y el Gobierno, en: Muriel Asseburg (ed.): ¿Islamistas moderados como actores reformistas?, Agencia Federal para la Educación Cívica (2008), pp. 81-98.
Asseburg, Muriel: Palestina y los palestinos. Una historia desde la Nakba hasta el presente, C.H. Beck (2021).
Baconi, Tareq: Hamas contenido. El ascenso y la pacificación de la resistencia palestina, Stanford University Press (2018).
Baconi, Tareq: Cómo Hamás se convirtió en el rostro violento de la resistencia palestina (2023), https://jacobin.de/artikel/hamas-gaza-israel-palaestina-widerstand.
Baker, Fouad: “En el centro está el fin de la ocupación” (2024), https://www.jungewelt.de/artikel/466488.palästinensischer-widerstand-im-zentrum-steht-die-beendigung-der-besatzung.html.
Bamen, Noel: Con intenciones solidarias con Palestina en el infierno sionista: una crítica a las “líneas básicas” del MLPD sobre la lucha de liberación palestina (2023), https://kommunistische-organisation.de/artikel/mit-palaestina-solidarischen-vorsaetzen-in-die-zionistische-hoelle-eine-kritik-an-den-grundlinien-der-mlpd-zum-palaestinensischen-befreiungskampf/.
Bamen, Noel: ¡Ni traición ni utopismo, sino liberación nacional! Sobre el debate sobre la solución de uno y dos Estados para Palestina (2023), https://kommunistische-organisation.de/artikel/weder-verrat-noch-utopismus-sondern-nationale-befreiung-zur-debatte-um-die-ein-und-zweistaatenloesung-fuer-palaestina/.
Baumgarten, Helga: Hamás. El Islam político en Palestina, Diederichs (2006).
Baumgarten, Helga: Hamás – Entrevista con la revista Internacional (2024), https://www.youtube.com/watch?v=Bj6qRZ_IjuA.
Baumgarten, Helga: Kampf mmm Palästina. ¿Qué quieren Hamás y Fatah?, Herder (2013).
Baumgarten, Helga: No hay paz para Palestina. Guerra en Gaza, ocupación y resistencia, Promedia (2021).
Beaumont, Peter: Hamas destruye al grupo al-Qaida en una violenta batalla en Gaza (2009), https://www.theguardian.com/world/2009/aug/15/hamas-battle-gaza-islamists-al-qaida.
Brenner, Lenni: Zionismus und Faschismus. Sobre la extraña cooperación entre fascistas y sionistas, Kai Homilius Verlag (2007).
Brentjes, Burchard: Operación Secreta en Oriente Medio. Zur Vorgeschichte der Zusammenarbeit von Mossad und BND, Edition Ost (2001).
Canal 13 (2024), https://t.me/MiddleEastEye_TG/2400.
Croitoru, Joseph: Hamás. La lucha islámica por Palestina, Agencia Federal para la Educación Cívica (2007).
Duden: Terror, https://www.duden.de/rechtschreibung/Terror.
Filiu, Jean-Pierre: Los orígenes de Hamás. ¿Legado militante o herramienta israelí? (2012), https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/jps/v41i3/f_0025591_20939.pdf.
Flores, Alexander: El antisemitismo árabe en la perspectiva occidental, en: John Bunzl / Alexandra Senfft (eds.): Entre el antisemitismo y la islamofobia, VSA (2008), pp. 145-159.
Flores, Alexander: Der Palästinakonflikt. Wissen, Herder (2009).
Flores, Alejandro: Intifada. Levantamiento de los palestinos, Rotbuch Verlag (1988).
Gershoni, Israel / Nordbruch, Götz: Simpatía y horror. Encuentros con el fascismo y el nacionalsocialismo en Egipto, 1922-1937, Klaus Schwarz Verlag (2011).
Hack, Dietmar: “Heute ist Zahltag für die Unglaubenen” (1983), https://www.spiegel.de/politik/heute-ist-zahltag-fuer-die-unglaeubigen.
Hafez, Kai: Heiliger Krieg und Demokratie. Radicalismo y cambio político en la comparación islámico-occidental, Transcript Verlag (2009).
Hajjaj, Tareq S.: Qué significa ser un gobierno y un movimiento de resistencia (2023), https://mondoweiss.net/2023/07/what-it-means-to-be-a-government-and-a-resistance-movement/.
Halm, Heinz: Die Schia, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1988).
Hamás: Principios y Principios (2017), https://magma-magazin.su/2023/11/uebersetzungsdienst/hamas-prinzipien-und-grundsaetze/.
Hamás: Nuestra visión de la Operación Inundación de Al-Aqsa (2024), https://magma-magazin.su/2024/01/uebersetzungsdienst/unsere-sicht-der-operation-al-aqsa-flut/.
Harman, Chris: Islam político. Un análisis marxista, Edición Aurora (4ª edición 2012).
Hochgeschwender, Michael: Der amerikanische Evangelikalismus bis 1950, en: Frederik Elwert / Martin Radermacher / Jens Schlamelcher (eds.) Handbuch Evangelikalismus, Bundeszentrale für politische Bildung (2018), pp. 73-92.
Hoekmann, Gerrit: Zwischen Ölzweig und Kalashnikow. Historia y política de la izquierda palestina, disturbios (1999).
Hroub, Khaled: ¿Un nuevo Hamás? La Carta Revisada (2017), PDF.
Hroub, Khaled: Hamás. El movimiento islámico en Palestina, Palmyra Verlag (2011).
Hroub, Khaled: Hamás. Pensamiento y Práctica Política, Instituto de Estudios Palestinos (2ª edición 2002).
Hussein, Raif: Der politische Islam in Palästina. Utilizando el ejemplo del movimiento islamista HAMAS, Shaker Verlag (2019).
Issacharoff, Avi: Hamas mata a 2 sospechosos durante la búsqueda de los asesinos de un activista italiano en Gaza (2011), https://www.haaretz.com/2011-04-20/ty-article/hamas-kills-2-suspects-during-manhunt-for-murderers-of-italian-activist-in-gaza/0000017f-f832-d460-afff-fb762fbb0000.
Johansen, Baber: Islam und Staat. Desarrollo dependiente, gestión de la miseria y antiimperialismo religioso, Argumentación Verlag (1982).
Khalil, Naser: Nayef Hawatmeh (FDLP): Pioneros y críticos de una solución pacífica del conflicto palestino, Grin Verlag (2010).
Kienzler, Klaus: Der religiöse Fundamentalismus. Cristianismo, judaísmo, islam, C.H. Beck (1996).
Kilani, Ramsis: El antisemitismo es una forma de racismo (2021), https://diefreiheitsliebe.de/politik/antisemitismus-ist-eine-form-von-rassismus/.
Construcción comunista: fundamentalismo islámico e imperialismo – Parte 1 (2018), https://komaufbau.org/islamischer-fundamentalismus-und-imperialismus-teil-1/.
Construcción comunista: fundamentalismo islámico e imperialismo – Parte 2 (2018), https://komaufbau.org/islamischer-fundamentalismus-und-imperialismus-teil-2/.
Construcción comunista: la cuestión nacional en Palestina e Israel (2021), https://komaufbau.org/die-nationale-frage-in-palaestina-und-israel/.
Construcción comunista: ¡La lucha contra la ocupación israelí es legítima! ¡Paz entre los pueblos, guerra a los imperialistas! ¡Libertad para Palestina! (2023), https://komaufbau.org/der-kampf-gegen-die-israelische-besatzung-ist-legitim-friede-zwischen-den-voelkern-krieg-den-imperialisten-freiheit-fuer-palaestina/.
Organización comunista: otro golpe a la resistencia de Oriente Medio (2020), https://kommunistische-organisation.de/stellungnahme/weiterer-schlag-gegen-den-widerstand-im-nahen-osten/
Organización comunista: ¡Cualquiera que viole la razón de Estado será proscrito! (2023), https://kommunistische-organisation.de/stellungnahme/wer-gegen-die-staatsraeson-verstoesst-wird-verboten/.
Krämer, Gudrun: La democracia en el Islam. La lucha por la tolerancia y la libertad en el mundo árabe, C.H. Beck (2011).
Krämer, Gudrun: el arquitecto del islamismo. Hasan al-Banna y los Hermanos Musulmanes, C.H.Beck (2022).
Krammer, Hubert: Jenseits der Mythen. Imperialismo, sionismo, fascismo. Eine Quellenrecherche über die Geschichte einer Kontinuität, Theorie und Praxis Verlag (2010).
Künzl, Jan: Islamistas, ¿terroristas o reformistas? Los Hermanos Musulmanes egipcios y el Hamás palestino, Tectum Verlag (2008).
Langthaler, Wilhelm: El nuevo documento político de Hamás (2017), https://www.antiimperialista.org/de/content/das-neue-politische-dokument-der-hamas.
Leopardi, Francesco Saverio: La izquierda palestina y su decadencia. Oposición leal, Palgrave Macmillian (2020).
Leukefeld, Karin: Flächenbrand. Siria, Irak, el mundo árabe y el Estado Islámico, Papyrossa (3ª edición 2017).
Leukefeld, Karin: ¿Quién es Hamas? (2023), https://www.unsere-zeit.de/wer-ist-die-hamas-4785170/.
Lewis, Bernhard: Los judíos en el mundo islámico. De la Alta Edad Media al siglo XX, C.H. Beck (1987).
Mamdani, Mahmood: Buen musulmán, mal musulmán. América y las raíces del terror, Edición Nautilus (2004).
Marx21: Breve historia de Hamás (2023), https://www.marx21.de/eine-kurze-geschichte-der-hamas/.
Memri TV: Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá: La guerra entre Israel y Gaza es 100% palestina y no tiene nada que ver con cuestiones regionales; Ya hemos estado luchando contra Israel desde el 8 de octubre; Israel, no Hamás, masacró a civiles israelíes (2023), https://www.memri.org/tv/hizbullah-nasrallah-lebanon-hamas-war-entirely-palestinian-israel-massacred-israelis.
Metzger, Albrecht: Islamismus, EVA (2005).
Meyer, Henrik: Hamás y Hezbolá. Un análisis de su pensamiento político, LIT Verlag (2009).
Ministerio de Relaciones Exteriores: Atentado suicida con bomba en Kerem Shalom, 13 soldados heridos (2008), https://www.gov.il/en/Departments/General/suicide-bombing-attack-at-kerem-shalom-13-soldiers-wounded.
MLPD: Acontecimiento muy peligroso después de que Israel declare la guerra Críticas a la solidaridad fascista de Hamás con la lucha de liberación palestina (2023), https://www.mlpd.de/2023/10/brandgefaehrliche-entwicklung-nach-kriegserklaerung-durch-israel-200bkritik-an-faschistischer-hamas-200bsolidaritaet-mit-dem-palaestinensischen-befreiungskampf.
MLPD: ¡No hay punto de apoyo para organizaciones fascistas como Hamas! Lucha contra la criminalización de la lucha de liberación palestina. ¡Protesta contra el terror de Estado del imperialista Israel y la agitación anticomunista contra el MLPD! (2023), https://www.mlpd.de/2023/10/kein-fussbreit-fuer-faschistische-organisationen-wie-die-hamas-kampf-der-kriminalisierung-des-palaestinensischen-befreiungskampfs-protest-gegen-den-staatsterror-des-imperialistischen-israels-und-die-antikommunistische-hetze-gegen-die-mlpd.
MLPD: Sobre la ideología fascista, antisemita y anticomunista de Hamás (2023), https://www.mlpd.de/2023/10/hamas-faschistische-ideologie.
Mondoweiss: El informe de la CNN que afirma que la violencia sexual del 7 de octubre se basó en testigos no creíbles, algunos con vínculos no revelados con el gobierno israelí (2023), https://mondoweiss.net/2023/12/cnn-report-claiming-sexual-violence-on-october-7-relied-on-non-credible-witnesses-some-with-undisclosed-ties-to-israeli-govt/.
Motadel, David: Für Prophet und Führer. El mundo islámico y el Tercer Reich, Klett-Cotta (2017).
Murtaza, Muhammad Sameer: La Reforma fallida. El pensamiento salafista y la renovación del islam, Herder Verlag (2016).
Mustafa, Imad: Der Politische Islam. Entre los Hermanos Musulmanes, Hamás y Hezbolá, Promedia (2013).
Narwani, Sharmine / Inlakesh, Robert: ¿Qué pasó realmente el 7 de octubre? (2023), traducción al alemán: linkezeitung.de.
Nassar, Abdelrahman: Hamás: a pesar de los spoilers, la dirección del Eje de Resistencia se solidifica (2022), https://new.thecradle.co/articles/hamas-resistance-axis-direction-solidifies-despite-internal-differences.
Nicosia, Francis R.: Sionismo y antisemitismo en el Tercer Reich, Wallstein Verlag (2012).
Noticias ocupadas: 7 de octubre – Hechos y propaganda (2024), https://occupiednews.com/7-oktober-hamas-angriff/.
Solidaridad con Palestina Duisburgo (2023), https://t.me/PalaestinaSolidaritaetDuisburg/352.
Pappe, Ilan: La limpieza étnica, Zweitausendeins Verlag 2007.
Pappe, Ilan: ¿Qué le pasa a Israel? Cosmics Verlag (3ª edición 2017).
Partrick, Neil: Los aliados problemáticos de Arabia Saudita contra los hutíes (2016), https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/saudi-arabias-problematic-allies-against-the-houthis/.
Poppe, Judith: Abbas cancela las elecciones (2021), https://taz.de/Palaestinensische-Gebiete/!5769217/.
PressTV: Gen. Qaani: El “Eje de la Resistencia” se mantiene unido con los combatientes de Gaza, https://www.presstv.ir/Detail/2023/11/16/714729/Iran-Quds-Force-IRGC-Gaza-fighters-Qassam-Brigades.
Rashwan, Diaa: El espectro del movimiento islamista, Verlag Hans Schiler (2007).
Reed, John: Hamas busca acabar con Isis en Gaza (2015), https://www.ft.com/content/7d6c49d0-0547-11e5-9627-00144feabdc0.
Reinisch, Dieter: En nombre de la unidad (2023 a), https://www.jungewelt.de/artikel/462610.palästina-im-namen-der-einheit.html.
Reinisch, Dieter: Terror. Una historia de la violencia política, Promedia (2023 b).
Red de Noticias de la Resistencia (2022), https://t.me/PalestineResist/2256.
Red de Noticias de la Resistencia (2024), https://t.me/PalestineResist/26397.
El “Eje de la Resistencia” de Irán contra Israel se enfrenta a una prueba de fuego, https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-axis-resistance-against-israel-faces-trial-by-fire-2023-11-15/.
Robinson, Glenn E.: Hamas como movimiento social (2004), https://www.researchgate.net/profile/Glenn-Robinson-2/publication/292494431_Hamas_as_social_Movement/links/5d5d9eada6fdcc55e81edb86/Hamas-as-social-Movement.pdf.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), https://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html#T28.
Bandera Roja: MLPD – Principios de Posicionamiento sobre la Lucha de Liberación Palestina (2022), https://www.rf-news.de/rote-fahne/2022/nr23/mlpd-grundlinien-der-positionierung-zum-palaestinensischen-befreiungskampf.
Scher, Brent: La verdadera historia detrás de los comentarios de Netanyahu sobre el Holocausto. Una entrevista con el Dr. Wolfgang G. Schwanitz (2015), https://www.meforum.org/5581/schwanitz-interview.
Seidensticker, Tilman: Islamismo. Historia, Líderes de Opinión, Organizaciones, C.H. Beck (3ª edición 2015).
Seurat, Leila: La política exterior de Hamás. Ideología, toma de decisiones y supremacía política, I.B. Tauro (2019).
Singh, Rishika: ¿Qué países reconocen a Hamas como una organización “terrorista”? (2023), https://indianexpress.com/article/explained/everyday-explainers/israel-countries-recognise-hamas-terrorist-list-9036186/.
Staff, Toi: Hamas afirma haber arrestado a altos líderes del Estado Islámico en Gaza (2017), https://www.timesofisrael.com/hamas-arrests-senior-islamic-state-leaders-in-gaza-report/.
Tamimi, Azzam: Hamás. Una historia desde adentro, Olive Branch Press (2007).
Tamimi, Azzam: Hamás. Capítulos no escritos, C. Hurst & Co (2007).
La cuna: “Cambio de régimen” en Hamás y retorno a Siria (2022), https://new.thecradle.co/articles/regime-change-in-hamas-and-a-return-to-syria. Traducción al alemán: https://linkezeitung.de/2022/09/28/regimewechsel-bei-der-hamas-und-ihre-rueckkehr-nach-syrien/.
Van Wegenen, William: Cómo las fuerzas israelíes atraparon y mataron a los ravers en el Festival Nova (2024), https://thecradle.co/articles/how-israeli-forces-trapped-and-killed-ravers-at-the-nova-festival. Traducción al alemán: https://linkezeitung.de/2024/01/14/wie-israelische-streitkraefte-raver-auf-dem-nova-festival-gefangen-hielten-und-toeteten/.
Van Wegenen, William: Se expone el video de 43 minutos de Israel sobre la atrocidad de Hamas (2023 a), https://thecradle.co/articles/israels-43-minute-hamas-atrocity-video-exposed. Traducción al alemán: https://linkezeitung.de/2023/12/07/israels-43-minuetiges-video-der-hamas-graeueltaten-entlarvt/.
Van Wegenen, William: ¿Fue el 7 de octubre una masacre de Hamás o de Israel? (2023 b), https://thecradle.co/articles/was-october-7th-a-hamas-or-israeli-massacre. Traducción al alemán: https://linkezeitung.de/2023/11/26/war-der-7-oktober-ein-massaker-der-hamas-oder-der-israelis/.
Wild, Petra: La crisis del sionismo y la solución de un solo Estado. El futuro de una Palestina democrática, Promedia (2015).
Wildangel, René: “El mayor enemigo de la humanidad”. El nacionalsocialismo en la opinión pública árabe en Palestina durante la Segunda Guerra Mundial, en: Gerhard Höpp / Peter Wien / René Wildangel (eds.): ¿Ciegos para la historia? Encuentros árabes con el nacionalsocialismo, Klaus Schwarz Verlag (2005), pp. 115-154.
Winstanley, Asa: El cuartel general israelí ordenó a las tropas disparar a los cautivos israelíes el 7 de octubre (2024) de https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/israeli-hq-ordered-troops-shoot-israeli-captives-7-october. Traducción al alemán: magma-magazin.su.
Wystrychowski, Leon: Entre el colonialismo, la liberación nacional y la lucha de clases: la izquierda palestina e israelí. Un panorama histórico, Aforisma Verlag (2023).
Ynet: Hamas mata a un partidario de ISIS a pesar del ultimátum de 48 horas dado por los partidarios de ISIS en Gaza (2015), https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4663942,00.html.
Zimmer-Winkel, Rainer (Hrsg.): Eine kontroverse Figura: Hadj Amin al-Husseini. Muftí de Jerusalén, Aphorisma Verlag (1999).
Ziolkowski, Britt: Los activistas de los Ḥamas. Sobre el papel de la mujer en un movimiento islamista, Klaus Schwarz Verlag (2020).