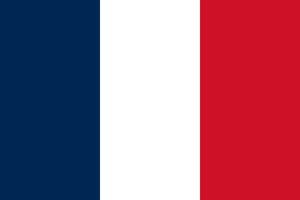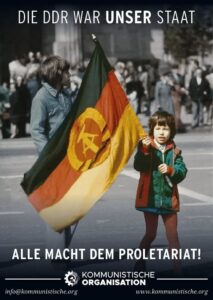Autos zu Rüstung – Deutschlands Übergang zur Rüstungswirtschaft
Themen: Deutscher Imperialismus

Aktuelle Entwicklungen, die Rolle der Gewerkschaften
und Widerstand
Beitrag von Franzi Stein
VW will in die Rüstungsproduktion einsteigen, in Görlitz wurde ein Waggonbau-Werk auf Panzerproduktion umgestellt, und die abgewählte Bundesregierung hat 500 Milliarden Euro für den Ausbau einer kriegstüchtigen Infrastruktur bereitgestellt. Die Rheinmetall-Aktie geht durch die Decke, die Lobby der Rüstungsindustrie propagiert die Parole „Autos zur Rüstung“1 und in der Öffentlichkeit wird mittlerweile offen von Rüstungs- oder Kriegswirtschaft gesprochen – um nur ein paar der jüngsten Entwicklungen zu nennen.
Doch was spricht eigentlich für den Übergang zur Rüstungswirtschaft in Deutschland? Welche Folgen hat dies für die Arbeiterklasse? Wie positionieren sich die Gewerkschaften zu dieser Entwicklung und welchen Protest gibt? Diesen Fragen geht der vorliegende Beitrag nach. Im Hintergrundteil am Ende wird außerdem auf den Begriff der Kriegswirtschaft eingegangen und ein Blick in die Geschichte geworfen, genauer gesagt auf den Aufbau der deutschen Kriegswirtschaft während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Der Beitrag gibt keine abschließende Einschätzung über die auftretenden Probleme und Widersprüche, sondern möchte einen Einstieg ins Thema bieten. Für diese Fragen ist der Beitrag von Conny Renkl und Stephan Müller in der Wochenzeitung Unsere Zeit zu empfehlen, in dem viele interessante Punkte angesprochen werden.2
Hintergrund der oben genannten Entwicklung ist die Situation des Imperialismus im Allgemeinen und die des deutschen Imperialismus im Speziellen: Dem westlichen Block drohen Einfluss- und Hegemonieverlust, insbesondere aufgrund der Entwicklung Chinas und einer damit einhergehenden Neuorientierung von Staaten, die sich der neokolonialen Unterdrückung durch den Imperialismus entziehen wollen. Der Imperialismus versucht, seine Hegemonie auf verschiedene Weise zu sichern – Krieg ist einer davon, wie die gesteigerte Aggression gegen Russland und China deutlich macht. Auch innerhalb des imperialistischen Lagers werden die Widersprüche auf ökonomischer Ebene verstärkt ausgetragen, wie die Sprengung der Nord Stream II-Pipeline, der Inflation Reduction Act und die aktuelle Zollpolitik unter Trump zeigen.
Der deutsche Imperialismus steht unter Druck und muss verschiedene Herausforderungen bewältigen, um seine Stellung in der Welt zu sichern: Erstens muss er seine Position als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt behaupten. Dafür ist es notwendig, in einem möglicherweise verstärkten Wirtschaftskrieg gegen die USA zu bestehen, dafür die Stabilität in der EU zu sichern und gleichzeitig die deutsche Industrie und Wirtschaft so umzubauen, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Zweitens muss er das gigantische Aufrüstungs- und Kriegsvorhaben stemmen und dafür enorme Finanzierungsleistungen erbringen. Drittens muss er die für dieses Programm erforderliche Stabilität in der Bevölkerung absichern. Hier lotet der deutsche Imperialismus aus, wie viel Angriff auf die Arbeiterklasse möglich ist und wie viel Zugeständnis notwendig ist.
Aktuelle Entwicklungen im Übergang zur Rüstungswirtschaft
In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Entwicklungen dargestellt, die für den Aufbau einer Rüstungswirtschaft in Deutschland sprechen: der Ausbau des militärisch-industriellen Komplexes, die Kriegskredite, der Umbau der Wirtschaft, die Rohstoff- und Energiebeschaffung sowie Staatseinstiege in die Rüstungsbranche.
Ausbau des militärischen-industriellen Komplexes
Der Ausbau und die Förderung der Rüstungsindustrie haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Von Januar 2020 bis Juli 2024 wurden Aufträge im Gesamtwert von knapp 140 Milliarden Euro verzeichnet. Vor allem seit Ende 2023 ist ein massiver Anstieg der Aufträge für die Rüstungsindustrie zu beobachten, unter anderem aus Zahlungen aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen. Der Staat will die Abnahmegarantie von Rüstungsgütern sichern, um die Produktion zu steigern. Nur ein Viertel dieser Ausgaben ging an ausschließlich ausländische Hersteller, während die restlichen 75 % mindestens anteilig an deutsche Rüstungsunternehmen flossen.3
Neben der Produktion soll auch die Reparatur und Wartung hauptsächlich bei deutschen Unternehmen liegen, um die Unabhängigkeit zu erhöhen. Zudem soll der Technologieabfluss in Drittstaaten verhindert werden, was auch ein zentraler Punkt der im November 2024 veröffentlichten Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie (SVI)4ist. In der SVI wird der Ausbau des militärisch-industriellen Komplexes (MIK) in Deutschland skizziert und der Fokus auf nationale Unabhängigkeit in Fragen der Schlüsseltechnologien, Beschaffung, Reparatur und Wartung gesetzt. Darüber hinaus wird festgehalten, dass Regularien im Sinne des MIK abgebaut, die Beschaffung auf europäischer Ebene vorangetrieben und Arbeitskräfte für die Rüstungsunternehmen gewonnen werden sollen. Die Aussagen verschiedener Vertreter des MIK auf einer Konferenz des Handelsblatts zu „Verteidigung und Sicherheit“ unterstreichen dies: „Wir produzieren schon jetzt mehr Munition als die Vereinigten Staaten“, sagt Rheinmetall-Chef Armin Papperger. „Wir sind bereit zu liefern, und wir sind in der Lage, die Bundeswehr bis 2029 kriegstüchtig zu machen“, sagt MBDA5-Deutschlandchef Thomas Gottschild. „Dafür brauchen wir eine substanzielle finanzielle Ausstattung, klare Abnahmemengen für mehr Planungssicherheit und verlässliche Exportbedingungen, fordert Gottschild. Nur dann könnten die Unternehmen investieren und Skaleneffekte erzielen.“6
Ein Beispiel für den Abbau von Regularien ist die angestrebte Abschaffung der Zivilklausel, um jegliche Forschung in den Dienst der Rüstungsindustrie stellen zu können.7 Vermutlich sollen in Zukunft auch die parlamentarische Aufsicht und Kontrollen weiter eingeschränkt werden. Dies liegt zumindest nahe, wenn man einen Blick in den Bericht des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW) zur Entwicklung der Aufrüstung wirft: „Zu den Problemen, die zu einer langsamen und teuren Beschaffung führen, gehören nach Ansicht des Gremiums eine übermäßige parlamentarische Aufsicht über einzelne Beschaffungen, die zu einer Kirchturm-Politik führen kann, administrative Hürden, die den Schutz kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in den Vordergrund stellen, Vertragsgestaltungen, denen es an Anreizen für Rüstungsunternehmen mangelt, sowie eine unzureichende Innovation im Allgemeinen.“ Das IfW argumentiert für „anreizkompatible Verträge“, die „für den Erfolg des deutschen Rüstungswunders von zentraler Bedeutung waren, nachdem Albert Speer sie 1941 initiiert hatte“8und macht damit deutlich, in welche Richtung es gehen soll.
Infolge des massiven staatlichen Ausbaus des MIK haben sich die Aktienkurse der Rüstungskonzerne im Rekordtempo gesteigert. So verzeichnet beispielsweise die Rheinmetall-Aktie seit Jahresbeginn 2025 einen Anstieg von über 80 %, vorwiegend aufgrund der verabschiedeten Aufrüstungspakete.9 Im IfW-Bericht kann man dazu lesen: „Seit Beginn der Invasion sind die Aktienkurse von Rüstungsunternehmen jedoch erheblich gestiegen, was darauf hindeutet, dass zumindest die börsennotierten Unternehmen in Europa in der Lage sein sollten, sich eine Finanzierung zu sichern.“10
Die Aufrüstung im europäischen Rahmen ist Konsens in der herrschenden Klasse, um die eigene Schlagkraft zu erhöhen. Bei einem EU-Sondergipfel wurden Kriegskredite in Höhe von 800 Milliarden Euro verabschiedet, um die europäische Aufrüstung in großem Stil umzusetzen. Dieses Vorhaben steht bereits länger im Raum, über die konkrete Geldbeschaffung wird noch debattiert.11 Neben den staatlich gewährten Krediten sollen auch private Sparanlagen investiert werden. Inwiefern private Ersparnisse in Form von Kriegsanleihen – es steht eine Summe von zehn Billionen Euro im Raum – in Investitionen überführt werden können, lässt Ursula von der Leyen derzeit noch offen.
Das IfW stellt fest, dass die europäische Produktion in den letzten zwei Jahren zwar zugenommen habe, allerdings immer noch „unter dem Bedarf“ liege und folglich „multinationale Innovationen und europaweite Beschaffungen“ notwendig seien, um „dem russischen Militär mehr als gewachsen“ zu sein.12 Hier gilt es für den deutschen Staat, eine möglichst große Unabhängigkeit zu sichern und die eigene Rüstungsindustrie im Wettbewerb zu stärken. Auch die 2023 in Deutschland vorgestellte Nationale Sicherheitsstrategie formuliert dies als Ziel: „Eigenständige europäische Handlungsfähigkeit ist zunehmend Voraussetzung für die Sicherheit Deutschlands und Europas. Dazu gehören moderne, leistungsfähige Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten ebenso wie eine leistungs- und international wettbewerbsfähige europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die Grundlagen der militärischen Fähigkeiten der Streitkräfte schafft. Gemeinsame Rüstungsprojekte und deren Exportfähigkeit gemäß den Maßstäben des zukünftigen Rüstungsexportkontrollgesetzes tragen dazu bei, europäische Handlungsfähigkeit voranzutreiben und stärken damit den europäischen Pfeiler in der NATO.“13
Als Probleme werden die Zersplitterung des Marktes, nationale Partikularinteressen und eine folglich zu langsame europäische Beschaffung angesehen. An der grundsätzlichen Konkurrenz der europäischen Staaten um Marktanteile wird sich sicherlich nichts ändern. Dennoch gibt es Versuche, die Produktion zu koordinieren und die Beschaffung zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise die European Defence Industry Strategy entwickelt und eine neue Kommissionsstelle eingeführt, die seit letztem Jahr mit Andrius Kubilius besetzt ist. Conny Renkl und Stephan Müller führen in ihrer Analyse einige Beispiele an, wie das deutsch-französische Panzerprojekt MGCS oder das deutsch-französische Trinity House Agreement zur Rüstungszusammenarbeit.14
Kriegskredite und Finanzierung der Rüstungswirtschaft
Finanzielles Rückgrat der rüstungsindustriellen Offensive sind auf deutscher und europäischer Ebene staatliche Kriegskredite. Im Jahr 2022 hat die deutsche Regierung bereits Kriegskredite in Form von Sonderschulden außerhalb des regulären Haushalts in Höhe von 100 Milliarden Euro verabschiedet. Hinzu kommt nun ein weiteres Paket aus 500 Milliarden Euro für Infrastrukturmaßnahmen, von denen der Großteil militärisch geprägt ist. Diese Sonderschulden werden von führenden Militärs seit langem gefordert.
Zukünftig sollen außerdem die Zahlungen aus dem regulären Haushalt erhöht werden, da die Aufstockung auf das 2%-Ziel des BIP (entspricht knapp 20 % des Haushalts) derzeit über das Sondervermögen erfolgt. Diese Vorgehensweise wird von herrschenden Militär- und Wirtschaftskreisen kritisiert: „Die mittelfristige Haushaltsplanung sieht keine systematische Erhöhung des Einzelplans 14 über die nächsten Jahre vor, sondern eine plötzliche und politisch ungewisse Erhöhung im Jahr 2028. Die unklaren Aussagen zu den künftigen Ausgaben, sowohl im Jahr 2023 als auch in der aktuellen mittelfristigen Haushaltsplanung, schaffen Unsicherheit für die Rüstungsindustrie und behindern den Aufbau industrieller Kapazitäten für die militärische Produktion.“15 Um die generelle Aufstockung des Militärhaushalts zu gewährleisten, wurde im März mit einem Eilverfahren eine Reform der Schuldenbremse vom abgewählten Bundestag durchgepeitscht: Aufrüstungsausgaben fallen zukünftig nicht mehr unter die Schuldenbremse, wodurch der Kriegsvorbereitung keine finanziellen Grenzen mehr gesetzt sind. Das Handelsblatt geht in den nächsten zehn Jahren von Investitionssummen in vorläufiger (!) Höhe von zusätzlichen 1,7 Billionen Euro zu den ohnehin schon vorgesehenen Schulden aus.16
„Autos zu Rüstung“: Umbau der Wirtschaft
Zuletzt machte VW Schlagzeilen mit der Aussage, dass der Konzern „grundsätzlich offen“ für einen Einstieg in die Rüstungsproduktion sei. Es gibt bereits konkretisierte Überlegungen, die Werke in Dresden und Osnabrück in die Rüstungsproduktion zu überführen.17 Dieser Umbau wäre in der Geschichte des Konzerns keine Neuheit; VW stellte schon im Rüstungsmarsch für den Zweiten Weltkrieg auf militärische Produktion um.18
Hintergrund für die Umstellung auf Rüstungsproduktion sind sicherlich auch die sinkenden Absatzzahlen und Krisenerscheinungen, die die deutsche Autoindustrie zuletzt plagten. VW ist nicht der einzige Konzern, der seine Profite zukünftig verlagern will; auch die durch die Abnahmekrise der Autoindustrie betroffenen Zulieferbetriebe orientieren auf Rüstungsproduktion.19 In diesem Jahr hat außerdem der Panzerbauer KNDS ein Waggonbau-Werk des Unternehmens Alstom in Görlitz übernommen und nutzt die Produktionsstätte sowie einen Großteil der Arbeiter künftig für den Panzerbau. Auch das Laserunternehmen Trumpf erwägt eine Umstellung auf Drohnenproduktion. Darüber hinaus werden Unternehmen, die bereits militärische Komponenten produzieren, diesen Bereich zukünftig stärker fokussieren. Rheinmetall, dessen Umsätze in der Auto- und Rüstungssparte 2013 noch etwa gleich groß waren, hat 2024 mehr als 75% seines Umsatzes mit Rüstung gemacht, Tendenz natürlich steigend. In der Folge hat Rheinmetall zwei Werke zur Fahrzeugfertigung auf Munitionsproduktion umgestellt.
Dieser Umbau wird durch die kürzlich verabschiedeten Kriegskredite sicherlich noch verstärkt. Dies entspricht auch den Erwartungen der Rüstungsindustriellen, wie Hans Christoph Atzpodien, Chef des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie kürzlich in der Wirtschaftswoche äußerte: „Das Motto muss lauten: Autos zu Rüstung! Anstatt einen volkswirtschaftlichen Schaden durch den Niedergang der Auto-Konjunktur zu beklagen, sollten wir versuchen, Produktionseinrichtungen und vor allem Fachkräfte aus dem Automobilsektor möglichst verträglich in den Defence-Bereich zu überführen“.20
Die Übernahme von Arbeitskräften in die Rüstungsindustrie ist nicht neu. Rheinmetall übernahm bereits im letzten Jahr entlassene Continental-Arbeiter, und Hensoldt plant dies ebenfalls mit Arbeitern von Continental und Bosch. Die IG Metall Südwest hat die Tarifverträge bereits entsprechend abgeschlossen, sodass dieser Beschäftigungswechsel jederzeit möglich ist.
Die aktuellen Stimmen des deutschen Kapitals gehen über die bloße Aussicht auf hohe Profit aus der Rüstungsproduktion hinaus. Sie wollen durch den Schwenk zur Rüstungswirtschaft die deutsche Wirtschaft insgesamt aufpolieren. In diesem Zusammenhang wurden zuletzt zwei Studien veröffentlicht: eine des Beratungsunternehmens Ey und der DekaBank und eine vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. In der Studie Wirtschaftliche Effekte europäischer Verteidigungsinvestitionen wird festgehalten, dass eine Steigerung der Aufrüstung auf 3% des BIP einen Anstieg der Arbeitsplätze und einen Boom in den beteiligten Branchen wie Logistik, Metall oder Forschung zur Folge hätte.21 Das IfW stellt in seiner Studie Waffen und Wachstum: Die wirtschaftlichen Folgen steigender Militärausgaben die These auf, dass das europäische BIP von 0,9 auf 1,5% wachsen könne, wenn die Ausgaben des Militärhaushalt nicht mehr 2%, sondern 3,5% des BIP betragen würden. Voraussetzung dafür wäre jedoch, eine Senkung der nicht-europäischen Waffenimporte und ein Fokus auf die Produktion europäischer Systeme.22
Die bürgerlichen Ökonomen sparen natürlich aus, dass Militarisierung zwar kurzweilig durch neue Investitionsmöglichkeiten die Wirtschaft stimulieren kann, langfristig jedoch Krisentendenzen eher noch verstärkt. Darüber hinaus bedeutet Aufrüstung eine Hemmung der Produktivkraftentwicklung für den gesellschaftlichen Fortschritt. Nicht zuletzt wird die Aufrüstung durch die verstärkte Ausbeutung der Arbeiterklasse und die Umverteilung des Nationaleinkommens finanziert. Wenn also von einem Gewinn für die deutsche Wirtschaft gesprochen wird, ist klar, wem dieser Gewinn zufließen wird und wem nicht.
Rohstoff- und Energiebeschaffung
Ein Bestandteil der Rüstungs- und Kriegswirtschaft ist auch die Umstellung der Rohstoff- und Energiebeschaffung. Ziel ist eine möglichst große Unabhängigkeit und Diversifizierung der Lieferanten. Als strategische Ausrichtung wurde in den letzten drei Jahren die Nationale Sicherheitsstrategie und eine überarbeitete Rohstoffstrategie formuliert. Der Fokus liegt auf dem Abbau von „einseitigen Abhängigkeiten“, die „zu sicherheitspolitischen Risiken“ führen können.23 Dabei werden auch die Unternehmen adressiert, die aus Profitinteressen einer Umgestaltung entgehenstehen könnten und auf das Gesamtinteresses der herrschenden Klasse orientiert: „In einer offenen Volkswirtschaft müssen staatliche und private Akteure sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen.“24
Was als Abbau der „einseitigen Abhängigkeit“ bezeichnet wird, ist das Vorhaben, weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf die Energie und Rohstoffe anderer Länder zu erhalten – im Sinne des Kriegskurses. Dies impliziert konkret die Stärkung der heimischen Rohstoffgewinnung, das Rohstoff-Recycling, den Ausbau von Rohstoffpartnerschaften, wie z. B. mit Chile und Peru25, Ghana und Länder Westafrikas sowie eine `Ressourceneffizienzstrategie`. Konkrete Erfolge verzeichnete der deutsche Imperialismus beispielsweise beim Lithium-Deal mit Serbien, der zu großen Massenprotesten vor Ort führte.26 Zudem wurden nach 25 Jahren Verhandlung die letzten Schritte im Mercosur-Abkommen mit verschiedenen lateinamerikanischen Staaten unternommen, welches u. a. den günstigen Import von Rohstoffen garantiert.27
Durch die Sanktionen gegen Russland haben sich auch Verschiebungen in der Energiezufuhr ergeben. Die westlichen Sanktionen hatten das Ziel, die russische Wirtschaft zu „ruinieren“ (Baerbock) und dadurch den Druck auf Russland zu erhöhen. Bisher hat sich dieser Effekt noch nicht eingestellt, da viele Staaten weiterhin russische Energielieferungen beziehen. Der deutsche Imperialismus, dessen Wettbewerbsvorteil u. a. auf billigem russischem Gas und Öl beruhte, hat auf neue Lieferanten orientiert und über Umwege (z. B. über Indien) weiterhin russische Energie bezogen.28 Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass der Widerstand der deutschen Monopole im Gegensatz zu mittelständischen und kleinen (oft in Ostdeutschland ansässigen) Unternehmen eher gering war. Die Monopole schienen sich, weitgehend dem Gesamtinteresse der herrschenden Klasse zu fügen, trotz erschwerter individueller Profitmöglichkeiten.
Gleichzeitig verfolgt ein Teil der herrschenden Klasse, insbesondere durch die Grünen verkörpert, die Strategie, durch die Umstellung auf erneuerbare Energien die Autarkie zu erhöhen. Dies wird unter den Begriffen „energiepolitische Zeitenwende“29 oder „grüne Kriegswirtschaft“ zusammengefasst. Andere Teilen der herrschenden Klasse, u. a. die AfD, lehnen diese Strategie ab und streben eine Wiederaufnahme der direkten russischen Energielieferungen an. Der Schaden für die deutsche Wirtschaft wird derzeit als zu groß eingeschätzt und soll daher behoben werden. Bei dieser Auseinandersetzung handelt es sich nicht um entgegengesetzte Positionen zur Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, sondern um die konkrete Ausgestaltung dieser. Es ist gut möglich, dass in den nächsten Jahren wieder russische Energielieferungen aufgenommen werden, insbesondere im Sinne einer kostengünstigen und effektiven Aufrüstung. Dafür sprechen auch jüngsten Aussagen prominenter CDU-Politiker, die eine teilweise Rückkehr zu russischen Gaslieferungen forderten.30
Staatseinstiege
Der Staat beschafft nicht nur Kriegskredite und Arbeitskräfte für die Rüstungsproduktion, sondern beteiligt sich teilweise auch selbst an Rüstungsunternehmen, um die wirtschaftliche Tätigkeit unmittelbar kontrollieren zu können. Beteiligungen an Airbus, MBDA Deutschland und Jenoptik bestehen bereits seit längerem und seit 2020 hält der deutsche Staat auch 25,1% Unternehmensanteile am Rüstungsunternehmen Hensoldt. Aktuell wird ein Einstieg bei ThyssenKrupp Marine Systems geprüft. Zukünftig sollen weitere Staatseinstiege, inbesondere in Unternehmen mit relevanten Schlüsseltechnologien, realisiert werden, um die Kontrolle zu sichern und die Produktion lenken zu können.31 In der Wirtschaftswoche wird dazu festgehalten: „Es gibt auch in Deutschland im Bereich Militär und Dual Use Spitzentechnologien, die besser nicht in die Hände ausländischer Unternehmen geraten, vor allem wenn es sich dabei um Firmen in Ländern handelt, die direkt oder indirekt Zugriff auf solche Technologien nehmen können.“32
Auch der Einstieg von Land und Bund in die Meyer-Werft in Papenburg mit 80% ist als Absicherung der Rüstungsproduktion zu verstehen: Keine andere Werft bietet so gute Möglichkeiten zum militärischen Flottenbau, wie ein vom Handelsblatt veröffentlichtes Dokument zeigt.33 Neben Staatseinstiegen wird auch anderweitig in die Produktion eingegriffen: So hat Rheinmetall beispielsweise auf politischen Druck hin die Geschossproduktion aus der Schweiz in die Lüneburger Heide verlagert, da sich die Schweiz gegen Waffenlieferungen in die Ukraine versperrte.34
Folgen, Gewerkschaften und Widerstand
Aufrüstung wird grundsätzlich durch die verstärkte Ausbeutung und Umverteilung des Nationaleinkommens finanziert. Die genannten Entwicklungen betreffen die Arbeiterklasse in Deutschland bereits unmittelbar: In vielen Konzernen wurden Entlassungen in großer Dimension beschlossen, gerade in der Metall-, Auto- und Zulieferbranche. Die Reallöhne sind in den letzten Jahren stark gesunken, während die Verbraucherpreise erheblich gestiegen sind. Sozialkürzungen stehen auf der Tagesordnung und werden mit der neuen Regierung weiter verschärft: Grundsicherung mit Arbeitszwang, Ausweitung der Sanktionen, mögliche Rentenkürzungen oder die Streichung des Elterngeldes sind im Gespräch. Außerdem wird über eine sogenannte Arbeitszeitflexibilisierung, also Arbeitszeitverlängerung und Einsatz je nach Bedarf der Unternehmen, nachgedacht. Die Einschränkung des Streikrechts ist schon lange in der Debatte, zuletzt machte der Verband Gesamtmetall den Vorstoß, Warnstreiks in Tarifverhandlungen gesetzlich zu verbieten.35
Die angekündigten Entlassungen im letzten Herbst führten zu Streiks und Protesten. Insgesamt ist der Widerstand gegen den Frontalangriff auf die Arbeiterklasse jedoch noch nicht wirklich ausgeprägt. „Lieber Rüstungsproduktion als arbeitslos“, äußert ein Arbeiter des neuen Rüstungsbetriebs in Görlitz und steht damit sicher nicht alleine da.36 Neben der materiellen Absicherung ist sicher auch die Entfremdung von der Arbeit ein Grund: Ob Panzerteile oder Autoteile, macht für viele keinen greifbaren Unterschied. Zudem fehlt Internationalismus und es besteht zu wenig Bewusstsein darüber, dass die Aufrüstung den Krieg nach Deutschland bringen wird. Hinzu kommt, dass dies im herrschenden Diskurs rein moralisch verhandelt wird: So kann man in der taz lesen: „Das Dilemma zwischen subjektiven Interessen und ethischem Anspruch wiederholt sich“.37Dabei steht die Rüstungsproduktion natürlich im klaren Widerspruch zum subjektiven Interesse eines jeden Arbeiters, nämlich den Kriegskurs zu verhindern – sowohl international als auch im eigenen Land.
Gewerkschaftsführung und Rüstungswirtschaft
Die Kräfte, die diesen Zusammenhang aufzeigen, sind in den Betrieben und Gewerkschaften in der Minderheit bzw. nicht an den entscheidenden Stellen vertreten. Die Gewerkschaftsspitzen stützen hingegen den Kriegskurs und integrieren Protest und Widerstand. Ein guter Beleg dafür ist das im Jahr 2024 veröffentlichte Positionspapier von IG Metall, SPD-Wirtschaftsforum und dem Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. In diesem Papier wird Planungssicherheit für die Rüstungsunternehmen gefordert, um deren Leistungsfähigkeit zu erhöhen sowie Arbeitsplatzabbau und Rückgang in der Rüstungsproduktion zu verhindern. Man wolle verhindern, dass sich Unternehmen „endgültig vom `Kunden Bundeswehr`“ abwenden.“38
Jürgen Kerner, zweiter Vorsitzender der IG Metall, schlägt ähnliche Töne an: „Zwar hebt die Politik ihre Bedeutung für die Sicherheit unseres Landes und Europas hervor. Aber anders als man denken könnte, führt das Sondervermögen Bundeswehr nicht automatisch zur Stärkung der heimischen Industrie. Sie droht vielmehr unter die Räder zu geraten, wenn mehr und mehr in Übersee gekauft wird und die Regierung keine Sorge trägt, dass Betriebe in Deutschland Wartung und Upgrades übernehmen. Wir brauchen endlich eine wehrtechnische Industriepolitik.“39 Auch in der IG BCE wird diese Entwicklung mitgetragen. In der Mitgliederzeitung `Profil` wird beispielsweise das Unternehmen Rheinmetall bejubelt, das „eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung der deutschen Streitkräfte und als Lieferant für die Ukraine“ spiele, bei dem es sich lohne „anzuheuern“.40
Ganz in diesem Sinne äußerte sich die DGB-Führung auch wohlwollend zum kürzlich beschlossenen 500-Milliarden-Euro-Aufrüstungspaket: DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi nannte es einen „Befreiungsschlag zur Modernisierung unseres Landes“ und betonte: „Insbesondere vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten müssen wir Europas Verteidigungsfähigkeit stärken und dürfen dabei gleichzeitig sozialen Fortschritt nicht ausbremsen.”41Auch der Vorsitzende der IG BAU Robert Feiger bejubelte das neue Aufrüstungspaket und sieht den zukünftig unbegrenzten Wehretat als „notwendig in diesen weltpolitisch instabilen Zeiten“ an: „Natürlich ändert sich die Lage hier in Europa dramatisch, sollten sich die USA tatsächlich künftig von uns abwenden. Da müssen wir die Sicherheit Europas selbst in die Hand nehmen. (…) Bei allem Augenmerk auf die Infrastruktur dürfen wir das normale Leben der Menschen nicht vergessen, für viele ist das hart genug. Deshalb Hände weg von Kürzungen bei Sozialleistungen.“42
Die Haltung der Gewerkschaftsführung ist klar: Aufrüstung ja, Sozialabbau nein. Unabhängig davon, dass Aufrüstung und Kriegsvorbereitung auch ohne Sozialabbau nicht im Interesse der Arbeiterklasse liegen, werden hier natürlich Illusionen geschürt. Der Sozialabbau zum Aufbau der Rüstungswirtschaft findet längst statt und wird sich weiter intensivieren. Aktuell betrifft er noch vorrangig die prekären Teile der Arbeiterklasse: Migranten, Bürgergeld-Empfänger, Niedriglohn-Beschäftigte und Rentner.
Widerstand an der Basis
Innerhalb der Gewerkschaften gibt es jedoch Aktive und Organisationszusammenhänge, die die Haltung und Rolle der Gewerkschaftsführungen angreifen. Anlässlich des aktuellen Aktionstages der IG Metall in mehreren Städten hat die Vernetzung Kämpferische Gewerkschaften (VKG) einen alternativen 11-Punkte-Plan entwickelt. Darin fordern sie unter anderem die Demokratisierung der gewerkschaftlichen Prozesse, einen Anti-Kriegskurs der Gewerkschaften und eine Arbeitszeitverkürzung: „Die kommende Generation der Kolleg*innen wird auf den Wehrdienst vorbereitet, mit der Illusion, Aufrüstung und Kriege würden Kriege verhindern oder man könnte heute noch „siegreich“ sein. In Gaza und Libanon sterben unsere Klassenschwestern und brüder durch Waffen, die auch Deutschland an die israelische Armee geliefert hat. Die arbeitende Klasse braucht eine „Staatsräson“, sondern die internationale Solidarität gegen Krieg und Unterdrückung.“43 Es ist gut, dass die VKG auch den Zusammenhang zum Völkermord in Gaza herstellt, was jedoch nicht erwähnt wird, ist die konkrete Kriegsvorbereitung Deutschlands gegen Russland. Dabei ist dies der Hauptstoß der deutschen Kriegs- und Aufrüstungspolitik.
Neben der VKG gibt es weitere gewerkschaftliche Initiativen, die sich dem Kriegskurs in Deutschland und der Mitwirkung der Gewerkschaftsführung, entgegenstellen wollen. Gewerkschaften gegen Aufrüstung plädieren beispielsweise für die Einhaltung der gewerkschaftlichen Grundsätze zur Abrüstung und haben eine Petition gestartet.44 Außerdem fand 2024 ein Online-Austauschtreffen statt, bei dem verschiedene Aktive von ihren Erfahrungen berichteten. Diese Berichte zeigten deutlich, dass es an der Basis teilweise rumort, wenn es um die Fragen Krieg und Aufrüstung geht. Leider hat sich dieser Austauschrahmen bisher noch nicht verstetigt. Zudem bleibt offen, was aus dem Vorhaben geworden ist, die DGB-Führung mit den Ergebnissen der Petition zu konfrontieren und so unter Druck zu setzen.
Auch die antimilitaristische Gewerkschaftsinitiative SAGT NEIN! Gewerkschafter:innen gegen Krieg, Militarismus und Burgfrieden versucht, gegen den Aufrüstungskurs und die Rolle der Gewerkschaftsführung vorzugehen. Ein Hintergrund für die Organisation war der DGB-Bundeskongress 2022, bei dem entgegen den gewerkschaftlichen Grundsätzen eine Zustimmung zu Waffenlieferungen und zur Aufrüstung beschlossen wurde.45 SAGT NEIN! hat ebenfalls eine Petition gestartet und auch darüber hinaus umfassende Informationen zur Rolle der deutschen Gewerkschaften bei Aufrüstung und Krieg seit dem Ersten Weltkrieg erarbeitet.46
Diese Organisationsansätze sind wichtig und sollten von möglichst vielen Gewerkschaftsmitgliedern unterstützt werden. Neben der Arbeit in den gewerkschaftlichen Gremien ist es auch entscheidend, diese Themen in die Betriebe zu übertragen, inbesondere in den Bereichen, die im Sinne des Kriegskurses umgestaltet werden. Besonderer Fokus sollte auf die konkrete Ausrichtung der deutschen Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, nämlich gegen Russland, gelegt werden. Es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Aggressionen von Deutschland und der NATO ausgehen und nicht von Russland oder China. Diese Verständigung erfordert Zeit und Geduld, ist jedoch unerlässlich. Wenn das politische Ziel der deutschen Aufrüstung, nämlich die Kriegsvorbereitung gegen Russland, nicht benannt wird, hinterlässt man eine offene Flanke für Spaltung und Integration in den herrschenden Kriegskurs. Denn die Aufrüstung und Kriegsvorbereitung in Deutschland wird maßgeblich durch das propagandistisch geschaffene Bedrohungsszenario Russland durchgesetzt.
Was heißt Kriegswirtschaft eigentlich?
„Wenn die Kapitalisten für die Landesverteidigung, d. h. für den Staat arbeiten, so ist dies (…) eine besondere Art der Volkswirtschaft. (…) Der für die Landesverteidigung „arbeitende“ Kapitalist aber „arbeitet“ nicht für den Markt, sondern auf Bestellung des Staates, in der Regel sogar mit dem Gelde, das er vom Staate vorgestreckt bekommt.“47 (Lenin)
Mit der Entwicklung der Produktivkräfte und der Entstehung des Kapitalismus, insbesondere in seinem imperialistischen Stadium, gewann die Wirtschaft an neuer Bedeutung für die Kriegsführung. Im Kampf um die Neuaufteilung der Welt nahm die Abhängigkeit der Kriegsführung von der Ökonomie zu, da neue Technologien und schnellere Produktionsweisen an immer größerer Bedeutung gewannen. Der Staat entwickelte sich in diesem Prozess zur entscheidenden Instanz. Er ordnet die Profitinteressen der einzelnen Teile der herrschenden Klasse dem Gesamtinteresse dieser unter. Die Rüstungsindustrie, also die Industrie, die ihre Profite überwiegend aus der Rüstungsproduktion erzielt, nimmt eine spezifische Rolle ein. Der Staat fungiert als alleiniger Auftraggeber und greift aktiv in die wirtschaftliche Tätigkeit ein, indem er Abnahmegarantien schafft, Exportkontrollen verhängt und die nötigen Kapitalbeträge für Forschung, Entwicklung und Beschaffung durch Umverteilung des Nationaleinkommens bereitstellt. Diese Tätigkeit erfolgt auf Grundlage der spezifischen politischen und ökonomischen Interessen. Die Vergabe von Aufträgen erfolgt normalerweise durch Absprachen zwischen Rüstungskonzernen und dem Staat und nicht über Konkurrenzvergabe. Krieg und dessen Vorbereitung bedeuten für die Rüstungsindustrie beste Absatzmöglichkeiten, weshalb sich die Rüstungsindustriellen zu den aggressivsten Vertretern der Bourgeoisie entwickelt haben. Die Förderung der Rüstungsindustrie ist jedoch nur ein Bestandteil von Kriegswirtschaft. Das Handbuch Wirtschaftsgeschichte definiert Kriegswirtschaft folgendermaßen: „Als Kriegswirtschaft kann man die Gesamtheit aller Maßnahmen zur ökonomischen Sicherstellung der Kriegsführung und die durch diese Maßnahmen oder durch die Ergebnisse der Kriegsführung selbst hervorgerufenen Veränderungen in der Struktur der Volkswirtschaft bezeichnen. Im Imperialismus sind diese Maßnahmen auf Unterordnung der Wirtschaft unter die Bedürfnisse der Kriegsführung durch ökonomische und außerökonomischen Zwang gerichtet. Die imperialistische Kriegswirtschaft ist daher durch staatliche Zwang- und Lenkungsmaßnahmen auf allen Gebieten der kapitalistischen Wirtschaft gekennzeichnet, die das Ziel haben, die Wirkung objektiver Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise zu modifizieren oder einzuschränken.“48 Während bei Kriegswirtschaft bereits ein Kriegsfall vorliegt, beschreibt Rüstungswirtschaft den ökonomischen Prozess der Kriegsvorbereitung. Diese beide Phasen umfassen folgende Entwicklungen:
- die Steigerung der nationalen Rüstungsindustrie und die Senkung ausländischer Rüstungsimporte
- Ausbau von internationalen Rüstungskooperationen zum Ausbau der eigenen Einflusssphäre
- der Ausbau der physischen und digitalen Infrastruktur im Sinne der Kriegsführung
- die Diversifizierung von Energie- und Rohstoffimporten bis hin zu einer möglichst großen Autarkie
- massive staatliche Finanzierungsmaßnahmen, durch Kredite, erhöhte Steuern und eine verstärkte Umverteilung
- verstärkte staatliche Eingriffe, um die Entwicklung im gesamtstaatlichen Interesse abzusichern, z. B. durch Verstaatlichungen von Unternehmen
- Mobilisierung von Arbeitskraft für die Rüstungsindustrie durch den Staat, z. B. durch Verlagerung von Arbeitskräften oder Zwangsarbeit
- Verteilungsmechanismen von Rohstoffen oder anderen Gütern im Sinne der Rüstungsindustrie
- Produktion nach Plan, d. h. Priorisierung von Rüstungsgütern vor Gebrauchsgütern
Kurzer Blick in die Geschichte
Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg
Hintergrund der deutschen Vorbereitung des Ersten Weltkrieges war die verspätete Entwicklung des deutschen Kapitalismus. Die Aufteilung der Welt unter den Großmächten war weitestgehend abgeschlossen, und der Widerspruch zwischen der schnellen kapitalistischen Entwicklung und der ökonomischen Macht des deutschen Imperialismus im Gegensatz zu seinem Einflussgebiet bedingte seine Expansionsbestrebungen. Um 1900 wurde daher die Rüstungsindustrie in einem groß angelegten Programm angekurbelt, so nahm beispielsweise die Flotten- und Heeresrüstung um 133 % zu.49 Der sogenannte militärisch-industrielle Komplex (MIK), also die enge Vernetzung von Monopolen, Staatsstrukturen und militärischen Führungskreisen bildete sich heraus. Mit Kriegsbeginn zeigten sich verschiedene ökonomische Probleme, wie der Mangel an kriegsnotwendigen Rohstoffen. Als Reaktion darauf wurde die Kriegsrohstoffabteilung gegründet, die die Aufgabe der Erfassung, Verteilung und Kontrolle der kriegswichtigen Rohstoffe erhielt. Außerdem wurde der Kriegsausschuss der deutschen Industrie mit Beteiligung der führenden deutschen Monopole gegründet. Die Verflechtung von Staat und Monopolen wurde enger, während die Insolvenzen kleinerer und mittlerer Betriebe zunahmen. Die Produktion wurde zunehmend auf Kriegsbedürfnisse ausgerichtet und das Staatseigentum an Produktionsmitteln wuchs. Der Staat organisierte den Einsatz von Zwangsarbeitern in Rüstungsbetrieben, schränkte die Arbeiterrechte massiv ein und unterdrückte die revolutionären Kräfte rigoros. Dagegen wurden jedoch mutige Kämpfe geführt, wie Streiks und Sabotageaktionen, Aktionen gegen den Hungerwinter und schließlich die Kämpfe der Novemberrevolution.
Kriegswirtschaft im Faschismus
Mit der Novemberrevolution wurde der Krieg beendet, der Kaiser verjagt und einige demokratische Grundrechte erkämpft. Die Herren Krupp und Stinnes richteten sich mit der SPD-Führung in der Tasche im neuen Staat ein. Dieser Staat konnte für sie nur eine Übergangslösung hin zum nächsten Krieg werden und so dauerte es nicht lange, bis der deutsche Imperialismus den revanchistischen Angriff plante. Entscheidend dafür war auch die Strategie der USA, Deutschland als Speerspitze gegen die Sowjetunion wieder aufzubauen. US-Kapital wurde für den Wiederaufbau genutzt, Reparationszahlungen durch die westlichen Staaten gesenkt, um Deutschland im Sinne eigener Pläne nicht zu stark zu schwächen. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 griff der deutsche Staat immer stärker in die Wirtschaft ein, um die Lasten der Krise von den Monopolen abzuwenden und auf die Arbeiterklasse abzuwälzen. Mithilfe großer Kredite wurde die Wirtschaft, insbesondere die Rüstungsbranche, gefördert. Der Faschismus entwickelte sich allmählich für das deutsche Kapital zur politisch effektivsten und zuverlässigsten Kraft, um einen neuen Eroberungskrieg vorzubereiten. Der Faschismus bekämpfte die immer stärker werdende Arbeiterbewegung sowie Kommunistische Partei, die bereits früh erkannt hatte, dass „Hitler Krieg bedeutet“, mit Terror und Unterdrückung.
Wie bereits zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurde mit dem Generalrat der deutschen Wirtschaft eine Vereinigung aller wichtigen Monopole und des Staates geschlossen. Die Namen sind fast dieselben wie heute: Siemens, Bosch, Rheinmetall-Borsig und Thyssen. Die Monopolvertreter wurden 1937 zu Wehrwirtschaftsführern ernannt und hatten die Aufgabe, den Krieg ökonomisch vorzubereiten. Die Kriegswirtschaft wurde in unvorstellbarem Ausmaß und mit großer Geschwindigkeit realisiert: Aufrüstung, Konzentration von Produktion und Kapital durch Pflichtvereinigungen, Autarkiebestrebungen, Zwangsinvestitionen und der Aufbau staatlicher Rohstoffreserven. Besonders betont werden muss die enorme Mobilisierung von Zwangsarbeit als kostenlose Arbeitskraft in den Fabriken und Konzentrationslagern. 1939 hielt der Chef des Wehrwirtschaftsstabes, Thomas, fest: „Die Geschichte kennt wenige Fälle, in denen ein Land in Friedenszeiten all seine wirtschaftlichen Kräfte bewußt und systematisch auf die Kriegserfordernisse abgestellt hat, wie es Deutschland tat.“50
Wie bereits erwähnt, kennzeichnet der Widerspruch zwischen der ökonomischen Macht und dem vergleichsweise geringen Territorium den deutschen Imperialismus. Er ist aufgrund seines hohen Exportanteils auf außenwirtschaftliche Expansionsbestrebungen angewiesen und griff dabei stets auf eine starke staatliche Rolle zurück. Zudem war Deutschlands Rolle maßgeblich durch seine Funktion als Speerspitze gegen den Sozialismus in Form der Sowjetunion bestimmt. Hauptverbündeter dabei waren die USA, deren Bündnis die Möglichkeit der revanchistischen Politik erst ermöglichten. Auch wenn die Sowjetunion heute nicht mehr existiert, hat sich an der Funktion des deutschen Imperialismus als europäischer NATO-Pfeiler gegen Russland nicht viel verändert. Revanchismus und Anti-Kommunismus sind in Deutschland Staatsdoktrin, und die Träger dieser sind dieselben Klassenkräfte wie die Träger der zwei Weltkriege. Die politische Taktik zur Erreichung der Ziele war in der Geschichte durchaus umstritten und ist es bis heute. Sie reichte vom offenen Revanchismus mit Krieg bis hin zur Zersetzung durch ökonomische Einflussnahme („Wandel durch Annäherung“).
1 Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie Hans Christoph Atzpodien hat in der Welt die Parole „Autos zu Rüstung“ geäußert: https://www.imi-online.de/2025/03/08/autos-zu-ruestung/
2 Conny Renkl und Stephan Müller, Übergang zur Kriegswirtschaft?: https://www.unsere-zeit.de/uebergang-zur-kriegswirtschaft-4800209/
3 Institut für Weltwirtschaft Kiel. Kriegstüchtig in Jahrzehnten: Europas und Deutschlands langsame Aufrüstung gegenüber Russland. 2024, S. 9. https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/kriegstuechtig-in-jahrzehnten-europas-und-deutschlands-langsame-aufruestung-gegenueber-russland-33235/
4 https://www.bmvg.de/resource/blob/5865332/d4d0d9ab55edde72a11cee2a3ca59d3b/nationale-sicherheits-und-verteidigungsindustriestrategie-data.pdf
5 MBDA ist ein deutsches Rüstungsunternehmen mit Sitz in Schrobenhaus, das u. a. Luftwaffen-System entwickelt, produziert und wartet.
6 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/rheinmetall-wir-produzieren-mehr-munition-als-die-amerikaner-04/100103934.html
7 https://www.bmvg.de/resource/blob/5865332/d4d0d9ab55edde72a11cee2a3ca59d3b/nationale-sicherheits-und-verteidigungsindustriestrategie-data.pdf
8 IfW-Bericht, S. 19.
9 https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19103778-rheinmetall-aktie-analysten-optimistisch-rekordhoch-geschaeftszahlen
10 IfW-Bericht, S. 19.
11 https://www.dw.com/de/eu-krisengipfel-macht-weg-frei-f%C3%BCr-eine-wiederaufr%C3%BCstung/a-71854100
12 IfW-Bericht, S. 7 + 49.
13 Nationale Sicherheitsstrategie S. 31.
14 https://www.unsere-zeit.de/uebergang-zur-kriegswirtschaft-4800209/
15 IfW-Bericht, S. 10.
16 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/finanzpaket-bis-zu-17-billionen-euro-schuldenspielraum-wird-noch-groesser/100114078.html
17 https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-vw-ruestung-blume-militaer-fabriken-100.html
18 https://kaz-online.de/artikel/kurzer-abriss-der-anfaenge-und-geschichte-von-volk
19 https://www.swr.de/swr1/kriselnde-automobilzulieferer-orientieren-sich-neu-richtung-ruestungs-und-luftfahrtindustrie-arbeitsplatz-2025-03-01-100.html
20 https://www.wiwo.de/politik/deutschland/schuldenplaene-ruestungsfirmen-scharf-auf-beschaeftigte-der-autoindustrie/30240510.html
21 https://www.ey.com/de_de/newsroom/2025/02/ey-studie-verteidigungsinvestitionen
22 https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/fis-import/78d4d746-2284-4431-bd95-4c4ef055e042-Kiel_Report_Nr2_DE_FINAL-27-2.pdf
23 Nationale Sicherheitsstrategie S.13 https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/Sicherheitsstrategie-DE.pdf
24 S. 53 (Nationale Sicherheitsstrategie)
25 https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9149
26 https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9643
27 https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9790
28 https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9345
29 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/energiepolitik-zeitenwende-2020106
30 https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/aussenpolitik/id_100644878/gas-aus-russland-cdu-politiker-ziehen-lieferungen-wieder-in-erwaegung.html
31 https://www.sueddeutsche.de/politik/ruestung-industrie-waffenproduktion-staatseinstieg-lux.KkRaTcgQogbGo4j2sUPjqd
32 https://www.wiwo.de/politik/deutschland/verteidigung-in-der-ruestungsindustrie-versagt-die-ordnungspolitik/29939226.html
33 https://www.jungewelt.de/artikel/490560.meyer-werft-einstieg-mit-r%C3%BCstungsoption.html
34 https://www.imi-online.de/2024/03/13/weg-in-die-kriegswirtschaft/
35 https://www.deutschlandfunk.de/vorstoss-von-gesamtmetall-streiks-sollen-per-gesetz-verringert-werden-100.html
36 https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL21vcmdlbm1hZ2F6aW4vMzNmNmYwYTctZjIyOS00ZmVmLTg3M2EtOTAzZWVlYjg4ZDFh
37 https://taz.de/Gewerkschaften-und-Ruestungsindustrie/!6045570/
38 https://www.igmetall.de/download/20240130_Positionspapier_Sicherheits_und_Verteidigungsindustrie.pdf
39 https://www.igmetall.de/presse/pressemitteilungen/verteidigungsindustrie-zukunftsfaehig-machen
40 https://taz.de/Gewerkschaften-und-Ruestungsindustrie/!6045570/
41 https://www.dgb.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/dgb-chefin-fahimi-befreiungsschlag-fuer-wirtschaft-und-beschaeftigte/
42 https://igbau.de/IG-BAU-begrueszt-CDU-SPD-Sondervermoegen-fuer-Infrastruktur.html
43 https://vernetzung.org/wp-content/uploads/2025/03/VKG_Faltblatt_4-Seiten.pdf
44 https://gewerkschaften-gegen-aufruestung.de/
45 https://bundeskongress.dgb.de/antraege
46 https://storage.e.jimdo.com/file/b71a6c1b-0cab-4530-a8b7-e8e3794f30ad/Mappe-Ausstellung-Gesamt.pdf
47 W. I. Lenin, Den Sozialismus einführen oder aufdecken, wie die Staatskasse geplündert wird?, In: Werke, Bd. 25, S. 57 f.
48 Handbuch Wirtschaftsgeschichte, Hrsg. vom Institut für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1981, Band 2.
49 Der Imperialismus der BRD, Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Dietz Verlag Berlin 1971, S. 17.
50 Imperialismus der BRD, 1971. S. 54.