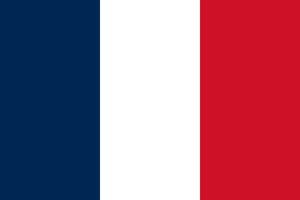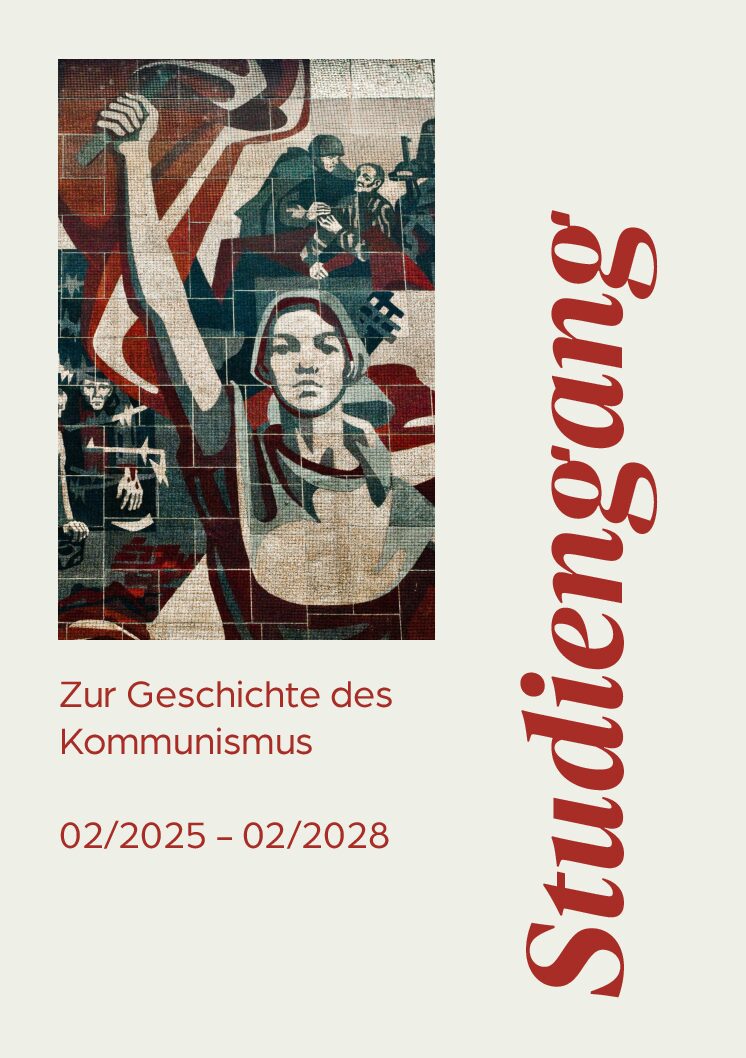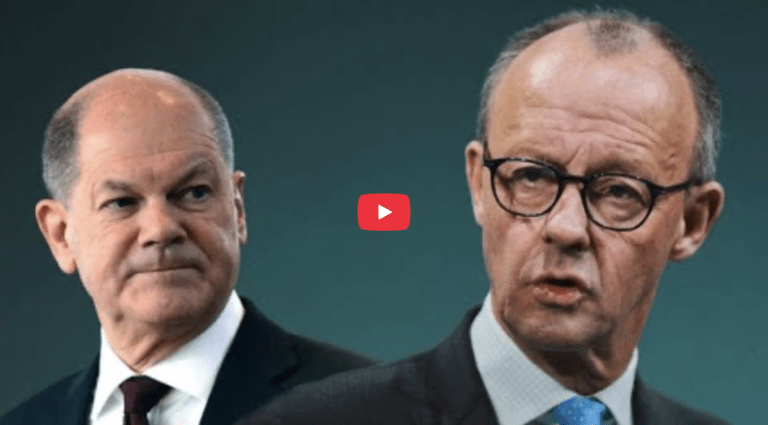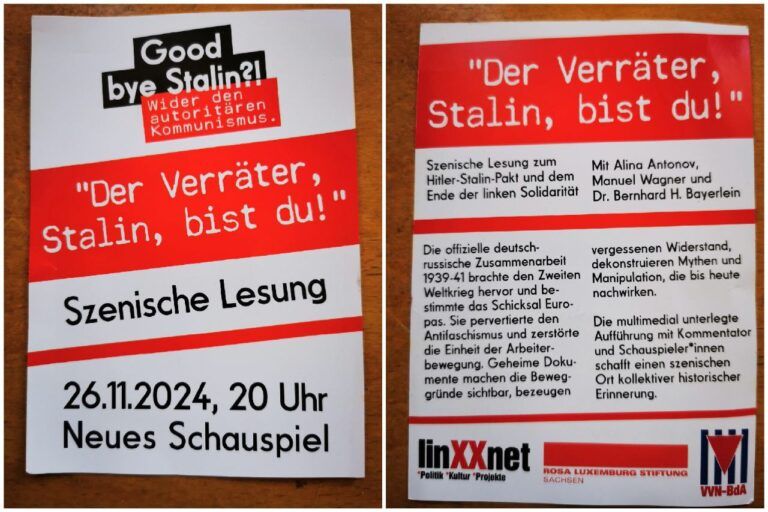Beitrag von Paul Oswald
Der folgenden Artikel setzt sich mit Teilen des Quellenmaterials von Lenins Imperialismus-Broschüre auseinander. Anhand eines vergleichenden Blicks zwischen Lenins Broschüre und vorangegangenen theoretischen Auseinandersetzungen innerhalb der Arbeiterbewegung sowie der bürgerlichen Wissenschaft wird das Alleinstellungsmerkmal von Lenins Untersuchung herausgearbeitet. Durch diesen Vergleich wird insbesondere Lenins Entwicklung des Begriffs des Imperialismus aufgezeigt, wodurch ein Zugang zur Imperialismus-Broschüre eröffnet wird, der in der gängigen Lenin-Rezeption unterrepräsentiert ist.
Bei Beiträgen handelt es sich nicht zwangsläufig um Positionen der Kommunistischen Organisation.
Hinweis für den Leser
Der Hauptteil dieser Arbeit konzentriert sich auf einen Quellenvergleich verschiedener Werke des 20. Jahrhunderts zum Thema Imperialismus, wobei der Schwerpunkt auf dem zweiten Kapitel liegt. Dieses Kapitel ist zentral für die Argumentation des Textes. Für Leser, die sich inhaltlich für die Argumente interessieren, denen das zweite Kapitel jedoch zu umfangreich erscheint, besteht die Möglichkeit, nur die Einleitung, das erste und dritte Kapitel sowie die Schlussbemerkungen zu lesen. Um die wesentlichen Punkte des zweiten Kapitels zu erfassen, genügen bereits die Kurzzusammenfassungen, die am Ende jedes Unterkapitels eingefügt wurden.
Für Leser, die einen umfassenden Überblick über die Imperialismus-Diskussion des 20. Jahrhunderts gewinnen möchten und insbesondere an den Theorien führender Vertreter der Arbeiterbewegung interessiert sind, wird jedoch empfohlen, das gesamte zweite Kapitel eingehend zu lesen.
Einleitung
Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine entfachte sich die schon lange bestehende Diskussion über das Verständnis von Imperialismus neu. Schnell wurden Lenin-Zitate in Stellung gebracht, Schützengräben bezogen und mit sorgfältig gesammelten Zitaten geschossen – alles, um die vermeintlich richtige Position im Ukraine-Krieg zu behaupten. Doch nach dieser kurzen Phase intensiver Auseinandersetzungen ist es wieder relativ ruhig geworden, zumindest in Deutschland. Die grundlegenden Fragen und Kontroversen bestehen jedoch nach wie vor.
Es scheint paradox, dass eine so kurze Broschüre von Lenin, mit dem Ziel die „grundlegenden ökonomischen Besonderheiten des Imperialismus in aller Kürze und in möglichst gemeinverständlicher Form darzustellen“ (Lenin 1917, S. 200), in diametral entgegengesetzten Weisen ausgelegt wird. Wie ist es möglich, dass etwas vermeintlich „gemeinverständliches“ zu sich gegenseitig ausschließenden Auslegungen führt?
Lenins Anliegen mit seiner Broschüre war keine konkrete empirische Arbeit. Konkrete empirische Auseinandersetzungen waren allerdings für Lenins Arbeit eine notwendige Voraussetzung. Was auf den ersten Blick wie eine banale Beobachtung scheint, bedeutet allerdings einen gewissen Umgang mit Lenins Broschüre. Dieser kann nicht dazu führen, seine Broschüre als eine einfache Antwort auf aktuelle Fragen zu sehen. Vielmehr ist er eine Momentaufnahme einer Bewegung – spiegelt diese also wider – und es geht darum an diese Bewegung anzuknüpfen.
Die Kernthese des folgenden Textes lautet, dass Lenin mit seiner Imperialismus-Broschüre eine Begriffsentwicklung und -bestimmung des Imperialismus vornimmt. Darin liegen die Besonderheit und die Leistung seiner Arbeit, im Unterschied zu vorhergegangenen Arbeiten über den Imperialismus. In einem Großteil von Rezeptionen über Lenins Imperialismus-Broschüre ist diese Perspektive, die Lenin einnahm, nicht klar. Dies führt dazu, dass viele Missverständnisse in Bezug auf Lenins Verständnis von Imperialismus bestehen, was eine aktuelle und auf ihn aufbauende Untersuchung erschwert. Ausgehend von dieser Annahme soll der folgende Text einen ersten groben Überblick über das durch Lenin verwendetes Quellenmaterial geben. Dazu werden verschiedene theoretische und empirische Auseinandersetzungen mit dem Imperialismus vorgestellt, die vor Lenins Imperialismus-Broschüre erschienen sind. Lenins Text wird anschließend im Kontrast zu diesen Quellen betrachtet.
Die hier in Ansätzen begonnene Arbeit halte ich aus mindestens drei Gründen für relevant: erstens gelangt man durch die Beschäftigung mit den historischen Quellen, die Lenins Imperialismus-Broschüre zugrunde liegen, zu einem besseren Verständnis von seiner Arbeitsweise. Es wird greifbarer, wie Lenin zu seinen Erkenntnissen gekommen ist, aber auch worin die Besonderheit und Bedeutung seiner Arbeit liegt. Zweitens werden dadurch die Aufgaben klarer, vor denen wir stehen, wenn wir den Imperialismus heute analysieren und verstehen wollen. Es verdeutlicht, wo wir als Kommunistische Bewegung mit unserem Arbeitsstand stehen und welche Aufgaben wir noch zu lösen haben. Gleichzeitig macht es aber diese Aufgaben auch greifbarer/nahbarer, da deutlich wird, dass es keine unüberwindbaren Hürden sind. Beides zusammengenommen sorgt schließlich drittens dafür, Lenin nicht messianisch zu behandeln. In dem Sinne, dass einzelne Zitate Lenins so genutzt werden, als könnten sie uns im hier und jetzt eine klare politische Orientierung in unseren Kämpfen geben. So, als bräuchte es keine Anstrengungen mehr, weil Lenin vor über 100 Jahren bereits alles gesagt habe. Es geht also darum, nicht in religiöse Dogmen zu verfallen, sondern den Kommunismus als eine Wissenschaft zu verstehen, die (wie jede Wissenschaft) mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Der Text verfolgt somit ein durchaus praktisches Anliegen: eine größere Sensibilisierung für die eigene Geschichte, die Geschichte der Arbeiterbewegung, ihre Kämpfe (sowohl politisch als auch ideologisch), verbunden mit einer tiefer gehenden Auseinandersetzung mit der Gegenwart.
Verwendetes Material
Für die Erstellung seiner Broschüre untersuchte und verallgemeinerte Lenin eine große Menge an historischem Material, zu verschiedenen Fragen der Ökonomie und Politik des Imperialismus. In seinen Heften zum Imperialismus sind Auszüge und Notizen von 148 Büchern und 232 Artikeln aus 49 verschiedenen periodischen Schriften (Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 1972, S. VII f.). Aus den Heften ist Lenins Arbeitsprozess bis zur Imperialismusschrift nachvollziehbar. Angefangen bei einem ersten Entwurf, einer groben Aufzählung der Probleme und schließlich einem ausführlichen Forschungsprogramm und einem detaillierten Aufbau des Buches, inklusive einer Inhaltsangabe für jedes Kapitel (Lenin 1972, S. 96f; S.85f.; S.219-233).
Durch seine Hefte zum Imperialismus wird deutlich, welchen Stellenwert bürgerliche Ökonomen und ihre empirischen Auseinandersetzungen mit der Ökonomie einzelner Länder, den ökonomischen Problemen und Fragen, die sich durch diese Arbeiten ergaben, für Lenins Untersuchung hatten. In Empiriokritizismus und historischer Materialismus machte Lenin eine Bemerkung über den Umgang mit bürgerlichen Wissenschaftlern, der sich in seinen Vorarbeiten zu der Imperialismus-Broschüre deutlich wiederfindet. Im Empiriokritizismus ist zu lesen:
„Im großen und ganzen sind die Professoren der politischen Ökonomie nichts anderes als die gelehrten Kommis der Kapitalistenklasse und die Philosophieprofessoren die gelehrten Kommis der Theologen.
Die Aufgabe der Marxisten ist nun hier wie dort, zu verstehen, sich die von diesen „Kommis“ gemachten Errungenschaften anzueignen und sie zu verarbeiten (man kann zum Beispiel, wenn man die neuen ökonomischen Erscheinungen studieren will, keinen Schritt tun, ohne sich der Werke dieser Kommis zu bedienen), und zu verstehen, die reaktionäre Tendenz derselben zu verwerfen, der eigenen Linie zu folgen und die ganze Linie der uns feindlichen Kräfte und Klassen zu bekämpfen (Lenin 1909, S. 347).“
In den Heften zum Imperialismus zeigt sich diese Herangehensweise. In seinen Notizen arbeitet er die reaktionären Tendenzen der bürgerlichen Ideologie und reformistische Ansichten heraus. Gleichzeitig analysiert er das Material sehr aufmerksam, was sich u.a. an der Länge seiner Konspekte zeigt sowie an der Verwendung von Statistiken, Berichten usw. für seine Broschüre – hierzu im Artikel mehr.
Für die Erstellung dieses Artikels wurden zahlreiche Schriften herangezogen, die Lenin explizit für seine Imperialismus-Broschüre verarbeitete. Mit Luxemburg wurde aber auch eine Arbeit berücksichtigt, die vermutlich für Lenins Broschüre nicht von Bedeutung war, da sie nicht in seinen Konspekten vorkommen, aber für heutige Diskussionen eine Rolle spielt (vgl. Harvey 2005; Patnaik/Patnaik 2023). Chronologisch betrachtet wurden folgende Primärtexte untersucht:
- Karl Marx (1894): Dritter Band des Kapitals sowie Friedrich Engels (1895): Nachträge zum III. Buch
- John A. Hobson (1902): Der Imperialismus
- Otto Jeidels (1905): Das Verhältnis der deutschen Großbanken zur Industrie
- Rudolf Hilferding (1910): Das Finanzkapital
- Rosa Luxemburg (1913): Die Akkumulation des Kapitals
- Karl Kautsky (1914): Der Imperialismus
- Karl Kautsky (1915): Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund
- Nikolai Bucharin (1915): Imperialismus und Weltwirtschaft
Mit Marx und Engels, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, Nikolai Bucharin und Lenin werden die Zugänge von Theoretikern der Arbeiterklasse präsentiert. Neben Marx, Engels und Lenin wurden diese vier Autoren gewählt, weil sie wichtige Repräsentanten, Vertreter und Theoretiker der Arbeiterbewegung jener Zeit waren. Anhand ihrer Arbeiten wird der Stand der Auseinandersetzung mit dem Imperialismus durch die Arbeiterbewegung erkennbar. Es wird auch deutlicher, worauf Lenin aufbauen konnte und worin sein Beitrag für die Arbeiterbewegung liegt.
Mit John A. Hobson und Otto Jeidels finden sich zwei bürgerliche Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts in dieser Untersuchung wieder, mit denen sich Lenin auseinandersetzte. Durch Lenins Konspekte geht hervor, dass für seine Analyse bürgerliche Arbeiten eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Anhand Hobson und Jeidels kann dies beispielhaft aufgezeigt werden.
Es ist natürlich klar, dass die hier berücksichtigte Primärliteratur nicht in Ansätzen all das präsentieren kann, worauf sich Lenin in seiner Arbeit stützte. Dennoch geht bereits aus dieser kleineren Textauswahl deutlich hervor, von wem Lenin gewisse Annahmen übernahm, aber auch worin er sich von anderen unterschied.
Von Lenin selbst wurde neben der 1916 verfassten und 1917 veröffentlichten Imperialismusschrift und seinen Heften zum Imperialismus eine Reihe an Artikeln aus den Jahren 1915 und 1916 verarbeitet. Die verwendete Sekundärliteratur beschränkt sich auf zwei unterschiedliche philosophische Wörterbücher und eine philosophische Studie von Fritz Kumpf über die Probleme der Dialektik in Lenins Imperialismus-Analyse. Der Fokus dieses Textes wird auf der Untersuchung von Primärtexten liegen. Dies soll einen Zugang schaffen, um sich in einer späteren Auseinandersetzung der Rezeptionsgeschichte von Lenins Imperialismus-Broschüre zuwenden zu können.
Anhand des Vergleichs der Erscheinungsdaten sowie der jeweiligen Inhalte der unterschiedlichen Quellentexte fällt auf, wie kurz der Zeitraum der Herausbildung des Imperialismus war und wie zeitgleich diese Veränderungen untersucht wurden (wenn auch teilweise fehlerhaft). Zwischen der Veröffentlichung von Marx drittem Band des Kapitals, in der schon von Monopolen und der enormen Konzentration im Bankwesen die Rede ist, und Hobsons Schrift, in der (wie der Titel bereits anzeigt) durchweg vom Imperialismus gesprochen wird, liegen gerade einmal acht Jahre. Die zeitliche Abfolge der Schriften verläuft recht schnell und endet mit Lenins Untersuchung. Zwischen Marx als Ausgangspunkt und Lenins Imperialismusschrift liegen 20 Jahre. Zwar erkannten die verschiedenen, hier berücksichtigten Autoren, dass der Kapitalismus in eine neue Phase eingetreten war. Lenins besondere Leistung bestand jedoch darin, auf Grundlage ihrer Arbeiten eine umfassende Analyse dieser Phase in ihrer Gesamtheit zu liefern, anstatt sich auf einzelne Aspekte zu beschränken. Seine Analyse dieser neuen Phase mündet darin, aufzuzeigen, wie der Imperialismus durch die Zuspitzung seiner inneren antagonistischen Widersprüche zu einer höheren Gesellschaftsformation übergeht – dem Sozialismus.
Aufbau des Textes
Der Text ist wie folgt gegliedert: das erste Kapitel wird sich kurz mit der Frage beschäftigen, was ein Begriff ist. Anschließend werden die verschiedenen Ziel- und Problemstellungen der untersuchten Primärliteratur verglichen. Am Schluss des ersten Kapitels erfolgt ein Vergleich der unterschiedlichen Imperialismusdefinitionen, die sich aus den Texten ergeben.
Das zweite Kapitel ist das eigentliche Herzstück dieser Arbeit. Ausgehend von Lenins Argumentationsgang in seiner Imperialismusschrift wird dargestellt, was die verschiedenen Autoren zu den einzelnen Aspekten geschrieben haben, um im Anschluss einen Vergleich mit Lenins Imperialismus-Broschüre (aber auch früheren Texten) vorzunehmen. Dies soll es ermöglichen aufzuzeigen, dass Lenin nicht bei null startete und auf vieles zurückgreifen konnte. Es soll auch zeigen, dass zu der damaligen Zeit sehr viele Inhalte gesetzt waren (durch welche Lenins Broschüre wirklich „allgemeinverständlich“ wurde). Andererseits soll durch diese Gegenüberstellungen auch verdeutlicht werden, worin die Besonderheit von Lenins Arbeit liegt und dass seine Verallgemeinerungen nur möglich waren, weil er sich im Vorhinein so intensiv mit den verschiedenen Materialien auseinandersetzte. Für jedes Unterkapitel in diesem Abschnitt wurde eine kurze Zusammenfassung geschrieben. Leser, denen das zweite Kapitel insgesamt zu umfangreich ist, können auch nur die kurzen Zusammenfassungen lesen, um dem Argumentationsgang des Textes zu folgen.
Im dritten Kapitel wird im Anschluss versucht, den Stellenwert von Lenins Schrift zusammenzufassen, aber auch über Aufgaben zu sprechen, die sich daraus für heute ergeben.
Für die Erstellung dieses Textes wurde entschieden, sehr ausführlich auf Zitate aus den verschiedenen Schriften zurückzugreifen. An der ein oder anderen Stelle mag dies für den Lesefluss etwas störend sein. Die Zitate werden so umfänglich präsentiert, um an dem exakten Wortlaut der Texte nichts zu verändern, da in (sowohl mündlichen als auch schriftlichen) Diskussionen sehr häufig auffällt, wie sehr Primärtexte zum Gegenstand von Interpretationen und Auslegungen werden und wie durch ein geschicktes Weglassen von Aussagen der komplette Inhalt eines Buches verzerrt bzw. entstellt wird.
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick gegeben werden, was im philosophischen Sinn unter Begriffen zu verstehen ist. Anschließend geht das Kapitel auf die verwendete Primärliteratur ein, vergleicht die Ausgangsfragestellungen und beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen des Imperialismus.
Die allgemeine Beschreibung von Begriffen kann an dieser Stelle lediglich oberflächlich bleiben, da dies weder ein Artikel über Diskussionen rund um die Erkenntnistheorie noch der dialektischen Logik ist.
Im Philosophischen Wörterbuch führen Georg Klaus und Manfred Buhr (1975) aus, dass Begriffe die gedankliche Fixierung von Invarianzen (d.h. konstanten bzw. unveränderliche Größen) darstellen. Demnach erfassen Begriffe das, was bei dem Übergang von einem Element einer Klasse zu einem anderen Element invariant/konstant bleibt und in diesem Sinne wesentlich für den Gegenstand ist (Klaus/Buhr 1975, S. 207). Für die Definition eines Begriffs ist die Grenze aufzuspüren, die den erfassten Gegenstand von ähnlichen Gegenständen unterscheidet. Dafür genügt es, auf die unterscheidenden wesentlichen Merkmale hinzuweisen, die der Begriff widerspiegelt (Kondakow 1978, S. 82).
Begriffe sind nicht gleichzusetzen mit einer Definition, also einem kurzen Verweis auf nur wesentliche Merkmale des betrachteten Objekts, die der Begriff widerspiegelt (ebd., S. 74). In Engels Vorarbeiten zum „Anti-Dühring“ findet sich eine Passage, in der angemerkt wird:
„Definitionen sind für die Wissenschaft wertlos, weil stets unzulänglich. Die einzig reelle Definition ist die Entwicklung der Sache selbst, und diese ist aber keine Definition mehr. Um zu wissen und zu zeigen, was das Leben ist, müssen wir alle Formen des Lebens untersuchen und im Zusammenhang darstellen. Dagegen kann für den Handgebrauch eine kurze Darlegung der allgemeinsten und zugleich bezeichnendsten Charaktere in einer sog. Definition oft nützlich und sogar notwendig sein, und kann auch nicht schaden, wenn man von ihr nicht mehr verlangt, als sie eben aussprechen kann (Engels 1975, S. 578).“
Definitionen können für die Begriffsbestimmung notwendig sein, um die Grenzen, in denen er Gültigkeit besitzt, zu bestimmen und damit eine Unterscheidung von anderen Begriffen vorzunehmen. Gleichzeitig kann nicht gesagt werden, dass der Begriff mit dem gesamten Wissen über das Forschungsobjekt gleichgesetzt werden kann. Der Fokus liegt auf den Unterscheidungsmerkmalen des Objekts. Damit steht die Widerspiegelung von wesentlichen Merkmalen im Mittelpunkt (Kondakow 1978, S. 74f.). Der Begriff erscheint nicht plötzlich in einer fertigen und endgültigen Form. Lenin merkt an verschiedenen Stellen seiner Arbeiten den Gedanken an, dass ein Begriff von einem Gegenstand oder einer Erscheinung das Ergebnis von einer langen klärenden Arbeit ist. 1899 stellt Lenin in seinem Artikel Die rückläufige Richtung in der russischen Sozialdemokratie die Frage, woher die Arbeiterklasse „den allerdeutlichsten Begriff von der Selbstherrschaft“ nehmen soll? Lenin antwortet auf die von ihm gestellte Frage:
„Es ist offenkundig, daß hierfür die umfassendste und systematischste Propaganda der Ideen der politischen Freiheit überhaupt notwendig ist, eine Agitation notwendig ist, die mit jeder einzelnen Erscheinungsform polizeilicher Gewalttaten und bürokratischer Unterdrückung eine „deutliche Vorstellung“ (in den Köpfen der Arbeiter) von der Selbstherrschaft verbindet (Lenin 1899, S. 257).“
Die Entwicklung eines Begriffs ist nichts Abgeschlossenes, sondern Begriffe sind stets in Veränderung, was zu einer immer genaueren Widerspiegelung von dem ihm entsprechenden Objekt führt. Dabei ist die Begriffsentwicklung vor allem von der Entwicklung der widergespiegelten Objekte selbst und durch den Erkenntnisfortschritt des Menschen bedingt (Klaus/Buhr 1975, S. 209). Durch die Entwicklung der Produktion und der Wissenschaft werden die Kenntnisse der Menschen immer mannigfaltiger. Durch diesen Fortschritt werden in den Gegenständen und Erscheinungen immer neue Merkmale entdeckt. Dies führt zu einer Präzisierung, Vertiefung und Vervollkommnung von den Begriffen der widergespiegelten Gegenstände (Kondakow 1978, S. 76).
Fritz Kumpf (1968) führt aus, dass ein wesentliches Moment des Begriffs der innere Zusammenhang der analysierten Eigenschaften ist. Die wissenschaftliche Begriffsbildung ist keine einfache Zusammenfassung von empirischen Erfahrungen. Es ist nach Kumpf nur innerhalb der formalen Logik möglich, den Inhalt eines Begriffs auf die Gesamtheit der Eigenschaften und Relationen zu reduzieren, die durch ihn gesetzt werden (Kumpf 1968, S. 54). Die dialektische Logik hat es mit der Widerspiegelung der objektiven Realität als einem Prozess zu tun, einer Reihe von Abstraktionen, Formierungen und der Bildung von Begriffen und Gesetzen (ebd., S. 31). Kumpf definiert den wissenschaftlichen Begriff wie folgt:
„Ein wissenschaftlicher Begriff, der im Wesen einer Erscheinung das Allgemeine erfaßt, schließt damit das Besondere mit in sich ein. In einem solchen Begriff müssen das Allgemeine und das Besondere also vermittelt sein. Fehlt diese Vermittlung, dann handelt es sich um eine Allgemeinheit, die nur ex tensional gegeben ist. Es handelt sich um eine abstrakte Allgemeinheit, während ein Begriff, in dem diese Vermittlung gegeben ist, sich durch das Konkret-Allgemeine auszeichnet. […] Der wissenschaftliche Begriff ist also ein konkret-allgemeiner Begriff. Der wissenschaftliche Begriff erfaßt eine bestimmte Struktur des Gegenstandes in der Weise, daß in ihm ein bestimmtes Verhältnis zwischen dem Wesen des betreffenden Gegenstandes und der Erscheinung des Wesens aufgedeckt wird (ebd., S.61).“
Wenn wir also von Begriffen (in unserem Fall dem Begriff des Imperialismus) sprechen, dann ist damit nicht einfach eine Sammlung empirischer Befunde gemeint. Auch geht es nicht nur um Definitionen, obwohl diese eine zentrale Rolle in der Begriffsbildung spielen, wie sich in Lenins Imperialismusschrift zeigt. Der Begriff dient vielmehr als Vermittlungsprozess zwischen den wesentlichen Aspekten einer Erscheinung (die in einer Definition enthalten sind) und der Erscheinung selbst. Ein Begriff ist nichts Starres oder Abgeschlossenes, sondern befindet sich in Bewegung und Veränderung. Auf diese Dynamik wird im dritten Kapitel eingegangen.
Zentrale Unterschiede in den Analysen des Imperialismus im 20. Jahrhundert werden bereits deutlich, wenn deren unterschiedlichen Problemstellungen, wie auch ihre Zielstellungen verglichen werden. Dies soll an dieser Stelle beispielhaft durch den Vergleich von Luxemburgs Schrift Die Akkumulation des Kapitals und Lenins Imperialismus-Broschüre geschehen.
Im Zentrum von Luxemburgs Untersuchung steht die Frage, wie die Reproduktion bzw. erweiterte Reproduktion (Akkumulation) des Kapitals unter den planlosen Bedingungen des Marktes möglich ist. Damit die Reproduktion reibungslos vonstattengeht, muss das Kapital eine bestimmte Anzahl von Produktionsmitteln, Arbeitskräften und Absatzgebieten vorfinden, die seiner Akkumulation entsprechen (Luxemburg 1913, S. 24). Dabei bezieht sich Luxemburg nicht auf den Reproduktionsprozess einzelner kapitalistischer Länder, sondern auf den Weltmarkt (ebd., S. 106). Ausgehend von dieser Problemstellung bemängelt Luxemburg das von Marx im Zweiten Band des Kapitals entworfene Reproduktionsmodell. Sie stellt die Frage, wie die durch die Akkumulation entstehende größere Wertmasse, die auf den Markt gebracht wird, realisiert werden kann und woher die Käufer für die zusätzlichen Werte kommen sollen. Nach Luxemburg gibt Marx‘ Reproduktionsschema auf diese Frage keine Antwort (ebd., S. 114). In einer Zusammenfassung des ersten Abschnittes ihrer Arbeit schreibt Luxemburg:
„Nimmt man das Schema wörtlich so, wie es im zweiten Bande am Schluß entwickelt ist, dann erweckt es den Anschein, als ob die kapitalistische Produktion ausschließlich selbst ihren gesamten Mehrwert realisierte und den kapitalisierten Mehrwert für die eigenen Bedürfnisse verwendete. Dies bestätigt Marx durch seine Analyse des Schemas, in der er den wiederholten Versuch macht, die Zirkulation dieses Schemas lediglich mit Geldmitteln, d. h. mit der Nachfrage der Kapitalisten und der Arbeiter zu bestreiten, ein Versuch, der ihn schließlich dazu führt, den Goldproduzenten als Deus ex machina in die Reproduktion einzuführen (Luxemburg 1913, S. 279).“
Wir werden sehen, wie diese Problemstellung für Luxemburgs Imperialismusverständnis wegweisend ist. Fritz Kumpf merkt an, dass sich bereits aus Luxemburgs Fragestellung ergibt, dass es sich bei ihrer Arbeit um eine konkrete historische Untersuchung des Imperialismus handelt. Die fehlende Abstraktheit in Luxemburgs Analyse führt in ihrer Grundstruktur zu einer gewissen Gemeinsamkeit mit der Bestimmung des Imperialismus durch Kautsky – beide trennen die politische Sphäre von der ökonomischen Grundlage (Kumpf 1968, S. 100).
Lenin legt mit seiner Broschüre einen vollkommen anderen Fokus. Im Vorwort heißt es:
„Im folgenden wollen wir versuchen, den Zusammenhang und das Wechselverhältnis der grundlegenden ökonomischen Besonderheiten des Imperialismus in aller Kürze und in möglichst gemeinverständlicher Form darzustellen. Auf die nichtökonomische Seite der Frage werden wir nicht so eingehen könne […] (Lenin 1917, S. 200).“
Ein paar Seiten vorher formuliert Lenin, dass die Hauptaufgabe seines Werkes darin bestehe, auf der Grundlage von Daten bürgerlicher Statistiker und Untersuchungen verschiedener Länder aufzuzeigen, wie am Vorabend des Ersten Weltkriegs, „das Gesamtbild der kapitalistischen Weltwirtschaft in ihren internationalen Wechselbeziehungen war (ebd., S. 193).“ Lenin macht hier einerseits auf sein genutztes Material aufmerksam, steckt einen zeitlichen Horizont für seine Untersuchung ab (die Weltwirtschaft vor dem Ersten Weltkrieg) und beschreibt andrerseits sein Ziel in einer allgemeinverständlichen Darstellung der Wechselverhältnisse der ökonomischen Besonderheiten des Imperialismus.
1.3 Imperialismus-Definitionen
Es soll nun auf die unterschiedlichen Definitionen des Imperialismus eingegangen werden, die in den verschiedenen Werken zu finden sind. Definitionen sind nicht gleichbedeutend mit Begriffen, wie in Kapitel 1.1 gezeigt wurde. Definitionen konzentrieren sich auf die wesentlichen Eigenschaften eines Gegenstandes, während sich Begriffe durch eine Vermittlung zwischen dem Wesen und der Erscheinung eines Gegenstandes auszeichnen. Dadurch werden wissenschaftliche Begriffe zu konkret-allgemeinen Begriffen.
Im Anschluss an die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Definitionen von Imperialismus wird Lenins Begriffsentwicklung im Einzelnen betrachtet und im Kontrast zu den Werken der anderen Autoren analysiert.
Für den folgenden Vergleich ist der historische Kontext der damaligen Debatte relevant. Viele theoretische Diskussionen befassten sich Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Begriff des Imperialismus, weil in dieser Zeit die Bestrebungen der konkurrierenden imperialistischen Großmächte wie England, Frankreich und Deutschland nach territorialer Erweiterung ihrer Herrschaftsgebiete im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzungen standen. Dies galt insbesondere für die deutsche Sozialdemokratie. Die Bestrebungen zur Ausdehnung von Herrschaftsgebieten sind ein zentraler Aspekt, den man im Hinterkopf behalten sollte, wenn die unterschiedlichen Charakterisierungen des Imperialismus als spezifische Form der Politik bewertet werden – von denen sich Lenin bewusst abgrenzt.
Nicht in allen hier berücksichtigten Analysen wird der Versuch unternommen, den Imperialismus zu definieren. Zwar werden in allen Büchern einzelne Elemente des Imperialismus genauer untersucht, wie im zweiten Abschnitt gezeigt wird, was aber nicht überall dazu führt, dass daraus eine Definition resultiert. Bspw. findet sich in Hilferdings Finanzkapital neben der Untersuchung des Finanzkapitals, u.a. einiges über die Entstehung der Monopole, den Kapitalexport, aber auch der neuen Rolle des Staates. Der Imperialismus selbst wird von ihm nur an einer Stelle in einem Nebensatz als „die Wirtschaftspolitik des Finanzkapitals“ bestimmt (Hilferding 1910, S. 556).
1.3.1 John A. Hobson
In seiner Schrift Der Imperialismus aus dem Jahr 1902 bestimmt John A. Hobson den Imperialismus vor allem in Abgrenzung zum antiken Imperialismus. Gleich zu Beginn seiner Untersuchung schreibt Hobson davon, dass das Neue „am jüngeren Imperialismus, als Politik betrachtet“ darin bestünde, dass ihn sich mehre Nationen zu ihrer Sache gemacht hätten. Modern sei der Begriff „einer ganzen Anzahl miteinander rivalisierender Imperien“, denn in der Antike und im Mittelalter war die Schaffung eines Reichs die Grundidee, also ein Zusammenschluss von Staaten unter einer Oberherrschaft – wie die Pax Romana (Hobson 1902, S. 35). Neben der Pluralität von Imperien nimmt Hobson an späteren Stellen seiner Untersuchung weitere Unterscheidungen von den historischen Frühformen des Imperialismus vor. Einen weiteren Unterschied sieht Hobson in der imperialen Expansion. In ihrer Frühform zielte diese „weniger auf dauernde Besetzung und Beherrschung fremder Länder“ ab und zielte mehr auf die Gefangenschaft möglichst vieler Sklaven. So gründeten die Griechen und Römer „keine permanenten Siedlungen unter den von ihnen besiegten Barbaren“ und konzentrierten sich zumeist darauf, so viel militärische und administrative Kontrolle auszuüben wie nötig, um ihre Ordnung und „die Entrichtung des Tributs“ zu sichern (ebd., S. 217).
Weitere Unterschiede beschreibt Hobson im „Element des politischen Tributs“, welches heute vollständig fehle oder eine Nebensache geworden sei und mit den „gröbsten Formen der Sklaverei“ verschwunden ist. Hobson beschreibt weitere Unterschiede im „Element des politischen Tributs“, das heute vollständig fehle oder nur noch eine Nebensache sei und mit den „gröbsten Formen der Sklaverei“ verschwunden sei. Die neuen („edleren und uneigennützigeren“) Regierungsformen „mildern und maskieren die entschieden parasitäre Natur“ der neuen Spielart des Imperialismus (ebd., S. 306).
Die Ursachen für den Imperialismus, der als eine bestimmte Politik aufgefasst wird, sieht Hobson einerseits in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt sowie den Waren- und Kapitalexport. So sei für England der Imperialismus „unnötig“ gewesen, solange sie bei den wichtigsten industriellen Gütern auf dem Weltmarkt „praktisch ein Monopol“ besaßen. Diese Überlegenheit Englands wurde in den letzten dreißig Jahren stark eingeschränkt – namentlich durch Deutschland, die USA und Belgien. Auch wenn dies nicht für einen Rückgang des Außenhandels führte, sorgte die Konkurrenz dafür, dass es schwieriger wurde „die ganze Überproduktion unserer Fabriken mit Gewinn abzusetzen“. Die Entwicklung dieser Länder und ihr Vordringen in die alten Märkte und sogar Kolonien Englands, mache es dringend notwendig:
„daß wir energische Maßnahmen ergreifen, um uns neue Absatzgebiete zu sichern. […] Die Diplomatie und die Waffen Großbritanniens müssen eingesetzt werden, um die Besitzer der neuen Absatzgebiete zu zwingen, mit uns in Geschäftsverkehr zu treten. Die Erfahrung lehrt außerdem, daß das sicherste Mittel zur Beschaffung und Erschließung derartiger Märkte die Errichtung von ›Protektoraten‹ oder die Annexion ist (ebd., S. 86).“
Hobson bestimmt an dieser Stelle also den Imperialismus als eine spezifische Politik des Expansionismus, die auf der Grundlage der entstehenden Konkurrenz auf dem Weltmarkt entsteht.
An anderer Stelle führt Hobson aus, dass die wirtschaftliche Wurzel des Imperialismus der Wunsch „stark organisierter industrieller und finanzieller Interessen“ ist, auf öffentliche Kosten und mithilfe der staatlichen Macht, private Märkte für den Waren- und Kapitalüberschuss zu erschließen. Dafür sind „Krieg, Militarismus und eine »eine mutige Außenpolitik« […] die erforderlichen Mittel zu diesem Zweck.“ Diese „imperialistische Politik“ bedarf eine massive Zunahme der staatlichen Ausgaben, was eine bestimmte Besteuerung notwendig macht. In diesem Kontext führt Hobson u.a. den Schutzzoll an (ebd., S. 112).
Am Ende seines Buches fasst Hobson „die ökonomische Hauptquelle“ des Imperialismus zusammen:
„Die ökonomische Hauptquelle des Imperialismus haben wir in der Ungleichheit der wirtschaftlichen Möglichkeit gefunden, wodurch eine begünstigte Klasse überschüssige Einkommenselemente ansammelt, die auf der Suche nach gewinnbringender Anlage immer weiter in die Ferne drängen. Der Einfluß dieser Investoren und ihrer finanziellen Manager auf die Staatspolitik schafft ein nationales Bündnis mit Vertretern anderer festverwurzelter Interessen, die sich von sozialen Reformbewegungen bedroht sehen. Die Politik des Imperialismus dient so dem doppelten Zweck, begünstigten Kreisen von Investoren und Händlern auf öffentlichen Kosten ansehnliche Privatgewinne zu verschaffen und zugleich die allgemeine Sache des Konservatismus zu fördern, indem Volksenergien und -interessen von den Zuständen nachdraußen abgelenkt werden (ebd., S. 302).“
Hobson charakterisiert den Imperialismus als eine bestimmte (expansionistische) Politik. Diese imperialistische Politik dient dazu, die Gewinne der Kapitalisten zu fördern und den Konservatismus auszubreiten. Durch seine Bestimmung des Imperialismus als eine Form der Politik zeigt sich eine Ähnlichkeit zu anderen Analysen, während ein entscheidender Unterschied zu Lenin sichtbar wird.
1.3.2 Rosa Luxemburg
Wie bereits erwähnt, ergibt sich die Bestimmung des Imperialismus durch Rosa Luxemburg in ihrer 1913 erschienen Schrift Die Akkumulation des Kapitals durch ihre Untersuchung des Reproduktionsprozesses. Sie bestimmt den Imperialismus als den „politischen Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nichtkapitalistischen Weltmilieus (Luxemburg 1913, S. 391).“ Dieser verbleibende Rest des „nichtkapitalistischen Weltmilieus“ erscheint gegenüber der Entwicklung der Produktivkräfte als ein „geringer Rest“. Dies sorge dafür, dass die Konkurrenz der kapitalistischen Länder um die nichtkapitalistischen Gebiete immer heftiger werde, was dazu führe, dass:
„der Imperialismus an Energie und an Gewalttätigkeit zu[nimmt], sowohl in seinem aggressiven Vorgehen gegen die nichtkapitalistische Welt wie in der Verschärfung der Gegensätze zwischen den konkurrierenden kapitalistischen Ländern (ebd., S. 391).“
Nichtkapitalistische Gebiete bzw. vorkapitalistische Produktionsweisen stellen für Luxemburg eine Notwendigkeit für die Akkumulation dar. Die Kapitalakkumulation könne nicht „ohne die nichtkapitalistische Formation existieren“, ebenso wie diese nicht „neben ihr zu existieren vermögen“. Die Kapitalakkumulation sei nur im „fortschreitenden Zerbröckeln“ des nichtkapitalistischen Gebiets möglich. Luxemburg beschreibt die Unmöglichkeit der Akkumulation mit der Unmöglichkeit der „weiteren Entfaltung der Produktivkräfte“, was gleichbedeutend mit der „objektive[n] geschichtlich[en] Notwendigkeit des Untergangs des Kapitalismus“ sei, woraus sich die „widerspruchsvolle Bewegung letzten, imperialistischen Phase als Schlußperiode in der geschichtlichen Laufbahn des Kapitalismus“ ergebe (ebd., S. 364). Die nichtkapitalistischen Gebiete seien nach Luxemburg deshalb notwendig, da das Kapital „im Lande keine Möglichkeit zu akkumulieren [hatte], da kein Bedarf nach zuschüssigem Produkt vorhanden war.“ Hingegen sei im Ausland, wo noch keine kapitalistische Produktion entwickelt ist, „eine neue Nachfrage in nichtkapitalistischen Schichten entstanden, oder sie wird gewaltsam geschaffen (ebd., S. 373).“
Auch von Luxemburg wird der Imperialismus als eine bestimmte Art der Politik definiert. Ausgehend von der Annahme, dass kapitalistische Akkumulation ohne ein nichtkapitalistisches Weltmilieu unmöglich sei, ist der Imperialismus für Luxemburg gleichbedeutend mit einer Situation, in welcher der „Kapitalakkumulation de[r] Boden unter den Füßen“ weggezogen wird. Die kapitalistische Ausdehnung, raubt dem Kapitalismus seine eigene Grundlage. Diese Schlussphase des Kapitalismus werde zu „einer Periode der Katastrophen“ (ebd., S. 392).
1.3.3 Karl Kautsky
In seinem 1914 erschienenem Artikel Der Imperialismus charakterisiert Kautsky den Imperialismus als Produkt des hochentwickelten Kapitalismus. Der Imperialismus bestehe „in dem Drang jeder Nation, sich ein immer größeres agrarisches Gebiet zu unterwerfen und anzugliedern“ (Kautsky 1915, S. 14f.). An späterer Stelle beschreibt Kautsky den Imperialismus als „das Streben jedes kapitalistischen Großstaates nach Ausdehnung des eigenen Kolonialreiches“ (ebd., S. 13).
In seinem Artikel Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund aus dem Jahr 1915 wiederholt Kautsky den Drang zur Ausdehnung von Nationen. Interessant ist, dass an dieser Stelle etwas genauer begründet wird, wozu jener ökonomisch dient:
„Die auffallendste unter diesen Methoden ist die der kolonialen Expansion. Sie hat der ganzen Richtung der vom Finanzkapital beherrschten Staatspolitik den Ramen [Sic] gegeben. Nach ihr wird es Imperialismus genannt, das Streben, ein großes Imperium, Weltreich zu begründen, dessen agrarische Teile ausgedehnt genug sind, die überschüssigen Kapitalien des Mutterlandes aufzunehmen und in seinen Interessen anzuwenden (Kautsky 1915, S. 24).“
Der Imperialismus ist nach Kautsky also eine bestimmte Politik der Ausdehnung mit dem Ziel des Absatzes von überschüssigem Kapital. An dieser Stelle zeigt sich eine gewisse Parallele zu Rosa Luxemburg, aber auch Hobson.
Das Zitat von Kautsky beschreibt weiter, dass die imperialistische Ausdehnung „als die einzige, heute noch mögliche betrachtet [wird], [um] die kapitalistische Produktionsweise weiterzuentwickeln (ebd., S. 24).“ Wenige Seiten vorher wird dies von Kautsky explizit abgelehnt, wenn er davon spricht:
„Er ist nicht nur nicht notwendig für das kapitalistische Wirtschaftsleben, seine Bedeutung dafür wird vielfach maßlos überschätzt (ebd., S. 22).“
Auf dieses Argument wird genauer eingegangen werden, wenn es um den Ultraimperialismus gehen soll. Auffällig ist an dieser Stelle wieder, dass der Imperialismus auch von Kautsky als eine bestimmte Politik (der Ausdehnung) aufgefasst wird. Ein Unterschied zu Hobson und Luxemburg besteht in Kautsky These, dass für diese Art der Politik keine Notwendigkeit bestünde. Interessant ist, dass sowohl Luxemburg als auch Kautsky explizit die Bedeutung eines nichtkapitalistischen Äußeren für das Kapital anführen.
1.3.4 Nikolai Bucharin
In Imperialismus und Weltwirtschaft kritisiert Bucharin 1915, dass man sich nicht damit zufriedengeben kann, den Imperialismus lediglich durch seine Erscheinungsformen wie die „Eroberungspolitik“ oder „Expansionspolitik“ zu charakterisieren. Vielmehr sei eine Analyse der ökonomischen Basis erforderlich, auf deren Grundlage diese Politik entsteht. Bucharin definiert den Imperialismus wie folgt:
„Wir haben den Imperialismus als die Politik des Finanzkapitals definiert. Dadurch wird auch ihre funktionelle Bedeutung aufgedeckt. Sie ist der Träger der finanzkapitalistischen Struktur, sie unterwirft die Welt der Herrschaft des Finanzkapitals; sie setzt an die Stelle der alten vorkapitalistischen oder alten kapitalistischen Produktionsverhältnisse die Produktionsverhältnisse des Finanzkapitalismus. Ebenso wie der Finanzkapitalismus (den man nicht mit dem einfachen Geldkapital verwechseln darf, denn für das Finanzkapital ist kennzeichnend, daß es gleichzeitig sowohl Bank- als auch Industriekapital ist) eine geschichtlich umgrenzte Epoche ist, die nur für die letzten Jahrzehnte charakteristisch ist, ebenso ist auch der Imperialismus als die Politik des Finanzkapitalismus eine spezifisch historische Kategorie (Bucharin 1915, S. 126).“
Auch wenn die Ausdehnungspolitik von Bucharin durch das Finanzkapital spezifiziert wird, definiert auch er den Imperialismus erneut als eine bestimmte Politik – eben die des Finanzkapitals. Bucharin definiert den Imperialismus somit ähnlich wie Hilferding, der diesen, wie bereits erwähnt, als „die Wirtschaftspolitik des Finanzkapitals“ darstellt (Hilferding 1910, S. 556). An dieser Stelle sei bereits auf Lenins Vorwort zu Bucharins Schrift verwiesen, in dem Lenin die Bedeutung von Bucharins Werk hervorhebt:
„Die wissenschaftliche Bedeutung der Arbeit N. I. Bucharins liegt besonders darin, daß er die Grundtatsachen der Weltwirtschaft betrachtet die den Imperialismus als Ganzes, als eine bestimmte Entwicklungsstufe des höchstentwickelten Kapitalismus betreffen (Lenin 1915b, S. 102).“
Lenin führt die „Grundtatsachen“ als Ganzes an und spricht von einer bestimmten Entwicklungsstufe. Durch ihn wird dies im Unterschied zu einer spezifischen Politik hervorgehoben.
1.3.5 Waldimir Iljitsch Lenin
Die kurze Ausführung über Lenins Definition des Imperialismus wird sich nicht auf seine Imperialismus-Broschüre von 1917 beschränken, sondern auch frühere Schriften einbeziehen. An dieser Stelle soll es erst einmal um Unterschiede in der allgemeinen Charakterisierung gehen, bevor im zweiten Schritt Lenins Analyse genauer untersucht wird.
Zu Beginn sei eine kurze Passage aus Lenins Broschüre Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den „imperialistischen Ökonomismus“ von 1916 erwähnt, in der Lenin schreibt:
„Den Gebrauch des „Wortes“ Imperialismus in diesem oder jenem Sinne zu verbieten ist unmöglich. Aber es ist notwendig, die Begriffe genau zu klären, wenn man diskutieren will (Lenin 1916b, S. 34).“
Diese Passage wird kurz angeführt, um die Ebene zu verdeutlichen, auf der Lenin sich mit dem Imperialismus auseinandersetzt. Die zentrale These dieses Artikels ist, dass es Lenin um eine Begriffsdefinition geht, im Unterschied zu vorangegangenen Arbeiten, die im Wesentlichen konkrete Analysen einzelner Elemente des Imperialismus darstellen. Bucharins Arbeit stellt vor diesem Hintergrund eine gewisse Ausnahme dar.
In seinem Artikel Sozialismus und Krieg aus dem Jahr 1915 bestimmt Lenin den Imperialismus als „die Epoche der fortschreitenden Unterdrückung der Nationen der ganzen Welt durch eine Handvoll „Groß“mächte“ (Lenin 1915a, S. 318). In der Broschüre Karikatur auf den Marxismus verteidigt Lenin den Begriff der Epoche vor einer Vulgarisierung und schreibt:
„Eine Epoche heißt deshalb Epoche, weil sie eine Gesamtheit verschiedenartiger Erscheinungen und Kriege umfaßt – sowohl typische als auch nicht typische, große wie kleine, solche, die fortgeschrittenen, und andere, die rückständigen Ländern eigen sind (Lenin 1916b, S. 28).“
In besagter Schrift von 1916 definiert Lenin den Imperialismus sowohl ökonomisch als auch politisch. Lenin führt aus, dass der Imperialismus ökonomisch betrachtet, oder als „Epoche“ des Finanzkapitals“, die höchste Entwicklungsstufe des Kapitalismus darstellt. Diese zeichnet sich durch eine Großproduktion aus, durch welche „die freie Konkurrenz vom Monopol abgelöst wird“. Darin sieht Lenin das „ökonomische Wesen“ des Imperialismus. Interessant ist, dass Lenin anschließend zum Monopol schreibt, dass es:
„seinen Ausdruck sowohl in den Trusts, Syndikaten usw. als auch in der Allmacht der Riesenbanken, sowohl im Aufkauf der Rohstoffquellen usw. als auch in der Konzentration des Bankkapitals usw. [hat.] Das ökonomische Monopol – das ist der Kern der ganzen Sache (ebd., S. 34).“
Lenin führt hier bereits verschiedene Aspekte des Monopols an – die Industriemonopole, die Konzentration der Banken, die Monopolbanken usw. Dies deutet darauf hin, dass es Lenin nicht um das einzelne (z. B. Industrie-)Monopol geht, sondern um ein sich entwickelndes gesellschaftliches Verhältnis bzw. die „Epoche“ des Finanzkapitals.
Eine Seite später geht Lenin auf die ökonomische Tendenz des Monopols ein und beschreibt, dass es die Konkurrenten vom inneren und äußeren Markt vertreiben muss, um zu einem „vollen Monopol“ zu werden. Er wirft anschließend die Frage auf, ob es „in der Ära des Finanzkapital“ ökonomisch die Möglichkeit gibt, die Konkurrenz in einem fremden Staat zu verdrängen und antwortet: „Natürlich: Dieses Mittel ist die finanzielle Abhängigkeit und der Aufkauf der Rohstoffquellen und dann auch aller Unternehmen des Konkurrenten (ebd., S. 35).“
Politisch definiert Lenin den Imperialismus in Anlehnung an Hilferding. Der Imperialismus ist nach Lenin die „Wendung von der Demokratie zur politischen Reaktion“. Er führt anschließend ein Zitat aus Hilferdings Finanzkapital an: „Das Finanzkapital will nicht Freiheit, sondern Herrschaft“ (Lenin 1916b, S. 34; Hilferding 1910, S. 502).
Der Epochencharakter, der für Lenins Definition zentral ist, wird noch deutlicher in seiner Imperialismus-Broschüre. Dort heißt es u.a.:
„Würde eine möglichst kurze Definition des Imperialismus verlangt, so müßte man sagen, daß der Impeialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus ist. Eine solche Definition enthielte die Hauptsache, denn auf der einen Seite ist das Finanzkapital das Bankkapital einiger weniger monopolistischer Großbanken, das mit dem Kapital monopolistischer Industriellenverbände verschmolzen ist, und auf der anderen Seite ist die Aufteilung der Welt der Übergang von einer Kolonialpolitik, die sich ungehindert auf noch von keiner kapitalistischen Macht eroberte Gebiete ausdehnt, zu einer Kolonialpolitik der monopolistischen Beherrschung des Territoriums der restlos aufgeteilten Erde (Lenin 1917, S. 270).“
An dieser Stelle springt ins Auge, dass Lenin seine Definition des Imperialismus auf das monopolistische Stadium des Kapitalismus reduziert. Er führt sogleich aus, was er unter diesem Stadium versteht: das Finanzkapital, die Aufteilung der Welt und eine Kolonialpolitik der monopolistischen Beherrschung.
An anderer Stelle seiner Broschüre schreibt Lenin:
„Der Kapitalismus ist zu einem Weltsystem kolonialer Unterdrückung und finanzieller Erdrosselung der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung der Erde durch eine Handvoll „fortgeschrittener“ Länder geworden (ebd., S. 195).“
Lenin stellt fest, dass kurze Definitionen zwar praktisch sind, da sie die zentralen Aspekte zusammenfassen, jedoch unzureichend werden, sobald es darum geht, die wesentlichen Merkmale der zu definierenden Erscheinung daraus abzuleiten. Aus diesem Grund kann eine Definition, so Lenin, „nur bedingte und relative Bedeutung haben“, da sie niemals „die allseitigen Zusammenhänge einer Erscheinung in ihrer vollen Entfaltung umfassen kann“. Anschließend definiert Lenin den Imperialismus mit den allseits bekannten fünf Merkmalen: (1) die Konzentration und die Entstehung der Monopole; (2) die Verschmelzung von Bank und Industrie sowie die Entstehung einer Finanzoligarchie; (3) die zunehmende Bedeutung des Kapitalexports; (4) die Bildung von internationalen Kapitalverbänden, die die Welt unter sich aufteilen und (5) die Beendigung der territorialen Aufteilung (ebd., S. 270f.).
Lenin geht es in seiner Definition nicht um die Beschreibung einzelner Länder, sondern um die Wechselbeziehungen der Weltwirtschaft – in der Epoche des Finanzkapitals. Dies wird durch einen Vergleich mit der 1916 erschienen Schrift Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus deutlich. Sein Artikel beginnt mit der Bemerkung, dass mit einer „möglichst genauen und vollständigen Definition des Imperialismus“ begonnen werden muss und führt aus:
„Der Imperialismus ist ein besonderes historisches Stadium des Kapitalismus. Diese Besonderheit ist eine dreifache: der Imperialismus ist: 1. Monopolistischer Kapitalismus; 2. Parasitärer und faulender Kapitalismus; 3. sterbender Kapitalismus (Lenin 1916c, S. 102).“
Im Anschluss beschreibt Lenin das Monopol wieder als das „Wesen des Imperialismus“. Wichtig ist die daran anschließende Ausführung, in der Lenin das Monopol bzw. den Monopolismus definiert. Der Leser sollte dabei die eben angeführten fünf Merkmale Lenins im Hinterkopf behalten:
„Der Monopolismus tritt in fünf Hauptformen zutage: 1. Kartelle, Syndikate und Trusts,- die Konzentration der Produktion hat eine solche Stufe erreicht, daß sie diese monopolistischen Kapitalistenverbände hervorgebracht hat; 2. die Monopolstellung der Großbanken: drei bis fünf Riesenbanken beherrschen das ganze Wirtschaftsleben Amerikas, Frankreichs, Deutschlands; 3. die Besitzergreifung der Rohstoffquellen durch die Trusts und die Finanzoligarchie (Finanzkapital ist das mit dem Bankkapital verschmolzene monopolistische Industriekapital); 4. die (ökonomische) Aufteilung der Welt durch internationale Kartelle hat begonnen. […] Der Kapitalexport, als besonders charakteristische Erscheinung zum Unterschied vom Warenexport im nichtmonopolistischen Kapitalismus, steht in engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und der politisch- territorialen Aufteilung der Welt; 5. die territoriale Aufteilung der Welt (Kolonien) ist abgeschlossen (ebd., S. 102f.).“
Der Vergleich der fünf Kriterien in Lenins Imperialismus-Broschüre mit dieser Ausführung ist interessant. Den Monopolismus, welchen Lenin „als Kern der ganzen Sache“ (Lenin 1916b, S. 28) oder als „Wesen des Imperialismus“ (Lenin 1916c, S. 102) anführt, wird hier in den unterschiedlichen Formen definiert. In Lenins Heften zum Imperialismus findet sich der Vermerk: „Bestandteile des Begriffs „Imperialismus“.“ Anschließend folgt eine Auflistung von sechs Punkten, von denen er zwei zu einer Kategorie fasst:
- „Monopol als Ergebnis der Konzentration“
- „Kapitalausfuhr (als das Wichtigste)“
- „Vereinigungen des internationalen Kapitals“
- „Kolonien“
- „das Bankkapital und seine „Fäden“
- „Ablösung des freien Handels und des friedlichen Verkehrs durch eine Politik der Gewalt (Zölle; Eroberungen etc. etc.).“
Die Punkte drei und vier fasst Lenin zusammen unter „Aufteilung der Welt“ (Lenin 1972, S. 186). Lenin bestimmte eine Epoche als die Gesamtheit von verschiedenen Erscheinungen und Kriegen (Lenin 1916b, S. 28). Unter diesen Gesichtspunkt zeichnet sich Lenins Arbeit, im Unterschied zu den vorherigen, dadurch aus, dass er den Imperialismus als eine Epoche definierte – also als eine Gesamtheit von Erscheinungen und dabei ihre Wechselwirkungen berücksichtigte. In vorherigen Arbeiten wurde der Imperialismus als eine spezifische Politik charakterisiert: des Expansionismus (Hobson, Luxemburg, Kautsky), oder politökonomisch als Politik des Finanzkapitals (Hilferding, Bucharin). Lenin hob den wissenschaftlichen Wert von Bucharins Arbeit hervor, weil dieser „den Imperialismus als Ganzes“ betrachtete, als „eine bestimmte Entwicklungsstufe“ (Lenin 1915, S. 102). Dennoch zeigt sich in der Definition Lenins, im Unterschied zu Bucharin, dass Lenin auf die verschiedenen Seiten des Imperialismus eingeht und ihr Verhältnis bestimmt. Einerseits die ökonomischen und politischen Seiten, aber vor allem auch die internationale – die Ebene der Weltwirtschaft. Lenin geht also darüber hinaus nur einzelne wesentlichen Zusammenhänge zu nennen (wie das Finanzkapital, oder den Expansionismus) und präsentiert den inneren Zusammenhang des Imperialismus als eine Epoche, was durch seine fünf Kriterien deutlich wird. Im nächsten Kapitel wird sich detailliert der zentralen These dieses Textes zugewandt, nach der es sich bei Lenins Kriterien um eine logische Kategorienentwicklung handelt, deren Ausgangspunkt die Konzentration und das Monopol darstellt. Davon ausgehend entwickelt er das Finanzkapital, den Kapitalexport und die Aufteilung der Welt usw. In dieser Systematik unterscheidet sich Lenins Arbeit deutlich von vorherigen. Hilferding z.B. beginnt seine Untersuchung mit einer Auseinandersetzung mit Geld, Bucharin mit dem Begriff der Weltwirtschaft, Luxemburg mit dem Problem der Reproduktion.
2. Lenins begriffliche Entwicklung des Imperialismus
Im folgenden Kapitel soll auf die fünf Merkmale eingegangen werden, anhand derer Lenin den Imperialismus definiert. Dies soll in Form eines Vergleichs mit früheren Werken geschehen, die Lenin entweder explizit in seinen ökonomischen Studien berücksichtigte oder die (wie etwa die Schriften von Luxemburg) auch heute noch eine gewisse Rolle in den Imperialismus-Debatten spielen (vgl. Harvey 2005; Patnaik/Patnaik 2023).
Durch den Vergleich soll einerseits aufgezeigt werden, woher Lenin gewisse Aussagen seiner Broschüre nimmt. Es geht also darum, den wissenschaftlichen Stand der damaligen Zeit zu erfassen, wenn auch nur exemplarisch. Andererseits soll es bei dem Vergleich auch darum gehen, die Abstraktionsebene zu verdeutlichen, auf der sich Lenin bewegt. Damit soll die These begründet werden, dass es Lenin um eine Begriffsbestimmung des Imperialismus geht, aufbauend auf den historischen-konkreten Untersuchungen anderer Autoren. Der Aufbau des Kapitels orientiert sich an der Struktur von Lenins Imperialismus-Broschüre und folgt seinem Argumentationsgang.
2.1 Konzentration von Industrie und Bank
Das folgende Unterkapitel setzt sich mit dem Konzentrationsprozess in der Industrie und den Banken auseinander und ihrem wechselseitigen Verhältnis. Lenins Imperialismus-Broschüre beginnt mit der Analyse der Konzentration der Produktion und geht dann dazu über, die neue Rolle der Banken zu untersuchen.
2.1.1 Die Entstehung von Monopolverbänden
Bemerkenswert sind bereits die Anmerkungen, die Engels in das Manuskript des dritten Bandes des „Kapitals“ einfügt, zur Entstehung von Monopolverbänden und der Ablösung der freien Konkurrenz. Dabei ist auch die zeitliche Perspektive wichtig. Der dritte Band wurde 1894 veröffentlicht, also nur acht Jahre bevor Hobson Der Imperialismus (1902) herausbrachte.
In einem dieser Einschübe führt Engels aus, dass sich „neue Formen des Industriebetriebs“ entwickelt haben. Die wachsende Geschwindigkeit der großindustriellen Potenz steht der zunehmenden Langsamkeit der Ausdehnung des Marktes gegenüber. Hinzu komme die Schutzzollpolitik, durch welche die inländische Produktionsfähigkeiten künstlich gesteigert würden. Das Ergebnis sei „allgemeine chronische Überproduktion, gedrückte Preise, fallende und sogar ganz wegfallende Profite“. Dies führe dazu, dass:
„[die] altgerühmte Freiheit der Konkurrenz […] am Ende ihres Lateins [ist] und […] ihren offenbaren skandalösen Bankrott selbst ansagen [nuß]. Und zwar dadurch, daß in jedem Land die Großindustriellen eines bestimmten Zweigs sich zusammentun zu einem Kartell zur Regulierung der Produktion. Ein Ausschuß setzt das von jedem Etablissement zu produzierende Quantum fest und verteilt in letzter Instanz die einlaufenden Aufträge. In einzelnen Fällen kam es zeitweise sogar zu internationalen Kartellen, so zwischen der englischen und deutschen Eisenproduktion. Aber auch diese Form der Vergesellschaftung der Produktion genügte noch nicht. Der Interessengegensatz der einzelnen Geschäftsfirmen durchbrach sie nur zu oft und stellte die Konkurrenz wieder her. So kam man dahin, in einzelnen Zweigen, wo die Produktionsstufe dies zuließ, die gesamte Produktion dieses Geschäftszweigs zu einer großen Aktiengesellschaft mit einheitlicher Leitung zu konzentrieren (Marx 1894, S. 453f.).“
Diese Entwicklung führe dazu, dass „die Konkurrenz durch das Monopol ersetzt“ wurde (ebd., S. 454). In seinen 1895 verfassten Nachträgen zum dritten Band des Kapitals spricht Engels von der „allmählichen Verwandlung der Industrie in Aktienunternehmungen. Ein Zweig nach dem anderen verfällt dem Schicksal“ und von „Trusts, die Riesenunternehmungen mit gemeinsamer Leistung schaffen“ (Engels 1895, S. 918).
Durch verschiedene Passagen im dritten Band des Kapitals wird deutlich, dass Engels bereits Tendenzen einer grundlegenden Veränderung der kapitalistischen Produktionsweise bemerkte, die sich nach seinem Tod in einem schnellen Tempo durchsetzten: ein Konzentrationsprozess, der zu Entstehung von Monopolen führt.
Die zunehmende Abstrahierung von konkreten Einzelphänomenen hin zu einer Darstellung allgemeinerer Zusammenhänge in den verschiedenen Analysen wird deutlich durch einen Vergleich der Ausführungen von Otto Jeidels, Hilferding, Bucharin und Lenin im Hinblick auf Kartelle, Trusts und Syndikate.
Otto Jeidels beschreibt die Trustgesellschaften „für die Großbank als Werkzeug der Expansion“. Ob sie für diese Funktion dienlich sind, hängt von drei Hauptformen der Trustgesellschaft ab, die Jeidels relativ ausführlich beschreibt: 1. Gründung und Beherrschung von Unternehmungen; 2. Erweiterung des Tätigkeitsgebiets eines industriellen Unternehmens; 3. zum spekulativen Zweck (Jeidels 1905, S. 77f.). Während Jeidels bei der Auseinandersetzung mit den Trusts vor allem das Verhältnis von Bank und Industrie im Blick behält, definiert Hilferding den Trust als „eine monopolistische Fusion“ (Hilferding 1910, S. 286). Hilferding führt dann „neben den ökonomischen Vorteilen technische Vorteile“ an, die sich für den größeren Betrieb gegenüber den kleineren, durch Fusion und Trusts, ergeben (ebd., S. 288). Gleichzeitig beschreibt auch Hilferding das Interesse der Banken an der Entstehung von Monopolen:
„Ein so starkes Unternehmen ist ein Widerpart, an dem die Bank nicht allzuviel verdienen kann. Sobald die konkurrierenden Werke ihre Kunden sind, hat die Bank von deren Konkurrenz daher nur Nachteile zu erwarten. Daher ist das Streben der Banken nach Ausschaltung der Konkurrenz zwischen Werken, an denen sie beteiligt ist, ein absolutes. Jede Bank aber hat auch das Interesse an möglichst hohem Profit. Dieser wird unter sonst gleichen Umständen wieder den höchsten Stand erreichen bei völliger Ausschaltung der Konkurrenz in einem Industriezweig. Daher das Streben der Banken nach Herstellung des Monopols. Es treffen so die Tendenzen des Bankkapitals mit denen des Industriekapitals nach Ausschaltung der Konkurrenz zusammen (ebd., S. 275).“
In Bezug auf Kartelle spricht Jeidels davon, dass „der treibende Faktor die Industrie ist, deren Entwicklung sich Banken durchaus anzupassen“ haben (Jeidels 1905, S. 258). Hilferding definiert das Kartell als „eine monopolistische Interessengemeinschaft“, deren Ziel es ist, durch die weitgehende Ausschaltung der Konkurrenz die Preise zu steigern und dadurch den Profit zu maximieren (Hilferding 1910, S. 286). Das Syndikat wird von Hilferding als ein Kartell dargestellt, dass aus einem „rein vertragsmäßigen Gebilde durch Aufhebung der kommerziellen Selbstständigkeit der Unternehmungen zu einer kommerziellen Einheit wird“ (ebd., S. 299).
Jeidels und Hilferding gehen in ihren Untersuchungen mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen dezidierter auf die unterschiedlichen Formen des Industriemonopols ein. Bucharin sind diese Unterschiede zwar bewusst, er vermerkt aber in einer Fußnote seiner Analyse:
„Wir können hier die Unterschiede zwischen diesen Formen nicht ausführlich behandeln. Für unsere Aufgabe genügt es zu sagen, daß wir keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Kartell und Trust erblicken und im Trust nur die zentralisiertere Form derselben Erscheinung sehen. Jegliche (rein formale) Versuche […], einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem „autokratischen“ Trust und dem „demokratischen“ Syndikat (oder Kartell) zu machen, berühren das Wesen der Dinge, das sich aus der Rolle dieser Gebilde in der Sozialwirtschaft ergibt, nicht im geringsten. Daraus folgt aber nicht, daß zwischen ihnen keinerlei Unterschied bestünde, und in einem gewissen Sinne müssen diese Unterschiede gemacht werden (Bucharin 1915, S. 67 Fußnote).“
Bucharin merkt demnach an, dass für die Untersuchung der Weltwirtschaft diese Unterscheidungen nebensächlich seien, weil es sich lediglich um verschiedene Erscheinungsformen handele. In Lenins Imperialismus-Broschüre werden zwar die unterschiedlichen Formen genannt, aber auch für ihn spielen die Unterschiede keine entscheidende Rolle. Er spricht häufig von „Monopolverbänden“, unter die er Kartelle, Syndikate und Trusts fasst (Lenin 1917, S. 250). Für Lenin ist die Verwandlung der Konkurrenz in das Monopol „eine der wichtigsten Erscheinungen – wenn nicht die wichtigste“ (ebd., S. 210f.). Etwas früher ist zu lesen, dass:
„die Unterschiede zwischen einzelnen kapitalistischen Ländern […] bloß unwesentliche Unterschiede in der Form der Monopole oder in der Zeit ihres Aufkommens bedingen, während die Entstehung der Monopole infolge der Konzentration der Produktion überhaupt ein allgemeines Grundgesetz des Kapitalismus in seinem heutigen Entwicklungsstadium ist (ebd., S. 204).“
Lenin geht in seiner Abstraktion also noch weiter als Bucharin. Er kommt zu dem Schluss, dass die Entstehung (unabhängig von der Form und dem Zeitpunkt) der Monopole ein allgemeines Grundgesetz darstellt. Lenins Bestimmung von allgemeinen Charakteristiken der Monopolverbände wird erkennbar, wenn er über den Organisationszwang durch die Verbände schreibt, wonach „von einem Zwang zur Unterwerfung unter die Monopolverbände“ gesprochen werden muss. Um diese allgemeine Charakteristik zu begründen, wirft Lenin anschließend „einen flüchtigen Blick“ auf die unterschiedlichen Mittel, auf die die Monopolverbände zurückgreifen (ebd., S. 210).
Die unterschiedlichen Formen von Monopolverbänden, die durch die Autoren in unterschiedlicher Intensität behandelt werden, dienen an dieser Stelle lediglich als ein Beispiel. Andere Beispiele wären z.B. der Monopolpreis anhand der Kartellpreise, der von Hilferding an verschiedenen Stellen genauer beschrieben wird (vgl. u.a. Hilderding 1910, S. 234, S. 238f., S. 457), aber auch schon im dritten Band des Kapitals ein Thema ist (Marx 1894, S. 783), sowie die Probleme der Preisregulierung durch die Monopole (Hilderding 1910, S. 457). Ein weiteres Beispiel ist der Monopolprofit, der bei Marx (1894, S. 840f., S. 863, S. 868f.) thematisiert wird, in gewisser Weise auch bei Hobson, etwa in seinen Ausführungen über Extragewinne aus den Kolonien (Hobson 1902, S. 53). Er findet sich zudem an mehreren Stellen bei Hilferding, insbesondere in seiner Analyse des Kartellprofits und der Rolle des Hochschutzzolls (Hilferding 1910, S. 290f., S. 342, S. 344, S. 439, S. 456f.), sowie bei Bucharin, etwa dort, wo er beschreibt, wie Extraprofite auf dem Weltmarkt unter anderem durch ungleiche nationale Wirtschaftsstrukturen entstehen (Bucharin 1915, S. 88, S. 90, S. 186).. Für Lenin spielt die Frage, wie genau der Monopolprofit entsteht, nicht die entscheidende Rolle – vielmehr geht es ihm um andere Ebenen, z. B. die Möglichkeit der Bestechung der Arbeiterklasse durch den Monopolprofit (Lenin 1917, S. 306f.).
Als weiteres Beispiel könnte das Thema Konkurrenzkampf genannt werden, dass in unterschiedlicher Art und Weise von Jeidels, Hilferding und auch Bucharin thematisiert wird. Bei Lenin finden wir die kondensierte Bemerkung, dass die Monopole nicht die freie Konkurrenz beseitigen, aus der sie erwachsen sind, sondern dass die Monopole „über und neben ihr“ bestehen, was zu einer „Reihe besonders krasser und schroffer Widersprüche, Reibungen und Konflikte“ führt und schließlich, dass „[d]as Monopol […] der Übergang vom Kapitalismus zu einer höheren Ordnung [ist] (ebd., S. 270).
Zusammenfassung
In Bezug auf die Monopolverbände fällt auf, dass bereits Marx/Engels Ende des 19. Jahrhunderts die Tendenz hin zu einer ökonomischen Veränderung und einer Regulierung der Produktion festgestellt haben. Sie erkannten auch bereits die internationale Dimension dieses Prozesses. Die folgenden Arbeiten von Otto Jeidels und Rudolf Hilferding beschäftigen sich vor allem auf einer konkret-empirischen Ebene mit den neu entstandenen Monopolen und deren Verhältnis zum Bankkapital. Sie untersuchen dabei ausführlicher unterschiedliche Formen der Monopolverbände. Bei diesen Auseinandersetzungen tauchen auch Themen wie der Monopolpreis und -profit auf. Bei Bucharin ist ein erster Schritt der Abstraktion zu erkennen, da er sich von den unterschiedlichen Formen der Monopole löst und herausstellt, dass diese keine prinzipiellen Unterschiede bedeuten. Lenin knüpft vor allem an diese Abstraktion von Bucharin an. Für seine Auseinandersetzung spielen die konkreten Formfragen, aber auch die Fragen des Monopolpreises und -profits keine Rolle. Lenin konzentriert sich auf die gesetzmäßige Herausbildung der Monopole und arbeitet die wesentliche Seite dieser Entwicklung heraus: den Zwang zur Unterwerfung unter die Monopolverbände (Lenin 1917, S. 210). Lenin behandelt somit einen allgemeinen, notwendigen und wesentlichen Zusammenhang in Bezug auf die Monopolverbände.
2.1.2 Verhältnis Industrie- und Bankkonzentration
Ein zentraler Aspekt in Lenins Argumentation, aber auch in der vieler anderer Autoren, ist das Verhältnis zwischen der Konzentration in der Industrie und jener im Bankensektor, die Entstehung von Großbanken und schließlich die Analyse des Finanzkapitals. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle etwas ausführlicher auf den beidseitigen Konzentrationsprozess und dessen Verschmelzung eingegangen werden, um anschließend im nächsten Unterkapitel (2.2) das Finanzkapital zu behandeln.
Gleich zu Beginn von Otto Jeidels Untersuchung über das Verhältnis von deutschen Großbanken zur Industrie, findet sich die Bemerkung, dass durch die technische Natur des Kreditgeschäfts und die zunehmende Bedeutung des Kreditverkehrs, frühere Faktoren der industriellen Kreditvermittlung an Bedeutung verlieren und neue Faktoren an ihren Platz treten, was zu einem bisher unbekannten Charakter der Kreditvermittlung führt:
„Erst wenn hierdurch klargelegt ist, wie Bankiers und kleine Banken in steigendem Maße an Bedeutung verlieren, die großen Berliner Banken mit erweiterten Aufgaben an ihre Stelle treten, wieweit also der Konzentrationsprozeß im Bankgewerbe seinen Ursprung in der Natur des industriellen Bankgeschäfts hat, können die Beziehungen der Großbanken zur Industrie in ihrer prinzipiellen und originellen Bedeutung verstanden werden (Jeidels 1905, S. 23).“
In einer ähnlichen Weise bemerkt Hilferding, „daß die Konzentration in der Industrie gleichzeitig eine Konzentration der Banken herbeiführt, die aus den eigenen Entwicklungsbedingungen des Bankgeschäfts heraus noch verstärkt wird (Hilferding 1910, S. 274f.).“ Bereits bei Marx ist dieses Wechselverhältnis beschrieben, er spricht davon, dass „[d]ie Entwicklung des Produktionsprozesses […] den Kredit [erweitert], und der Kredit […] zur Ausdehnung der industriellen und merkantilen Operation [führt].“ Und schließlich heißt es, dass der Kredit „[…] mit dem Umfang des industriellen Kapitels selbst [wächst] (Marx 1894, S. 498).“ Hilferding geht dann auf das Verhältnis von Monopolen in Industrie und Bankwesen ein und wie diese sich auf den Konzentrationsprozess auswirken:
„Die Entwicklung der kapitalistischen Industrie entwickelt die Konzentration im Bankwesen. Das konzentrierte Banksystem ist selbst ein wichtiger Motor zur Erreichung der höchsten Stufe kapitalistischer Konzentration in den Kartellen und Trusts. Wie wirken nun diese wieder zurück auf das Banksystem. Das Kartell oder der Trust ist ein Unternehmen von größter Kapitalkraft. In den gegenseitigen Abhängigkeitsbeziehungen kapitalistischer Unternehmungen entscheidet vor allem die Kapitalstärke darüber, welches Unternehmen von dem anderen in Abhängigkeit gerät. Eine weit fortgeschrittene Kartellierung wirkt von vornherein dahin, daß auch die Banken sich zusammenschließen und sich vergrößern, um dem Kartell oder Trust gegenüber nicht in Abhängigkeit zu geraten. Die Kartellierung selbst befördert so den Zusammenschluß der Banken, wie umgekehrt der Zusammenschluß der Banken die Kartellierung (Hilferding 1910, S. 332).“
Betont wird auch an dieser Stelle das wechselseitige Verhältnis des Konzentrationsprozesses. Heraussticht die Aussage, dass nach Hilferding die Kapitalkraft ausschlaggebend dafür sei, ob die Bank oder die Industrie in ein Abhängigkeitsverhältnis gerate. Wir werden in Kapitel 2.2.1 über das Finanzkapital sehen, dass Hilferding das entstehende Abhängigkeitsverhältnis sehr eindeutig bestimmt.
Otto Jeidels führt aus, dass die Entwicklung der Großbanken in einem gewissen Grad abhängig ist von (der Entwicklung) der Industrie. Die Konzentrationen der Großbanken schlägt ab einem gewissen Punkt ihrerseits wieder in eine erweiterte Konzentration der Industrie um. Wer in diesem Prozess die Initiative hat, sei dabei „nicht allgemein festzustellen“ und sei „im Grunde auch gleichgültig“. Vielmehr sei es „in weit größerem Maße als bisher Sache der Persönlichkeit“, wer die tonangebende Rolle einnimmt (Jeidels 1905, S. 252). Jeidels charakterisiert die neu eingetretene Situation zusammenfassend:
„Die gegenwärtige Entwicklungsstufe der Industrie setzt der Bankwelt, die ihrerseits einen dem gewerblichen ähnlichen Konzentrationsprozeß durchmacht, eine neue Aufgabe: galt es in früheren Perioden industrieller Banktätigkeit, die Industrie anzuregen, so handelt es sich heute darum, sich derselben zu bemächtigen. Nicht die Schaffung, sondern die Beherrschung und Leitung der Kapitalmassen ist das Entscheidende. Erst damit ist der Anlaß gegeben, die einzelnen Formen industrieller Beziehungen planmäßig auszubilden (ebd., S. 108f.).“
Jeidels beschreibt den Konzentrationsprozess der Großbanken als einen Expansionsprozess. Diese Expansion stellt nach Jeidels die „Aufsaugung von anderen Kreditinstituten“ dar und bildet die Voraussetzung „einer Alleinherrschaft“, die die objektive Möglichkeit für „eine planvolle Industriepolitik“ schafft (ebd., S. 80). Jeidels geht anschließend genauer auf den Konzentrationsprozess der Banken ein und spricht von vier Stufen, die aufeinander folgen:
„1. das Verschwinden der kleinen Bankbetriebe; 2. die Aufsaugung der größeren Provinzbanken, denen ihrerseits die erste Entwicklungsstufe zu einer bedeutenden Stellung verholfen hat, durch die Berliner Großbanken; 3. die Verdrängung der Mittelbanken, deren Wesen durch ihre Spitze in Berlin, eine über den Durchschnitt hinausgehende Kapitalkraft und ihre Tätigkeit als moderne Industrie- und Effektenbank bestimmt wird, durch die Großbanken, die sich von ihnen mehr quantitativ als qualitativ unterscheiden; 4. schließlich der Zusammenschluß mehrerer Großbanken. Jede dieser Entwicklungsstufen hat die vorhergehenden zur Voraussetzung, so aber, daß die früheren sich auch auf späteren Stufen weiter durchsetzen (ebd., S. 81).“
Ähnlich sind auch die Argumentationen Hilferdings. Er führt aus, dass sich durch die wachsende Konzentration der Banken eine Änderung ihrer Stellung „zu der Spekulation, dem Handel und der Industrie“ vollzieht. Hilferding erläutert:
„Zunächst bedeutet die Bankkonzentration eine Machtverschiebung zugunsten der Bank schon vermöge ihrer großen Kapitalskraft. Diese Kraft ist nicht nur quantitativ bedeutender als die der Schuldner der Bank, sondern die Überlegenheit der Bank ist eine qualitative dadurch, daß die Bank über das Kapital in seiner stets schlagfertigen Form, der Geldform, verfügt. Diese Überlegenheit aber verhütet, daß eine große, gut geleitete Bank in solche Abhängigkeit von dem Schicksal einer einzigen oder einiger weniger Unternehmungen gerät, bei denen sie ihre Mittel festgelegt hat, daß sie in deren Zusammenbruch während der Krise unrettbar mitverstrickt wird (Hilferding 1910, S. 432.).“
Interessant sind die leicht unterschiedlichen Akzentuierungen: Jeidels betont vor allem die dominierende Rolle der Banken und das Ziel eines planmäßigen Handelns der Industrie. Hilferding hingegen erkennt zwar ebenfalls diese Rolle der Banken an, hebt jedoch zugleich eine Abhängigkeit der Banken von der Industrie hervor.
Es ließe sich ausführlicher auf die Argumentation von Jeidels eingehen, der in seinem Buch den Konzentrationsprozess der Banken und deren veränderte Funktion gegenüber der Industrie sehr detailliert darlegt. Entscheidend ist jedoch an dieser Stelle, den Unterschied in der Analyseebene zwischen Jeidels, Hilferding und Lenin herauszuarbeiten. Lenin, der die sehr detaillierten Studien von Jeidels und Hilferding kannte, konzentriert sich in seiner Untersuchung auf die wesentlichen Seiten im Konzentrationsprozess der Banken, der Entstehung von Monopolbanken und die Unterwerfung des Handels und der Industrie unter ihre Führung.
Im zweiten Kapitel seiner Imperialismusschrift (Die Banken und ihre neue Rolle) charakterisiert Lenin den Konzentrationsprozess der Banken wie folgt:
„In dem Maße, wie sich das Bankwesen und seine Konzentration in wenigen Institutionen entwickeln, wachsen die Banken aus bescheidenen Vermittlern zu allmächtigen Monopolinhabern an, die fast über das gesamte Geldkapital aller Kapitalisten und Kleinunternehmer sowie über den größten Teil der Produktionsmittel und Rohstoffquellen des betreffenden Landes oder einer ganzen Reihe von Ländern verfügen. Diese Verwandlung zahlreicher bescheidener Vermittler in ein Häuflein Monopolisten bildet einen der Grundprozesse des Hinüberwachsens des Kapitalismus in den kapitalistischen Imperialismus, und deshalb müssen wir in erster Linie bei der Konzentration des Bankwesens verweilen (Lenin 1917, S. 214).“
Lenin sieht, ähnlich wie Jeidels und Hilferding, den Ursprung der Bankkonzentration im Konzentrationsprozess der Industrie, was deutlich wird, wenn Lenin davon spricht, dass die:
„Bank, die das Kontokorrent für bestimmte Kapitalisten führt, […] scheinbar eine rein technische, eine bloße Hilfsoperation aus[übt]. Sobald aber diese Operation Riesendimensionen annimmt, zeigt sich, daß eine Handvoll Monopolisten sich die Handels- und Industrieoperationen der ganzen kapitalistischen Gesellschaft unterwirft […] (ebd., S. 218).“
In Lenins Ausführung zeigt sich eine gewisse Parallele zu Jeidels, der die neue Aufgabe der Bank durch die „Beherrschung und Leitung der Kapitalmassen“ charakterisierte (Jeidels 1905, S. 108f.). Entscheidend ist Lenins allgemeine Darstellung des Prozesses – worin sich in einer gewissen Weise ein Unterschied zu Jeidels und Hilferding zeigt. Lenin spricht vom Bestreben „monopolistischer Abmachungen“ und der Bildung von „Banktrust[s]“ und schreibt schließlich: „Das letzte Wort in der Entwicklung des Bankwesens ist immer wieder das Monopol (ebd., S. 223).“ Dieser Prozess ist in Lenins Schrift letztlich der Übergang zum Begriff des Finanzkapital. So heißt es:
„Konzentration der Produktion, daraus erwachsende Monopole, Verschmelzung oder Verwachsen der Banken mit der Industrie – das ist die Entstehungsgeschichte des Finanzkapitals und der Inhalt dieses Begriffs (ebd., S. 230).“
Zusammenfassung
Das Verhältnis von Industrie- und Bankkonzentration wurde von Jeidels und Hilferding untersucht. Hilferding arbeitet die Dialektik hinter der Industrie- und Bankkonzentration heraus: die Konzentration der Industrie führt zur Konzentration der Banken. Letztere führt wieder zur Konzentration innerhalb der Industrie und der Entstehung von Monopolverbänden. Dieser Prozess beschleunigt seinerseits den Zusammenschluss von Banken und fördert die Entstehung von Großbanken. Sowohl Jeidels als auch Hilferding diskutieren die Frage, wer innerhalb des Konzentrationsprozesses das Sagen hat – die Industriellen oder die Bankiers. Beide antworten unterschiedlich: Jeidels betont die Rolle der Persönlichkeit, Hilferding die Bedeutung der Kapitalkraft. Jeidels arbeitet die neue Aufgabe der Banken heraus: die Bemächtigung und Beherrschung der Industrie. Auch Hilferding spricht von einer Machtverschiebung der Banken gegenüber der Industrie. In Lenins Imperialismus-Broschüre ist die Entstehung von Bankmonopolen und ihre Unterwerfung der Industrie entscheidend. Lenin verallgemeinert somit die von Jeidels und Hilferding beschriebenen Tendenzen mit dem Begriff des Bankenmonopols. Jeidels und Hilferding sprachen zwar von Großbanken, aber erst Lenin führt den Begriff des Bankenmonopols ein. Auch an dieser Stelle zeigt sich wieder die Fokussierung Lenins auf einen allgemeinen und wesentlichen Zusammenhang. Er arbeitet in Bezug auf die Industrie den wesentlichen Zusammenhang des Zwangs und der Unterwerfung durch die Monopolverbände heraus und analysiert weiter, wie sich dieser innerhalb der Banken niederschlägt, auf sie übergreift und letztlich in die Beherrschung der Industrie durch die Monopolbanken umschlägt.
2.1.3 Die Verschmelzung von Industrie- und Bankkapital
Bevor der Begriff des Finanzkapitals ausführlicher behandelt wird, soll zunächst die Verschmelzung von Bank- und Industriekapital näher betrachtet werden. Dies wird hauptsächlich anhand Otto Jeidels und Hilferding geschehen, da Lenin zwar von der Verschmelzung spricht, aber nicht im selben Detailgrad analysiert, wie sich diese genau vollzieht. Ein etwas genauerer Blick auf diese Frage kann hilfreich sein, da sich an dieser Stelle bereits Hinweise darauf finden, wie genau das Finanzkapital zu verstehen ist.
Otto Jeidels führt neben den Emissions- und Gründungsgeschäften den Kontokorrentkredit als charakteristisches industrielles Bankgeschäft an. Der Kontokorrentkredit ist der industrielle Bankkredit im engeren Sinn. Jeidels nennt drei Gründe, die dem Kontokorrentkredit eine besondere Bedeutung für das Verhältnis der Banken zur Industrie verleihen: (1) schafft er eine Abhängigkeit der Industrie von den Kreditgebern durch seine „Wichtigkeit für die ruhige Ausdehnung eines Unternehmens“; (2) aufgrund seiner Auswirkung auf die Organisation des Bankwesens, wegen seiner Wirkung auf die Bankkonzentration und die stärkere Rolle der Großbanken; (3) wird das industrielle Kontokorrentgeschäft zum Zentrum sämtlicher Bankgeschäfte mit der Industrie:
„die Gründungs- und Emissionstätigkeit, die direkte Beteiligung an gewerblichen Unternehmungen, das Mitwirken bei der Leitung industrieller Betriebe als Mitglied des Aufsichtsrats stehen zu dem Bankkredit in sehr vielen Fällen in dem engen Verhältnis von Ursache und Wirkung (Jeidels 1905, S. 32f.).“
Jeidels beschreibt, wie durch die Inanspruchnahme solcher Kredite eine enge Verbindung zwischen den industriellen Unternehmen und der Bank entsteht. Da die Bank durch solche industriellen Bankgeschäfte schnell ihre Mittel in einer Weise vergibt, die für die Liquidität der Bank schädlich ist, führt Jeidels drei Folgen an, die sich aus dem Kontokorrentkredit ergeben:
„Erstens muß die Bank über große Mittel verfügen; von den Kapitalerhöhungen unserer Großbanken und besonders der rheinisch-westfälischen Provinzbanken, soweit sie nicht der Erwerbung anderer Banken galten, hatten wohl die meisten ihren Grund in der Ausdehnung des Kontokorrentverkehrs. Zweitens muß die Bank das kreditnehmende Werk genau überwachen. Dies nach einer doppelten Richtung: sie muß darauf hinwirken, daß das Werk nur mit dieser einen Bank arbeitet —, eine Notwendigkeit, die nicht bloß ein kapitalkräftiges, sondern auch ein weitverzweigtes Kreditinstitut voraussetzt; die Bank muß sich aber auch einen Einfluß auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens selbst verschaffen, um leichtsinnige Anlagen zu verhüten und über die Realisierbarkeit ihrer Forderungen unterrichtet zu sein. Drittens schließlich muß eine Bank in der Auswahl der industriellen Schuldner überhaupt gewisse feste Prinzipien verfolgen […] (ebd., S. 34f.).“
Der Kontokorrentkredit stellt in Jeidels Argumentation quasi den Kern in den Bank- und Industriebeziehungen dar, ist aber nicht die einzige Form. Jeidels unterscheidet vier weitere Formen der Beziehungen, die durch einen unterschiedlichen Intensitätsgrad charakterisieren sind: (1) der Kontokorrentkredit selbst; (2) das Emissionsgeschäft; (3) die Besetzung von industriellen Aufsichtsratsposten durch Bankiers; (4) die direkte Beteiligung von Banken an der Industrie. Die engste Beziehung besteht nach Jeidels dort, wo die Bank als Mitglied in einem Aufsichtsrat mitreden kann (ebd., S. 109). Die Aktienbeteiligung hingegen wird als keine charakteristische Form der Industriebeziehung einer Großbank beschrieben. Sie trete „nur ergänzend und als Mittel zum Zweck in jeder der unterschiedlichen Einflußsphären auf“ (ebd., S. 121).
In Hilferdings Argumentation stellt der Bankkredit ebenfalls einen zentralen Eckpunkt dar, allerdings mit einem etwas anderen Fokus. Hilferding beschreibt, wie die Entwicklung der Produktion dazu führt, dass ein immer größerer Teil des in der Produktion fungierenden Gesamtkapitals in Form von Geldkapital brachliegt. Der Umgang des brachliegenden Kapitals variiert stark und wirkt sich auf Angebot und Nachfrage auf dem Geldmarkt aus. Vor diesem Hintergrund beschreibt Hilferding die neue Funktion, die der Kredit erhält: „dieses Brachliegende auf ein Minimum zu reduzieren (Hilferding 1910, S. 91).“
Die industrielle Nutzung des Kredits wird zu einer Notwendigkeit durch den Konkurrenzkampf, weil „für den Einzelkapitalisten […] die Benutzung des Kredits eine Erhöhung seiner individuellen Profitrate [bedeutet] (ebd., S. 114).“ Auch Hilferding beschreibt, wie sich durch die Entwicklung des Kreditgeschäfts die Stellung der Banken gegenüber der Industrie verändert. Die Bereitstellung von industriellem Produktionskapital durch die Banken führt dazu, dass ihr Interesse:
„nicht mehr auf den augenblicklichen Zustand des Unternehmens und die augenblickliche Marktlage beschränkt, sondern jetzt handelt es sich vielmehr um das fernere Geschick des Unternehmens, um die künftige Gestaltung der Marktlage. Aus dem augenblicklichen wird ein dauerndes Interesse, und je größer der Kredit, je mehr vor allem der Anteil des in fixes Kapital verwandelten Leihkapitals überwiegt, desto größer und desto bleibender dieses Interesse (ebd., S. 117).“
Sowohl für Jeidels’ als auch für Hilferdings Argumentation ist die Rolle von Aufsichtsräten zentral für die Frage der Verschmelzung.
Jeidels schreibt davon, dass die Beziehung zwischen einer Bank und einem Industrieunternehmen dort am engsten wird, wo von der Bank „abhängige, an ihr stark interessierte oder ihr befreundete Personen in der Verwaltung der Unternehmung dauernd mitzureden haben.“ Zentral dafür sind zeitweilige oder dauerhafte Aktienmehrheiten, die es der Bank erlauben, eine ihnen nahestehende Person zum Direktor zu machen (Jeidels 1905, S. 143f.). Interessant ist, dass Jeidels unterschiedliche Zwecke für Bank und Industrie in den Aufsichtsräten unterscheidet.
Für Banken werden zwei zentrale Ziele aufgezeigt, die sie durch ihre Präsenz in den Aufsichtsräten der Industrie verfolgen: Zum einen streben sie danach, Beziehungen sowohl zur Industrie als auch zu anderen Banken zu knüpfen. Zum anderen zielen sie darauf ab, direkten Einfluss auf die betreffenden Unternehmen auszuüben. Beides erreichen sie durch die Platzierung eines ihrer Direktoren im Aufsichtsrat des Industrieunternehmens. Für das Anknüpfen neuer Beziehungen sieht Jeidels „den umgekehrten Weg geeignet“: ein Direktor oder ein Mitglied des Aufsichtsrats der industriellen Gesellschaft im Aufsichtsrat der Bank, oder einer abhängigen Unterbank in der Provinz. Daraus schließt Jeidels, dass der „Aufsichtsrat einer Großbank […] immer schon ganz anders aus[sieht] als der einer industriellen Gesellschaft“, denn im Aufsichtsrat einer Großbank werden sich lediglich diejenigen Industriellen finden, deren Interessen mit denen der Bank übereinstimmen. Im Aufsichtsrat der Bank findet sich auch „ein Parlamentsmitglied oder ein Mitglied der Berliner Stadtverwaltung“ (ebd., S. 150ff.).
Jeidels zieht aus diesen Unterschieden die Konsequenz:
„[W]ird ein Industrieller in den Aufsichtsrat der Großbank gewählt, so soll er nicht auf ihre Verwaltung zu gunsten der hinter ihm stehenden Unternehmungen, sondern auf diese zum Vorteil der Bank einwirken; jedenfalls soll er auf seinem industriellen Boden bleiben und hier neben den eigenen auch andere Interessen wahrnehmen; der Bankdirektor dagegen, der in einen industriellen Aufsichtsrat eintritt, greift bewußt auf ein anderes Gebiet über, um in dieser Unternehmung seinen Einfluß zu gunsten seiner eigenen Bank einzusetzen, die ganz andere Interessen haben kann — nicht haben muß — als jene. Es steht damit nicht im Widerspruch, daß der friedliche Einfluß der Industriellen, die im Aufsichtsrat der Großbank sitzen, sehr bedeutend sein kann. Er geht über einzelne Ratschläge und Beihilfe bei Anknüpfung neuer Beziehungen bald hinaus. Die Industriellen im Aufsichtsrat vermitteln die Durchdringung der Bankleitung mit dem Geist großindustrieller Geschäftsprinzipien (ebd., S. 153).“
In den Schwerpunkten von Industrie und Banken in Aufsichtsräten besteht nach Jeidels ein Unterschied darin, dass die Industrie „ihren Schwerpunkt in den ihnen nahestehenden gewerblichen Unternehmen haben“ und ihr Fokus darauf liegt, eine Verbindung untereinander herzustellen, wenn sie in den Aufsichtsrat einer Großbank treten. Den Bankdirektoren in den industriellen Aufsichtsräten gehe es darum, die ihm eigentlich fremden Gebiete „ihrer Bank zu unterwerfen“ (ebd., S. 156).
Hilferding merkt an, dass die Beteiligung von Banken an Unternehmen dazu führt, dass die Banken „damit an dem Schicksal dieses Unternehmens beteiligt“ sind. Diese Beteiligung wird umso größer, je mehr Kapital der Bank in dem Unternehmen gebunden ist (Hilferding 1910, S. 110). In der industriellen Aktiengesellschaft sieht Hilferding eine Veränderung der Funktion des industriellen Kapitalisten, durch „die Befreiung des industriellen Kapitalisten von der Funktion des industriellen Unternehmers.“ Das Kapital, das in der Aktiengesellschaft investiert wurde, sorgt dafür, dass der Kapitalist „die Funktion des reinen Geldkapitalisten“ annimmt (ebd., S. 137f.). Für die Beherrschung der Aktiengesellschaft ist der Kapitalbetrag gering („bloß ein Drittel bis ein Viertel […] und weniger“). Dies führt dazu, dass der Beherrscher der Aktiengesellschaft „über das andere, fremdes Kapital [verfügt] wie über sein eigenes (ebd., S. 158).“ Hilferding erläutert, dass die Entwicklung der Aktiengesellschaften und die zunehmende Eigentumskonzentration in einer steigenden Zahl an Großkapitalisten münde, „die ihr Kapital in verschiedenen Aktiengesellschaften angelegt haben.“ Der starke Besitz an Aktien erlaubt, sich in der Leitung der Gesellschaft vertreten zu lassen. Daraus folgert Hilferding:
„Als Mitglied des Aufsichtsrates erhält der Großaktionär in Form der Tantiemen erstens einen Anteil am Profit, zweitens Gelegenheit, auf die Verwaltung des Unternehmens Einfluß zu nehmen oder aber die Kenntnis von den Vorgängen im Unternehmen auszunützen […]. Es bildet sich ein Kreis von Personen heraus, die vermöge ihrer eigenen Kapitalsmacht oder aber als Vertreter der konzentrierten Macht fremden Kapitals (Bankdirektoren) als Aufsichtsräte in einer großen Anzahl von Aktiengesellschaften vertreten sind. Es entsteht so eine Art von Personalunion, einmal zwischen den verschiedenen Aktiengesellschaften untereinander und sodann zwischen diesen und den Banken, ein Umstand, der für die Politik dieser Gesellschaften von größtem Einfluß sein muß, weil zwischen den verschiedenen Gesellschaften ein gemeinsames Besitzinteresse sich bildet (ebd., S. 160f.).“
Hilferding spricht hier, ähnlich wie Jeidels, von einer entstehenden Personalunion. Jeidels machte die Verbindung von Banken zur Politik auf. Hilferding beschreibt eine Union zwischen den unterschiedlichen Aktiengesellschaften und schließlich mit der Politik. Unabhängig davon, ob eine Bank über längere oder kürzere Zeit Kapital in Aktien anlegt, entsteht ein dauerhaftes Interesse der Bank an der Aktiengesellschaft, die:
„einerseits von der Bank kontrolliert werden muß, um die richtige Verwendung des Kredits zu gewährleisten, anderseits von der Bank möglichst beherrscht werden muß, um all die gewinnbringenden finanziellen Transaktionen der Bank zu sichern (ebd., S. 163).“
In seiner Imperialismus-Broschüre spricht Lenin von einer „Personalunion der Banken mit den größten Industrie- und Handelsunternehmungen“, die er als „eine beidseitige Verschmelzung durch Aktienbesitz“ beschreibt. Diese entsteht „durch den Eintritt der Bankdirektoren in die Aufsichtsräte (oder die Vorstände)“ der Handels- und Industrieunternehmen und umgekehrt (Lenin 1917, S. 224). Diese Personalunion von Bank und Industrie findet ihre Ergänzung mit der Regierung. An dieser Stelle bezieht sich Lenin explizit auf Jeidels und schreibt:
„Jeidels schreibt: „Freiwillig werden Aufsichtsratsstellen gewährt an Personen mit gutklingenden Namen, auch ehemaligen Staatsbeamten, die im Verkehr mit den Behörden manche Erleichterung (!!) schaffen können“ Im Aufsichtsrat einer Großbank sieht man gewöhnlich … ein Parlamentsmitglied oder ein Mitglied der Berliner Stadtverwaltung“ (ebd., S. 225).“
Ähnlich wie Hilferding, der davon spricht, wie die Banken an dem „Schicksal“ der Unternehmen beteiligt sind, in die sie investieren, führt Jeidels an, dass eine technische Folge aus den neuen Beziehungen zwischen Bank und Industrie ist, dass die Banken bestrebt sind, das Werk, in das sie investiert haben, in einen Zustand zu bringen, „der es erlaubt, die Kredite zurückzuzahlen und die Aktien der Gesellschaft auf den Markt zu bringen“. Es kommt zu einer Situation, dass:
„wenn eine Bank in eine solche Teilhaberstellung bei einem Unternehmen einmal hineingedrängt ist, so kann sie nichts anderes tun, als — gestützt auf ihre Kapitalkraft und finanzielle Machtstellung — auch und gerade in schlechten Zeiten den technischen Ausbau des Werks zu fördern und es für gute Zeiten kampfbereit zu machen (Jeidels 1905, S. 209).“
Die neuartige Beziehung zwischen Bank und Industrie verändert die Entscheidungskompetenzen. Jeidels betont die „Initiative und selbständige Rolle der Bank“, die sich aus der Natur der Transaktionen ergebe. Stehen technisch-wirtschaftliche Erwägungen des industriellen Betriebs im Vordergrund, liegt das entscheidende Gewicht auf der Industrie. Geht es hingegen um das Maß und die Form der Geldbeschaffung, dann liegt das Gewicht der Entscheidungen bei der Bank (ebd., S. 213f.). Für die Großbanken sieht Jeidels das wesentliche Bestreben in der einfachen Erweiterung der industriellen Kundschaft. In diesen Zusammenhang stellt er auch den Bankenterror gegenüber den industriellen Unternehmen (ebd., S. 219f.).
In Lenins Argumentation spielen die Nuancen, in welchen Bereichen die Bank und in welchen die Industrie die Entscheidungen trifft, keine Rolle. So heißt es, dass die Großbank:
„die Möglichkeit erhält, sich zunächst über die Geschäftslage der einzelnen Kapitalisten genau zu informieren, dann sie zu kontrollieren, sie durch Erweiterung oder Schmälerung, Erleichterung oder Erschwerung des Kredits zu beeinflussen und schließlich ihr Schicksal restlos zu bestimmen […] (Lenin 1917, S. 218).“
Später führt Lenin aus, wie aus den dauerhaften Beziehungen zwischen Bank und Industrie „eine immer vollständigere Abhängigkeit des Industriekapitals von der Bank“ entstehe (ebd., S. 224).
Gegen Ende seiner Untersuchung stellt Jeidels fest, dass sich ein „planvolles unmittelbares Einwirken auf die industrielle Entwicklung“ aus dem Verhältnis der Bank zur Industrie „nicht herausgebildet“ habe und „die industrielle Initiative […] nicht auf die Banken übergegangen“ ist:
„Bei den Einzelwerken wie bei den besprochenen gewerblichen Gruppenbildungen beschränkt sich die Tätigkeit der Bank auf das finanzielle Moment, sie besorgt das Geld und leistet die im Wesen einer Bank liegenden Dienste, sie ermöglicht damit die Entfaltung industrieller Entwicklungstendenzen, die sie selbst nicht geschaffen hat. Diese finanzielle Bestimmung der Banken spielt aber nicht zu allen Zeiten und an allen Punkten der Industrie die gleiche Rolle. Die Beziehungen zwischen den industriellen Unternehmungen und den Banken als Geldgebern richten sich nach dem Kapitalbedarf der Industrie, nach seinem Umfang wie nach seiner Rolle im gesamten industriellen Entwicklungsprozeß (ebd., S. 250).“
Bucharin argumentiert etwas anders, indem er darauf hinweist, dass Beteiligung und Finanzierung dazu führen, dass „sich die ständige Verflechtung der Industrie zu einem organisierten System entwickelt.“ Dabei bewegt er sich jedoch auf einer abstrakteren Ebene, da er sich auf zentralisierte Formen von Monopolen, wie Trusts, bezieht und diese als eine Art Beteiligungs- oder Finanzierungsgesellschaften beschreibt (Bucharin 1915, S. 52). Das bedeutet, dass Bucharin in der Tatsache, dass die Industrie sich durch die Monopolisierung hin zu einer stärker zentralisierten und planvolleren Struktur entwickelt, die gleichzeitig eng mit den Banken verflochten ist, ein organisiertes System im Entstehen sieht.
Lenin referiert im Punkt der Verschmelzung auf Bucharin und schreibt:
„Die Folge ist einerseits eine immer größere Verschmelzung oder, nach einem treffenden Ausdruck von N. I. Bucharin, ein Verwachsen des Bankkapitals mit dem Industriekapital, und anderseits ein Hinüberwachsen der Banken in Institutionen von wahrhaft „universalem Charakter“ (Lenin 1917, S. 226).“
Zusammenfassung
Jeidels und Hilferdings Arbeiten zeichnen sich wieder durch eine konkret empirische Untersuchung aus. Jeidels beschäftigt sich umfänglich mit der Rolle der Bankkredite und den verschiedenen Formen der Beteiligung an der Industrie. Sowohl bei Jeidels als auch Hilferding spielen die Aufsichtsräte eine entscheidende Rolle in ihren Untersuchungen. Beide sprechen in diesem Kontext von einer entstehenden Personalunion zwischen Industrie, Bank und der Politik. Jeidels setzte sich detaillierter als Hilferding mit den Aufsichtsräten auseinander und bespricht die Unterschiede in der Industrie und den Banken. Sein Fokus liegt dabei auf der Entscheidungsgewalt der Banken. In Lenins Analyse ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass er von einer Verschmelzung von Industrie und Banken spricht. Diese Formulierung wird weder von Jeidels noch von Hilferding genutzt. Lenin setzt sich im Unterschied zu Jeidels und Hilferding allerdings nicht so ausführlich mit dem Prozess des Verwachsens selbst auseinander. Für ihn ist die Rolle der Banken das Entscheidende, ihre Kontrolle und die immer vollständigere Abhängigkeit der Industrie. Lenin referierte auf Bucharin, um den entstehenden universellen Charakter der Banken zu beschreiben. Lenins Alleinstellungsmerkmal liegt demnach darin, dass er den zentralen Zusammenhang des Verwachsens benennt, der sich durch die Kontrolle und Beherrschung der Banken auszeichnet.
2.2 Das Finanzkapital
Nachdem auf den Konzentrationsprozess der Industrie und der Banken sowie ihre Verschmelzung eingegangen wurde, soll es nun um die unterschiedlichen Charakterisierungen des Finanzkapitals und der Finanzoligarchie gehen. Anschließend wird im zweiten Teil auf die (neue) Rolle des Staates eingegangen.
2.2.1 Finanzkapital und Finanzoligarchie
Wie in Fußnote 3 erläutert, taucht bereits im dritten Band des Kapitals bei Marx die Bezeichnung „Finanzaristokratie“ auf, die er in Auseinandersetzung mit dem Aufkommen von Aktienunternehmen verwendet. Marx beschreibt, wie der Kredit „gewissen Sphären das Monopol her[stellt]“ und eine Finanzaristokratie reproduziert: „eine neue Sorte Parasiten“ (Marx 1894, S. 454). Demnach deckte Marx bereits eine gewisse Entwicklung auf, die Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts weiter analysiert wurde.
Auf der ersten Seite von DasFinanzkapital spricht Hilferding davon, dass aus der immer innigeren Beziehung zwischen Bank- und Industriekapital das Kapital „die Form des Finanzkapitals an[nimmt], die seine höchste und abstrakteste Erscheinungsform bildet (Hilferding 1910, S. 1).“ Für Hilferdings Definition des Finanzkapitals spielen die Eigentumsverhältnisse eine wichtige Rolle. Wir sahen bereits in Kapitel 2.1.3 über die Verschmelzung, welchen Stellenwert der Aktienbesitz und vor allem die Aufsichtsräte für Jeidels und Hilferding spielten. Aus den Eigentumsverhältnissen durch die Aktienbesitze folgert Hilferding die „Abhängigkeit der Industrie von den Banken“:
„Ein immer wachsender Teil des Kapitals der Industrie gehört nicht den Industriellen, die es anwenden. Sie erhalten die Verfügung über das Kapital nur durch die Bank, die ihnen gegenüber den Eigentümer vertritt. Anderseits muß die Bank einen immer wachsenden Teil ihrer Kapitalien in der Industrie fixieren. Sie wird damit in immer größerem Umfang industrieller Kapitalist. Ich nenne das Bankkapital, also Kapital in Geldform, das auf diese Weise in Wirklichkeit in industrielles Kapital verwandelt ist, das Finanzkapital (ebd., S. 335).“
Eine Seite später definiert Hilferding das Finanzkapital als „Kapital in der Verfügung der Banken und in der Verwendung der Industriellen (ebd., S. 336).“ Fritz Kumpf argumentiert, dass in der Definition Hilferdings ein wesentliches Moment (die Verbindung von Bank und Industrie) enthalten ist, die auch in Lenins Definition vorkommt. Hilferding verweist nur allgemein auf die Verflechtung, ohne diesen Zusammenhang näher zu erfassen. Dies führe dazu, dass Hilferding die Abhängigkeit der einzelnen Momente des Finanzkapitals nicht aufdeckt, so Kumpf. Lenin erfasst das Finanzkapital in einer Weise, die es ihm erlaubt, die Bestimmungs- und Abhängigkeitsbeziehungen zwischen einzelnen Elementen, die in das Finanzkapital eingehen, zu verstehen. In Lenins Argumentation stellt der Ausgangspunkt die Konzentration des Kapitals dar, aus der sich mit Notwendigkeit die Monopole entwickeln, die ihrerseits zur Verschmelzung von Bank- und Industriekapital führen (Kumpf 1968, S. 121f.). Dies führt Lenin zu einer Kritik an Hilferdings Definition:
„Diese Definition ist insofern unvollständig, als ihr der Hinweis auf eines der wichtigsten Momente fehlt, nämlich auf die Zunahme der Konzentration der Produktion und des Kapitals in einem so hohen Grade, daß die Konzentration zum Monopol führt und geführt hat (Lenin 1917, S. 230).“
Hilferding fährt weiter fort und erläutert, dass die „Macht der Banken wächst“ und sie von Gründern zu „Beherrscher der Industrie“ werden, „deren Profite sie als Finanzkapital an sich reißen“. In diesem Verhältnis erkennt Hilferding eine Parallele zum alten Wucherkapital, das durch seinen Zins sowohl die Arbeit der Bauern als auch die Rente der Grundherren an sich riss.
„Der Hegelianer könnte von Negation der Negation sprechen: Das Bankkapital war die Negation des Wucherkapitals und wird selbst vom Finanzkapital negiert. Dieses ist die Synthese des Wucher- und Bankkapitals und eignet sich auf einer unendlich höheren Stufe der ökonomischen Entwicklung die Früchte der gesellschaftlichen Produktion an (ebd., S. 337).“
Später schreibt Hilferding davon, dass das Finanzkapital „die Vereinheitlichung des Kapitals“ bedeutet, also dass die früher getrennten Sphären von Industrie-, Kommerziellem- und Bankkapitals jetzt unter der gemeinsamen Leitung der hohen Finanz gestellt werden, die sich aus der „innigen Personalunion“ ergibt – aus der Vereinigung von „Heeren der Industrie und der Banken“ (ebd., S. 445). Das Finanzkapital „in seiner Vollendung“ sieht Hilferding als „die höchste Stufe ökonomischer und politischer Machtvollkommenheit in der Hand der Kapitaloligarchie“, als Vollendung der „Diktatur der Kapitalmagnaten“ (ebd., S. 561f.).
In ähnlicher Weise spricht Bucharin davon, dass durch die verschiedenen Formen des Kredits, des Aktienbesitzes usw. das Bankkapital „in der Rolle eines Organisators der Industrie“ auftritt. Diese „Organisation der Gesamtproduktion des ganzen Landes“ stellt sich umso stärker da, „je stärker die Konzentration der Industrie einerseits, die Konzentration der Banken andererseits ist (Bucharin 1915, S. 75).“
Aus diesen Ausführungen über das Finanzkapital ergibt sich ein Verständnis, das einerseits die Durchdringung der Industrie durch die Banken betont und andererseits deren Rolle bei der Organisation und Lenkung dieser Industrien hervorhebt.
In Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund bezieht sich Kautsky zustimmend auf Hilferding und sieht seine Arbeit als „erste erschöpfende und damit grundlegende Darstellung des Finanzkapitals“ (Kautsky 1915, S. 23). In Kautskys Argumentation sticht eine Trennung von Finanzkapital und Industriekapital hervor – im Unterschied zu der zuvor ausführlichen dargestellten Verschmelzung. So sei das charakteristische Merkmal des Imperialismus „die Verbindung des Finanzkapitals mit dem industriellen Kapital“ (ebd., S. 22). Auch spricht Kautsky davon, dass das industrielle Kapital „andere Tendenzen als das Handels- und Finanzkapital“ zeigt. Denn:
„Es neigt zum Völkerfrieden, zur Beschränkung der absoluten Staatsgewalt durch parlamentarische und demokratische Einrichtungen, nach Sparsamkeit im Staatshaushalt; es ist stets gegen Zölle auf Lebensmittel und Rohmaterial. Selbst den Industriezoll betrachtet es vielfach nur als Erziehungszoll, als ein Ergebnis industrieller Rückständigkeit, das mit dem ökonomischen Fortschritt verschwinden soll (ebd., S. 23).“
Im Gegensatz zum Finanzkapital – das als „Klasse der großen Geldverleiher und Bankiers“ dargestellt wird, welches:
„zur Förderung der absoluten Staatsgewalt, nach gewalttätiger Durchsetzung ihrer Ansprüche nach Innen und Außen [neigt]. Er hat ein Interesse an großen Staatsausgaben und Staatsschulden, wenn diese nicht so weit gehen, den Staat bankrott zu machen. Es steht auf gutem Fuß mit dem großen Grundbesitz und hat gegen dessen Begründung durch agrarische Zölle nichts einzuwenden (ebd., S. 23).“
In Kautsky Darstellung erscheint das Finanzkapital synonym mit dem Bankkapital, welches mit anderen Interessen dem Industriekapital gegenübersteht. Später werden wir sehen, dass Kautsky aus dieser Gegenüberstellung sein Theorem des Ultraimperialismus ableitet.
In Bucharins Imperialismus und Weltwirtschaft findet sich eine interessante Akzentuierung in der Auseinandersetzung mit dem Finanzkapital. Bucharin spricht davon, dass:
„[d]er Prozeß der Internationalisierung, dessen primitivste Form der internationale Warenaustausch, und dessen höchste organisatorische Stufe der internationale Trust ist, dieser Prozeß hat auch eine sehr bedeutende Internationalisierung des Bankkapitals hervorgerufen, soweit dieses sich (durch Finanzierung industrieller Unternehmungen) in Industriekapital verwandelt und auf diese Weise die besondere Kategorie des Finanzkapitals bildet (Bucharin 1915, S. 60).“
Das Finanzkapital, das hier als eine ‚Verwandlung‘ von Bank in Industriekapital beschrieben wird, stellt Bucharin in einen internationalen Kontext. Weiter heißt es, dass die internationalen wirtschaftlichen Beziehungen:
„zahllose Fäden [bilden], die in Tausenden von Knoten verknüpft sind, tausendfältig verflochten sind, um endlich in den Abkommen der größten Banken der Welt zusammenzulaufen, die ihre Fühler über den ganzen Erdball ausstrecken (ebd., S. 62).“
Dies führe dazu, dass der „internationale Finanzkapitalismus und die international organisierte Herrschaft der Banken“ eine unveränderbare Wirklichkeit geworden seien (ebd., S. 62).
Bereits Jeidels machte einige Aussagen über die Rolle der Banken für den internationalen Handel bzw. die internationale Expansion. In Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Entscheidungskompetenzen bei der Industrie oder bei der Bank liegen, beziehungsweise bei welchen Angelegenheiten, welche Seiten das letzte Wort habe, führt er aus:
„[W]enn auch hinter den Banken in den meisten Fällen inländische Unternehmungen stehen, so sind diese doch beim Vordringen ins Ausland viel stärker auf die Banken angewiesen als in ihren inländischen Fabriken. Hier liegt die Sache gerade umgekehrt wie in der Heimat: weiß hier der Industrielle besser Bescheid, weil die technischen Fragen im Mittelpunkt stehen, von denen der Bankier nichts versteht, die ihn auch direkt nichts angehen, so ist dagegen im Ausland die Bank bereits heimisch, hat ihre Niederlassungen, beherrscht den internationalen Zahlungsverkehr, steht vielleicht mit der Regierung des Landes durch Anleihenübernahme in Verbindung; […] Beziehung zu den dortigen Kreisen, vorteilhafte Bedingungen seitens der Regierungen usw. spielen eine verhältnismässig weit größere Rolle. So ist die Bank schon dann, wenn sie wesentlich im Dienst einer großen Unternehmung handelt, stark in eine führende Rolle gedrängt, sie handelt aber ganz selbständig, wenn sie sich eine ausländische Industrie oder die Ausbeutung fremder Bodenschätze sichern will (Jeidels 1905, S. 188f.).
Demnach ist die heimische Industrie beim Vordringen in ausländische Märkte wesentlich stärker auf die Unterstützung der Banken angewiesen als bei der Finanzierung ihrer inländischen Fabriken.
Im Vorwort zur seiner Imperialismus-Broschüre formuliert Lenin die „international organisierte Herrschaft der Banken“ noch radikaler und spricht davon, dass „eine Handvoll […] besonders reicher und mächtiger Staaten […] durch einfaches „Kuponschneidern“ […] die ganze Welt ausplündern (Lenin 1917, S. 198).“ Etwas später fährt Lenin fort und spricht vom „Übergewicht des Finanzkapital über alle übrigen Formen des Kapitals“, was für ihn gleichbedeutend mit der „Vorherrschaft des Rentners und der Finanzoligarchie“ ist und woraus sich „die Aussonderung weniger Staaten, die finanzielle „Macht“ besitzen“, ergebe (ebd., S. 242).
Lenin beschreibt das 20. Jahrhundert als den Wendepunkt „vom alten zum neuen Kapitalismus“, der gleichbedeutend ist mit der entstehenden Herrschaft des Finanzkapitals (ebd., S. 229). In seinem Vorwort zu Bucharins Imperialismus und Weltwirtschaft bestimmt Lenin diesen Wendepunkt vom alten zum neuen Kapitalismus genauer und führt aus, dass auf einer bestimmten Wachstumsstufe der Großindustrie die Industrie in einem Umfang heranfuhr, dass an die Stelle der freien Konkurrenz das Monopol trat. Schließlich heißt es:
„Zum typischen „Herrscher“ der Welt wurde nunmehr das Finanzkapital, das besonders beweglich und elastisch, national wie international besonders verflochten ist, das besonders unpersönlich und von der direkten Produktion losgelöst ist, das sich besonders leicht konzentriert und bereits besonders stark konzentriert hat, so daß buchstäblich einige hundert Milliardäre und Millionäre die Geschicke der ganzen Welt in ihren Händen halten (Lenin 1915b, S. 103).“
In dieser Passage des Vorworts sticht ins Auge, dass Lenin den Prozess beschreibt, aus dem sich das Finanzkapital entwickelt und die Herrschaft des Finanzkapitals selbst genauer charakterisiert. Anstatt von Kuponschneidern spricht Lenin hier von einigen hundert Milliardären und Millionären, die die ganze Welt in ihrer Hand halten und beherrschen.
Dies deckt sich ebenfalls mit der bereits erwähnten Notiz am Ende seines Konspektes zu Hilferding, in denen Lenin die drei wichtigsten Momente des Finanzkapitals notiert: (1) „Entwicklung und Anwachsen des Großkapitals bis zu einer bestimmten Stufe … Rolle der Banken. (Konzentration und Vergesellschaftung)“; (2) „Monopolkapital (Erfassung eines so großen Teils eines bestimmten Industriezweiges, daß die Konkurrenz durch das Monopol abgelöst wird) …“; (3) „Aufteilung der Erde … (Kolonien und Einflußsphären) …“ Zusätzlich ist erwähnenswert, dass Lenin links neben diesen drei Punkten jeweils einen Kommentar hinterlässt. So steht neben dem ersten Punkt „Korporation in Amerika“, neben dem zweiten „Amerika und Deutschland“ und neben dem letzten „Tabelle – und Beispiel Argentinien“ (Lenin 1972, S. 335f.). Dies lässt vermuten, dass Lenin, der hier wieder den Entwicklungsprozess skizziert, vor allem eine internationale Entwicklung im Blick hat und weniger die eines bestimmten Landes.
Zusammenfassung
Bereits im dritten Band des Kapitals tauchen Aussagen auf, in denen vom Aufkommen einer ‚Finanzaristokratie‘ gesprochen wird, die als ‚Parasiten‘ charakterisiert wird.“ Hilferding arbeitet heraus, dass die Abhängigkeit der Industrie von den Banken die Folge der Eigentumsverhältnisse ist. Es besteht ein Wechselverhältnis, in dem die Industrie zunehmend die Verfügungsgewalt eines Teils des Bankkapitals erhält. Die Banken selbst fixieren demnach einen größeren Teil ihres Kapitals in der Industrie und werden zunehmend selbst zu industriellen Kapitalisten. Dieses Verhältnis, bei dem Bankkapital in dieser Weise in industrielles Kapital umgewandelt wird, bezeichnet Hilferding als Finanzkapital (Hilferding 1910, S. 335f.). Hilferding beschreibt demnach bereits den Prozess, der zur Entwicklung des Finanzkapitals führt. In einer ähnlichen Weise geschieht dies auch durch Jeidels, der allerdings nicht den Ausdruck Finanzkapital nutzt. Lenin kritisierte Hilferdings Definition, da ihr das entscheidende Element fehle: das Monopol, das aus der Konzentration der Produktion hervorgeht (Lenin 1917, S. 230). Lenin spitzt den Prozess also weiter zu auf den Begriff des Monopols. Der Begriff des Finanzkapitals und der Begriff des Monopols fallen bei Lenin zusammen. Das Monopol stellt den roten Faden in Lenins Arbeit dar, weil es in jedem Abschnitt im Zentrum der Argumentation steht.
Bucharin arbeitete die Organisierung der Gesamtproduktion des Finanzkapitals heraus und stellte diese in einen internationalen Kontext. Lenin greift diesen Aspekt auf und fokussiert ihn erneut auf den zentralen Punkt des Monopols, das Beherrschung und Unterordnung bedeutet: Eine Handvoll besonders reicher Länder plündert die Welt durch das Kuponschneiden aus, indem einige hundert Millionäre und Milliardäre die Geschicke der Welt in ihren Händen konzentrieren. Dies deutet darauf hin, dass Lenin durch das Finanzkapital zunehmend die internationale Seite des Monopols in den Blick nimmt bzw. die internationale Seite des Monopolbegriffs aufdeckt.
2.2.2 Die Politik und Ideologie des Finanzkapitals
John A. Hobson sieht das „wahre Wesen des Imperialismus“ politisch in der „Überzentralisierung“. Der durch Besteuerung und Wucher „praktizierte Parasitismus bewirkt eine stetig zunehmende Zentralisierung des Regierungsapparates“ und eine gleichzeitig wachsende Belastung der Regierung (Hobson 1902, S. 306).
Bekannter sind Hilferdings Ausführungen über die Politik des Finanzkapitals, die Lenin in seiner Broschüre anführt. Für Hilferding ist die Ideologie des Finanzkapitals dem Liberalismus vollständig entgegengesetzt: „das Finanzkapital will nicht Freiheit, sondern Herrschaft (Hiferding 1910, S. 502f.).“, Lenin greift diese Formulierung auf und führt aus:
„Der außerökonomische Überbau, der sich auf der Grundlage des Finanzkapitals erhebt, seine Politik, seine Ideologie steigern den Drang nach kolonialen Eroberungen. „Das Finanzkapital will nicht Freiheit, sondern Herrschaft“, sagt Hilferding mit Recht (Lenin 1917, S. 266f.).“
Hilferding spricht weiter davon, dass das Finanzkapital „keinen Sinn für die Selbstständigkeit des Einzelkapitalisten [hat], sondern […] seine Bindung [verlangt].“ Es will die Organisation anstatt der Anarchie der Konkurrenz, um auf immer höherer Stufenleiter die Konkurrenz aufnehmen zu können. Um diese durchzusetzen und „seine Übermacht zu erhalten und zu vergrößern“, ist das Finanzkapital auf den Staat angewiesen:
„Es braucht einen politisch mächtigen Staat, der in seiner Handelspolitik nicht auf die entgegengesetzten Interessen anderer Staaten Rücksicht zu nehmen braucht. Es bedarf schließlich eines starken Staates, der seine finanziellen Interessen im Ausland zur Geltung bringt, seine politische Macht einsetzt, um den kleineren Staaten günstige Lieferungsverträge und günstige Handelsverträge abzunötigen. Einen Staat, der überall in der Welt eingreifen kann, um die ganze Welt in Anlagesphären für sein Finanzkapital verwandeln zu können. Das Finanzkapital braucht endlich einen Staat, der stark genug ist, um Expansionspolitik treiben und neue Kolonien sich einverleiben zu können (Hilferding 1910, S. 502f.).“
Zentral in Hilferdings Ausführung ist der Zusammenhang zwischen Finanzkapital, Expansionspolitik, Ideologie und Staat. So spricht Hilferding davon, dass „die Politik des Finanzkapitals die energischste Expansion und die beständige Jagd nach neuen Anlagesphären und neuen Absatzmärkten“ bedeutet (ebd., S. 518). Dieses „Verlangen nach Expansionspolitik“ führe ideologisch zu einer Revolutionierung der Weltanschauung des Bürgertums. Das Friedensideal verblasse und an die Stelle „der Idee der Humanität tritt das Ideal der Größe und Macht des Staates.“ Der nationale Gedanke wandele sich und werde zum „Gedanken der Erhöhung der eigenen Nation über die anderen.“ Das neue Ideal sei es, „der eigenen Nation die Herrschaft über die Welt zu sichern“ (ebd., S. 503f.). Ideologisch wird nicht mehr „das Recht jeder Nation auf politische Selbstbestimmung und Unabhängigkeit anerkannt“. Die ökonomische Bevorzugung des Monopols spiegelt sich „in der bevorzugten Stellung, die der eigenen Nation zukommen muß“ wider (ebd., S. 504).
Bucharin charakterisiert das „Hauptmotiv der Eroberungspolitik“ als die Verschärfung der Konkurrenz um Absatzmärkte, Rohstoffmärkte und im Gebiet der Kapitalanlage. Die Eroberungspolitik ist die Folge „der jüngsten Entwicklung des Kapitalismus und seiner Umwandlung in den Finanzkapitalismus“ (Bucharin 1915, S. 113).
In Bucharins Imperialismus und Weltwirtschaft finden wir eine knappe Zusammenfassung, in welcher erläutert wird, wie sich der Großbetrieb durchgesetzt hat und die „Kapitalmagnaten“ in einer „ehernen Organisation“ zusammengefasst, „die das gesamte Wirtschaftsleben beherrscht“:
„Die Herrschaft wird durch eine Finanzoligarchie ausgeübt, die die Produktion, welche durch die Banken in einem Knotenpunkt zusammengefaßt wird, leitet. Dieser Prozeß der Organisation der Produktion erfolgte von unten auf und wurde im Rahmen der modernen Staaten verankert, die die Interessen des Finanzkapitals direkt zum Ausdruck bringen. Jede im kapitalistischen Sinne dieses Wortes entwickelte „Volkswirtschaft“ hat sich in eine Art von national“-staatlichem Trust verwandelt (Bucharin 1915, S. 118f.).“
Später wird davon gesprochen, dass das Finanzkapital die Wirtschaft „in einen einzigen gewaltigen kombinierten Trust“ verwandelt, dessen Teilhaber die „Finanzgruppen und der Staat“ sind. Bucharin bezeichnet diese Entwicklung als staatskapitalistischen Trust und präzisiert anschließend, dass es unmöglich ist, sie mit der Struktur eines Trusts im engeren Sinne des Wortes gleichzusetzen. Dennoch haben sich die „wirtschaftliche entwickelten Staaten“ an den Punkt genähert, „wo man sie als eine Art von trustähnlichen Organisationen“ bezeichnen kann (ebd., S. 131).
Im Gegensatz zur Bezeichnung „staatskapitalistischer Trust“ verwendet Lenin an verschiedenen Stellen den Begriff „Staatsmonopol“, ohne ihn jedoch so ausführlich zu erläutern wie Bucharin. Lenin argumentiert in seiner Broschüre ähnlich wie Hilferding und schreibt, dass sich „auf dem Boden der ökonomischen Aufteilung der Welt“ durch die Kapitalistenverbände sowie in Verbindung mit den politischen Verbänden (dem Staat) „bestimmte Beziehungen herausbilden auf dem Boden der territorialen Aufteilung der Welt“, insbesondere im Kampf um Kolonien und Wirtschaftsgebiete (Lenin 1917, S. 258).
Zusammenfassung
In Auseinandersetzung mit dem Finanzkapital sprach Hilferding von der Bedeutung eines mächtigen Staates, der in der Lage ist, überall in der Welt einzugreifen und eine Expansionspolitik zu betreiben. Bucharin deckte das Hauptmotiv dieser Eroberungspolitik auf: die sich verschärfende Konkurrenz auf dem Weltmarkt. In Bucharins Argumentation ist die Entstehung von einem nationalstaatlichen Trust zentral, also die Vorstellung von der die Wirtschaft eines Landes als ein einziger Trust, dessen Inhaber die nationalen Finanzgruppen und der Staat sind. Lenin fügt diesen beiden Aspekten nichts Neues hinzu. Er referiert explizit auf Hilferding (‚das Finanzkapital will nicht Freiheit, sondern Herrschaft‚) und spricht in Anlehnung an Bucharin vom Staatsmonopol. Wenn auch der Unterschied nur graduell wirkt, ist es dennoch interessant, dass Lenin vom ‚Monopol‘ anstatt ‘Trusts‘ spricht. Im Staatsmonopol laufen demnach die bisherigen Analyseschritte des Verwachsens von Industrie, Banken und dem Staat, als auch die Seite der internationalen Herrschaft zusammen. Das Staatsmonopol erscheint als Wirkung des Verwachsens und Bedingung für die Expansion.
2.3 (Neu-) Aufteilung der Welt
Das folgende Unterkapitel wird auf die (Neu-)Aufteilung der Welt eingehen. Dafür wird ein Blick auf die Themen des Kapitalexports, der Entwicklung des Außenhandels und des Expansionismus geworfen, aber auch auf die Unterdrückung durch das Finanzkapital eingegangen.
2.3.1 Der Kapitalexport
In Lenins Imperialismus-Broschüre bildet der Kapitalexport den Ausgangspunkt für die Aufteilung der Welt unter den Kapitalverbänden und Großmächten.
Bereits im dritten Band des Kapitals taucht an mehreren Stellen der Kapitalexport auf. Marx spricht davon, dass der Grund, weshalb Kapital ins Ausland geschickt wird, nicht darin besteht, dass es „absolut nicht im Inland beschäftigt werden könnte.“ Kapital wird exportiert, „weil es zu höherer Profitrate im Auslande beschäftigt werden kann.“ Das exportierte Kapital ist im gegebenen Land absolut überschüssig für die Beschäftigung der Arbeiterklasse. Das Kapital „existiert als solches neben der relativ überschüssigen Bevölkerung“ (Marx 1894, S. 266).
Wenige Jahre später lesen wir 1902 bei Hobson, dass sich in jeder fortgeschrittenen Industrienation die Tendenz zeigt, „einen größeren Anteil ihres Kapitals außerhalb ihrer eigenen politischen Grenzen, in fremden Ländern oder Kolonien anzulegen“ und daraus ein wachsendes Einkommen zu erhalten (Hobson 1902, S. 71). Weiter heißt es bei Hobson in Bezug auf Großbritannien, das Einkommen aus Zinserträgen von Auslandsinvestitionen übersteige das Einkommen „aus dem gewöhnlichen Export- und Importhandel“. Hinzukommt, dass das Einkommen aus Auslandsinvestitionen sehr schnell wächst, wohingegen der Kolonialhandel und die Gewinne aus ihm nur langsam ansteigen (ebd., S. 72).
Hobson analysierte, wie die Kolonien für den Imperialismus nicht mehr die entscheidende Rolle spielten und andere Formen der Abhängigkeit (hier der Kredit), an Bedeutung zunehmen.
Bucharin spricht von der besonderen Bedeutung der Großbanken für den Kapitalexport. So heißt es etwa, dass die internationalen Verbindungen dieser „nationalen“ Organisationen sehr stark sind (Bucharin 1915, S. 49). Im Verlauf der Untersuchung heißt es dann, dass durch den Kapitalexport durch Privatpersonen und „industrielle Gesellschaften oder Banken“ der Export von Waren aus dem Mutterland zunimmt, da eine gewisse Nachfrage erzeugt wird. Die „ausländischen“ Unternehmungen werden durch die größten Banken oder Bankkonsortien finanziert. Bucharin führt das Beispiel der Deutschen Bank an, die die Bagdadbahn baute und dafür in der Türkei auf deutsches Material für den Eisenbahnbau zurückgriff und „ein ganzes Netz von Marktbeziehungen [schuf], in das gerade deutsche Waren leicht eindringen […] [konnten]“ (ebd., S. 108f.).
Lenin beschreibt ebenfalls den Zusammenhang zwischen Kapital- und Warenexport. Er spricht davon, dass das Finanzkapital „die Epoche der Monopole“ erzeuge. So werde bei einer Anleihe die Bedingung gestellt, dass diese „zum Kauf von Erzeugnissen des kreditgebenden Landes“ (wie Waffen, Schiffe usw.) genutzt werden. Als Beispielland wird Frankreich angeführt, das in den letzten zwei Jahrzehnten (1890-1910) das Mittel des an Bedingungen geknüpften Kredits sehr häufig genutzt habe. Daraus folgert Lenin, dass der Kapitalexport zu einem Mittel wird, den Warenexport zu fördern (Lenin 1917, S. 248).
In Hilferdings Finanzkapital erfährt der Leser mehr über den Zusammenhang von Monopolverbänden (um bei Lenins Bezeichnung zu bleiben) und dem Kapitalexport. Hilferding beschreibt, dass Kartelle eine Verlangsamung von Kapitalanlagen bedeuten, da die erste Maßregel des Kartells „die Einschränkung der Produktion ist“ und in nicht kartellierten Industrien vor Anlagen zurückgeschreckt wird, weil es zu einer Senkung der Profitrate komme. Dies führe dazu, dass auf der einen Seite die Masse des zur Akkumulation bestimmten Kapitals schnell anwächst, während andererseits die Anlagemöglichkeiten zurückgehen:
„Dieser Widerspruch verlangt seine Lösung und findet sie im Kapitalexport. Der Kapitalexport selbst ist nicht eine Folge der Kartellierung. Er ist eine Erscheinung, die von der kapitalistischen Entwicklung unzertrennlich ist. Aber die Kartellierung steigert plötzlich den Widerspruch und schafft den akuten Charakter des Kapitalexports (Hilferding 1910, S. 348f.).“
Auch Bucharin spricht davon, dass der Kapitalexport die Überproduktion (d.h. Überakkumulation) voraussetzt. Nach Bucharin ist die Bedingung für den Kapitalexport, dass zusätzliches Kapital im Ausland einen höheren Profit erzielt als im Inland. Deswegen sei es auch nachvollziehbar, dass man fast bei dem „ganzen Verlauf der kapitalistischen Entwicklung Kapitalexport antreffe“. Aber der Kapitalexport hat „gerade in den letzten Jahrzehnten eine ganz außerordentliche Bedeutung erlangt“, die er früher nie besessen habe. Der Kapitalexport habe in einem bestimmten Maß einen neuen Typ an wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern geschaffen (Bucharin 1915, S. 104). An dieser Stelle wird der Unterschied zu der Zeit, die Marx im Blick hatte, deutlich.
In Lenins Imperialismus-Broschüre heißt es, dass an der Schwelle zum 20. Jahrhundert eine neue Form der Monopolbildung zu beobachten ist. Zum einen entstehen Monopolverbände in allen Ländern „des entwickelten Kapitalismus“, zum anderen etabliert sich die Monopolstellung einiger weniger, überaus reicher Länder, in denen die Kapitalakkumulation ein enormes Ausmaß erreicht hat. Daraus folgte, dass „ein ungeheurer „Kapitalüberschuß“ in den fortgeschrittenen Ländern“ entstand (Lenin 1917, S. 245).
Hilferding definiert den Kapitalexport als „Ausfuhr von Wert, der bestimmt ist, im Ausland Mehrwert zu hecken“. Um Kapitalexport handelt es sich nach dieser Definition lediglich dann, wenn das im Ausland verwendete Kapital in der Verfügung des Inlandes bleibt und „über den durch dieses Kapital erzeugten Mehrwert von inländischen Kapitalisten verfügt werden kann“ (Hilderding 1910., S. 468).
Der Kapitalexport ist unabhängig von der Warenproduktion des noch unterentwickelten Landes. Hilferding bestimmt die Grenze des Kapitalexports in zweifacher Hinsicht: einerseits findet er seine Grenzen den kapitalistischen Entwicklungsmöglichkeiten des unterentwickelten Landes. Andererseits in der Kapitalakkumulation, also dem Überschuss an produktivem Kapital in dem entwickelten Land (ebd., S. 412).
Hilferding nimmt eine Differenzierung des Kapitalexports in zwei Formen vor: „Das Kapital wandert in Ausland als zinstragendes oder als profitragendes Kapital.“ Letzteres kann als industrielles, Handels- oder Bankkapital fungieren. Für das kapitalimportierende Land ist von Bedeutung, aus welchen Teilen des Mehrwerts der Zins gezahlt wird. Hilferding erläutert, dass:
„[d]er Zins, der auf im Auslande befindliche Pfandbriefe zu entrichten ist, bedeutet, daß ein Teil der Grundrente, der Zins, der auf Obligationen industrieller Unternehmungen zu entrichten ist, daß ein Teil des industriellen Profits ins Ausland fließt (ebd., S. 468f.).“
Weiter heißt es bei Hilferding zu den beiden Formen des Kapitalexports, dass es für ein Land schon rein quantitativ von Vorteil sei, „sein Kapital in Form von profittragendem als in Form von zinstragendem“ zu exportieren, da der Profit größer sei als der Zins. In dieser Form bleibt die Verfügung über das exportierte Kapital eine unmittelbare und die Kontrolle eine direkte. Auf der anderen Seite schreibt Hilferding am Beispiel der amerikanischen Eisenbahnbonds, dass der Einfluss des englischen Kapitals (welches als zinstragendes Kapital angelegt ist) auf die amerikanischen Eisenbahnherren ein minimaler ist, wohingegen er dort ausschlaggebend ist, „wo das industrielle Unternehmen selbst mit englischem Kapital betrieben wird.“ Vor allem die Kartelle und Trusts sind es, die den industriellen Kapitalexport betreiben. Hilferding führt hierfür mehrere Gründe an. Einerseits sind die Kartelle und Trusts in der Schwerindustrie dort am stärksten, wo der Drang nach Kapitalexport am stärksten ist, „um neue Absatzmärkte für die eigene riesig anschwellende Produktion zu gewinnen.“ Die Ausdehnung im Inlandsmarkt steht den hohen Kartellpreisen entgegen, so dass die äußere Expansion die beste Möglichkeit ist, dem Ausdehnungsbedürfnis nachzukommen. Hilferding geht dann auf das Verhältnis der Monopolverbände und den Banken sowie auf die Beziehungen zwischen den imperialistischen Staaten ein:
„Zugleich ist hier die Verknüpfung von Banken und Industrie am engsten, und die Möglichkeit des Gründergewinns durch Emission der Aktien von Unternehmungen wird ein starkes Motiv zum Kapitalexport. […] Dies erklärt die eigentümliche Erscheinung, daß diese Staaten einerseits Kapital exportieren, anderseits das für die eigene Volkswirtschaft nötige Kapital zum Teil vom Ausland importieren. Sie exportieren vor allem industrielles Kapital und erweitern so die eigene Industrie, deren Betriebskapital sie zum Teil in Form von Leihkapital aus Ländern mit langsamerer industrieller Entwicklung, aber mit größerem akkumulierten Kapitalreichtum beziehen. […] So exportieren die Vereinigten Staaten in größtem Maßstab industrielles Kapital nach Südamerika, während sie gleichzeitig Leihkapital aus England, Holland, Frankreich usw. importieren, in Form von Bonds und Obligationen zum Betrieb ihrer eigenen Industrie (ebd., S. 485f.).“
Erfahren wir durch Jeidels mehr über das Verhältnis zwischen Bank- und Industriekapital in Bezug auf die Entscheidungsgewalt, im Prozess des Kapitalexports, geht Hilferding genauer auf die historischen Hintergründe ein. Hervorsticht an der angeführten Stelle seine Ausführung zu den USA und dem Verhältnis der beiden Formen des Kapitalexports in ihrem Prozess der weiteren Ausdehnung.
Die Differenzierung der zwei Formen des Kapitalexports erklärt Hilferding anhand der „Ungleichheit der industriellen Entwicklung“. Die Erschließung von industriell rückständigen oder sich langsam entwickelnden Ländern, fällt jenen Ländern zu, „in denen die industrielle Entwicklung, sowohl was die technische als auch was die organisatorische Seite anlangt, die höchste Form erreicht hat.“ Zu den am höchsten entwickelten Ländern zählt Hilferding Deutschland und die Vereinigten Staaten und „in zweiter Linie England und Belgien“. Die anderen, älteren kapitalistischen Länder betreiben Kapitalexport mehr in der Form des Leihkapitals, als dass sie Fabriken errichten:
„Das führt dazu, daß zum Beispiel französisches, holländisches, im hohen Maße aber auch englisches Kapital zum Leihkapital wird für Industrien unter deutscher und amerikanischer Leitung. So entstehen Tendenzen zu einer Solidarität internationaler Kapitalsinteressen (ebd., S. 498).“
Die Ausführung Hilferdings deutet auf eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den Großmächten hin, die sich aus ihrer Stärke ergibt.
Hobson schreibt beispielsweise in Bezug auf Großbritannien, dass in der neueren Zeit die Kapitalinvestition und die Organisierung „der eingeborenen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft“ eine entscheidende Rolle spielen (Hobson 1902, S. 220). Aus den anfänglichen Handelsniederlassungen wurde eine gewerbliche Siedlung, an die sich Grundstücks- und Grubenkonzessionen angeschlossen haben:
„Eine solche Siedlung bedurfte einer Truppe zu ihrem Schutz und um weitere Konzessionen zu erringen; sie dienten auch dazu, Vertragsverletzungen oder Friedensbrüche zu verhindern oder zu bestrafen. Andere Interessen, politische und religiöse, traten in stärkerem Umfang hinzu. Die ursprüngliche Handelsniederlassung nimmt so allmählich einen mehr politischen und militärischen Charakter an. Gewöhnlich werden die Zügel der Regierung schließlich von der Gesellschaft an den Staat übergeben, und ein unscharf definiertes Protektorat geht so gradweise in die Form einer Kolonie über (ebd., S. 221).“
Hobson beschreibt hier, wie im Falle Großbritanniens der Kapitalexport mit einer weiteren Kolonialisierung einher ging.
Bucharin differenziert ähnlich wie Hilferding die beiden Formen des Kapitalexports in zinstragend und profitbringend. Es wird angeführt, dass sie die „wichtigsten Elemente des Prozesses der Internationalisierung des Wirtschaftslebens und des Wachstums der Weltwirtschaft darstellen (Bucharin 1915, S. 40).“ Die Form des zinstragenden Kapitalexports wird von ihm in fünf Unterformen unterschieden: (1) staatliche und kommunale Anleihen: Der immer größer werdende Staatshaushalt erzeugt durch die Entwicklung des Wirtschaftslebens und durch die Militarisierung der gesamten Wirtschaft einen immer größeren Bedarf an ausländischen Anleihen. Auch das Wachstum von Städten und ihr Ausbau erfordert immer größere Geldsummen, die durch ausländische Anleihen gedeckt werden. (2) Das System der „Beteiligung“: „eine (industrielle, Handels- oder Bank-) Unternehmung im Lande A besitzt Aktien oder Obligationen eines Unternehmens im Lande B.“ (3) Die Finanzierung von ausländischen Unternehmungen: Bucharin führt als Beispiele eine Bank an, die eine von ihr selbst oder einer anderen Institution gegründeten ausländischen Unternehmung finanziert; auch ein industrielles Unternehmen, das eine Tochtergesellschaft finanziert zählt Bucharin unter diese Unterform des zinstragenden Kapitalexports. (4) Der Kredit, der unabhängig von einem bestimmten Zweck von einer Großbank eines Landes einer Bank eines anderen Landes gewährt wird. (5) der Aufkauf von ausländischen Aktien usw. „zum Zwecke ihres Weiterverkaufs (siehe die Tätigkeit der Emissionsbanken) usw.“. Diese Form „führt im Gegensatz zu den anderen zu keiner dauernden Interessensverbindung“ (ebd., S. 40f.).
Bucharin macht eine wichtige Bemerkung zu den Folgen des Kapitalexports. Er stellt fest, dass dieser ähnlich wie der internationale Warenverkehr die nationalen Preise in den Weltpreisen, sowie die Unterschiede im Arbeitslohn ausgleichen, die Bewegung des Kapitals „die Tendenz zur Ausgleichung der „nationalen“ Profitraten und bringt nichts anderes als eine der allgemeinsten Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise im Weltmaßstab zum Ausdruck (ebd., S. 45).“
Im Kapitalexport sieht Bucharin die „Inbesitznahme und Monopolisierung neuer Sphären“ zur Anlage von Kapital, durch monopolistische Unternehmen einer Großmacht, oder in der Gesamtheit die organisierte nationale Industrie durch das nationale Finanzkapital. Es heißt:
„Der Kapitalexport stellt die bequemste Methode der Wirtschaftspolitik der Finanzgruppen dar, da er am leichtesten zur Unterwerfung neuer Gebiete führt. Das ist der Grund, weshalb die Verschärfung der Konkurrenz unter den verschiedenen Staaten hier besonders krasse Formen annimmt. So führt die Internationalisierung des Wirtschaftslebens auch hier unvermeidlich zu einer Entscheidung der strittigen Fragen durch Feuer und Schwert (Bucharin 1915, S. 111f.).“
Lenin beschreibt den Kapitalexport als solide Basis für die „imperialistische Unterdrückung“ und „Ausbeutung der meisten Nationen und Länder der Welt“ (Lenin 1917, S. 246).
Abschließend sei auf den Zusammenhang von Kapitalexport und kapitalistischer Entwicklung hingewiesen. Sowohl Hilferding als auch Lenin führen diesen an. Bei Hilferding heißt es:
„So erweitert der Kapitalexport jene Schranke, die aus der Konsumtionsfähigkeit des neuen Marktes entspringt. Zugleich aber bewirkt die Übertragung kapitalistischer Transport- und Produktionsmethoden auf das fremde Land hier eine rasche ökonomische Entwicklung, die Entstehung eines größeren inneren Marktes durch Auflösung der naturalwirtschaftlichen Zusammenhänge, die Ausdehnung der Produktion für den Markt und damit die Vermehrung jener Produkte, die ausgeführt werden und damit wieder zu neuer Verzinsung neu importierten Kapitals dienen können. Bedeutete die Erschließung von Kolonien und neuen Märkten früher vor allem die Erschließung neuer Konsumtionsmittel, so wendet sich heute die Neuanlage von Kapital hauptsächlich Zweigen zu, die Rohmaterial für die Industrie liefern (Hilferding 1910, S. 472f.).“
In dem von Hilferding beschriebenen Zusammenhang ergibt sich ein Bild eines dauerhaften Kapitalflusses, da die Kapitalvermehrung wieder für neue Kredite genutzt werden können. Auffällig ist auch die unterschiedliche Schwerpunktsetzung, wobei der Kapitalexport sich vor allem auf Branchen konzentriert, die Rohmaterial liefern und in denen dadurch eine kapitalistische Entwicklung vorangetrieben wird.
Bei Lenin können wir lesen, dass der Kapitalexport die Länder, in der er abfließt, beeinflusst und die kapitalistische Entwicklung dort „außerordentlich beschleunigt“. Er sorgt für eine weltweite „Ausdehnung und Vertiefung der weiteren Entwicklung des Kapitalismus“ (Lenin 1917, S. 247). In Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung heißt es bei Lenin zu dieser Entwicklung:
„Der Imperialismus hat hier [in den Kolonien] Wandel geschaffen. Imperialismus bedeutet unter anderem auch Kapitalexport. Die kapitalistische Produktion wird in immer beschleunigterem Tempo auch in die Kolonien verpflanzt. Sie aus ihrer Abhängigkeit vom europäischen Finanzkapital herauszureißen ist unmöglich (Lenin 1916a, S. 344f.).“
In seiner Imperialismusschrift heißt es dann in Bezug zum Kapitalexport:
„Ganz besonders muß auf die Rolle eingegangen werden, die bei der Schaffung des internationalen Netzes der Abhängigkeiten und der Verbindungen des Finanzkapitals der Kapitalexport spielt (Lenin 1917, S. 244).“
Hieraus wird ersichtlich, dass Lenin zwar eine gewisse Tendenz der kapitalistischen Entwicklung in den kolonisierten Ländern beschrieb, diese aber in keinem Gegensatz zur weltweiten Herrschaft des Finanzkapitals begriff. Es soll im nächsten Unterkapitel auf die weitere Ausdehnung des Kapitalismus und die Unterdrückung durch das Finanzkapital eingegangen werden.
Zusammenfassung
Bereits bei Marx tauchten Bemerkungen über den Kapitalexport auf. Es wird beschrieben, wie Kapital exportiert wird, weil es im Ausland höhere Profite abwirft. Auch Hobson spricht davon, dass größere Teile vom Kapital im Ausland und den Kolonien angelegt werden, um größere Einkünfte zu erzielen. Bei Hobson finden sich bereits Andeutungen, dass die britischen Kolonien nicht mehr die entscheidende Form der staatlichen Abhängigkeit sind und andere Formen wichtiger werden. Jeidels setzte sich mit der Rolle und der Bedeutung der Banken für den Kapitalexport auseinander und arbeitete die Abhängigkeit der Industrie von den Banken in diesem Zusammenhang heraus. Hilferding beschrieb den Widerspruch, den es zu lösen gilt: Einerseits wächst die Masse des akkumulierten Kapitals, während andererseits die Anlagemöglichkeiten abnehmen. Die Lösung liegt im Kapitalexport. Er bestimmte die Grenze des Kapitalexports in einer zweifachen Weise durch die kapitalistischen Entwicklungsmöglichkeiten der Länder, in die das Kapital exportiert wird, sowie durch den Überschuss an Kapital für den Export selbst. Hilferding beschrieb zwei unterschiedliche Formen des Kapitalexports (zinstragender und profitragender), deren Ursache die ungleichmäßige industrielle Entwicklung darstellt. Die industrielle Erschließung von nicht entwickelten Ländern fällt jenen zu, die industriell sowohl technisch als auch organisatorisch am höchsten entwickelt sind. Dies führte dazu, dass französisches und englisches Leihkapital unter die Leitung Deutschlands oder den USA gerät, da sie auf Grundlage dieses Leihkapitals produktive Investitionen tätigen. Bucharin differenziert die zwei Formen des Kapitalexports weiter in Unterformen. Er arbeitet den Kapitalexport als das wichtigste Element in den internationalen Beziehungen und des Wachstums der Weltwirtschaft heraus. Es wird der Zusammenhang zwischen dem Kapitalexport und dem Warenexport beschrieben – ersterer kurbelt letzteren an. Er beschreibt den Kapitalexport als die leichteste Methode der Unterwerfung durch das Finanzkapital. Der Kapitalexport führt zur Inbesitznahme und Monopolisierung neuer Sphären durch das Finanzkapital, so Bucharin.
Lenin spricht davon, dass der Zusammenhang zwischen Waren- und Kapitalexport die Epoche des Finanzkapitals erzeugt. Lenin arbeitet sehr prägnant zwei Seiten des Kapitalexports auf dem Weltmarkt heraus: auf der einen Seite die rasche internationale kapitalistische Ausdehnung und Entwicklung; auf der anderen Seite die damit einhergehende Unterdrückung und Ausbeutung der meisten Länder der Welt, durch einige wenige (Handvoll) Länder. In der Herausstellung dieser beiden Seiten des Kapitalexports herrscht zwischen Lenin und Bucharin große Übereinstimmung. Lenin beschreibt, wie der Kapitalexport als ein Mittel dient, die neuen internationalen Verhältnisse des Finanzkapitals zu schaffen: Ein Netz aus Abhängigkeiten durch das Finanzkapital. Der Unterschied zu den früheren Arbeiten anderer Autoren liegt darin, dass sich Lenin auf die wesentlichen Seiten konzentriert (Entwicklung bei gleichzeitiger Abhängigkeit) und konkretere Erläuterungen von verschiedenen Formen und Facetten ausspart.
2.3.2 Außenhandel, Expansionismus und (koloniale) Unterdrückung
In Der Imperialismus führt Hobson in Bezug auf Großbritannien aus, dass die britische imperiale Ausdehnung nicht von einer „Zunahme des Werts unseres Handels mit unseren Kolonien“ und anderen abhängigen Gebieten begleitet war. Stattdessen nahm der Außenhandel mit den Industrieländern zu, die „als unsere wirtschaftlichen Feinde“ betrachtet werden können. Durch die britische Expansionspolitik wurden sie auch „zu unseren politischen Feinden“ (Hobson 1902, S. 57f.). An späterer Stelle heißt es dann, dass „die kostspieligen Annexionen tropischer Gebiete in jüngster Zeit nur magere und ungesicherte Märkte gebracht haben“ und das der gesamte Handel mit den Kolonien Großbritanniens „praktisch stagniert“ und sich der progressivste Handel mit den „konkurrierenden Industrienationen“ vollziehe, „deren Gebiet wir nicht annektieren wollen“ und in deren „Märkte wir nicht gewaltsam eindringen können“ (ebd., S. 85). Hilferding führt ebenfalls das Beispiel Großbritannien an und erwähnt, dass das britische Industrie- und Handelskapital am Freihandel anderer Länder interessiert ist und nur ein „geringes Interesse an dem Besitz der Kolonien“ hat. Denn insofern die Kolonien Absatzmärkte für Industrieprodukte und Einkaufsmärkte für Rohstoffe waren, hatte Großbritannien auch unter dem Freihandel mit keiner nennenswerten Konkurrenz zu rechnen. Weiter heißt es, dass:
„[d]ie Forderung einer aktiven Kolonialpolitik, die sehr kostspielig war, die Steuern erhöhte und das parlamentarische Regime im Heimatland schwächte, […] hinter der Propaganda des Freihandels [zurücktrat] (Hilferding 1910, S. 448).“
Hilferding stellt direkt klar, dass die Forderung nach der Aufgabe der Kolonien lediglich eine von radikalen Freihändlern blieb, weil wichtige Kolonien wie Indien nicht nur als Markt von Bedeutung waren. Denn die Beherrschung dieser Kolonien sicherte den großen Klassen immense Einkünfte als „Tribut für gute Regierung“. Gleichzeitig war die Sicherheit dieses für Großbritannien wichtigsten Marktes die Voraussetzung für den Absatz britischer Waren und es war nach Hilferding fraglich, ob die Aufgabe der Kolonien nicht das „Wiederaufleben alter Kämpfe mit sich bringen müßte“ (ebd., S. 448f.).
Bei Hobson kann mehr über den Aufbau des britischen Kolonialsystems nachgelesen werden. Dieser unterscheidet drei Klassen von „Kolonialbesitzungen“: (1) Kronkolonien, also jene, in denen die britische Krone die Gesetzgebung ausübt, während die Verwaltung durch die britische Regierung ausgeführt wird; (2) Kolonien, die zwar repräsentative Institutionen, aber keine Regierung besitzen, die britische Krone nur ein Vetorecht bei der Gesetzgebung hat und die britische Regierung die öffentlichen Angelegenheiten regelt; (3) Kolonien, die repräsentative Institutionen und eine Regierung haben, in denen die Krone nur ein Vetorecht hat, aber die britische Regierung keine Beamten vor Ort hat, mit Ausnahme des Gouverneurs. Der britische Imperialismus habe keine einzige Kolonie errichtet, die mit einer Selbstregierung ausgestattet ist. Zwar würden einige dieser Gebiete als Protektorate oder abhängige Staaten ein gewisses Maß von Selbstregierung vorweisen, aber nicht in den wichtigsten politischen Angelegenheiten. Großbritannien würde die „Zügel der willkürlichen Kontrolle“ immer mehr anziehen, so dass die Gebiete der Sache nach Kronkolonien seien (Hobson 1902, S49f.). Indien wird von Hobson als ein Vasallenstaat beschrieben, in dem das Imperium sich auf die Leitung der Außenpolitik, den militärischen Schutz beschränkt und ein Veto im Falle schwerer innerer Unruhen einlegen konnte: „Die eigentliche Verwaltung des Landes wird in den Händen eingeborener Fürsten oder Häuptlinge belassen (ebd. S.119).“ Trotz dieses ‚Experiments‘, wie es an früherer Stelle in Bezug auf Indien heißt (ebd., S. 50), stütze dieses nicht eine Theorie, nach der das „britische Weltreich als ein […] Erzieher zu freien politischen Institutionen“ auftrete (ebd., S. 119), weil die meisten Untertanen dieses Weltreichs in Kronkolonien und Protektoraten leben.
Im weiteren Verlauf seines Buches führt Hobson aus, dass die imperiale Expansion nicht abgeschlossen ist:
„Die häufig gemachte Feststellung, das Werk der imperialen Expansion sei praktisch abgeschlossen, ist nicht zutreffend. Wahr ist wohl, daß die meisten »rückständigen« Rassen in irgendeine Art von Abhängigkeit von dieser oder jenen »zivilisierten« Macht geraten sind – als Kolonie, Protektorate, Hinterland oder Einflußsphäre. Doch in den meisten Fällen ist damit das Imperium noch nicht fertig, vielmehr beginnt erst der Prozeß der Imperialisierung. Das intensive Wachstum des Imperiums, bei dem die Einmischung verstärkt und die Regierungsgewalt über Einflußsphären und Protektorate gestrafft wird, ist ein ebenso gewichtiger und ebenso gefährlicher Aspekt des Imperialismus wie das extensive Wachstum durch Unterwerfung neuer Gebiete und Völkerschaften (ebd., S. 199).“
Rosa Luxemburg beschäftigte sich mit der Frage des Expansionismus und der Rolle von Kolonien. Ihr zentrales Argument ist, dass für die Realisierung des Mehrwerts ein „Kreis von Abnehmern außerhalb der kapitalistischen Gesellschaft“ notwendig ist:
„Das Entscheidende ist, daß der Mehrwert weder durch Arbeiter noch durch Kapitalisten realisiert werden kann, sondern durch Gesellschaftsschichten oder Gesellschaften, die selbst nicht kapitalistisch produzieren (Luxemburg 1913, S. 300).“
Luxemburg unterscheidet zwei Fälle: (1) Wenn kapitalistische Staaten Konsumtionsmittel über den eigenen Bedarf hinaus produzieren, „deren Abnehmer nichtkapitalistische Schichten und Länder sind“. Als Beispiel nennt sie die englische Baumwollindustrie, deren Maschinenproduktion in England zunehmend ausgeweitet wurde. Dadurch realisierte die Abteilung II (Konsumtionsmittel) ihren Mehrwert zunehmend außerhalb des kapitalistischen Systems und steigerte durch ihre eigene Akkumulation die Nachfrage nach einheimischen Produkten der Abteilung I (Produktionsmittel).
(2) Umgekehrt tritt der Fall ein, in dem Produktionsmittel an nichtkapitalistische Länder geliefert werden. Luxemburg nennt als Beispiele den Eisenbahnbau in Amerika und Australien sowie die deutsche Chemieindustrie, die Farbstoffe nach Asien und Afrika exportierte.
Diese Erweiterung der Abteilung I durch die außerkapitalistischen Kreise, bringt in den kapitalistischen Ländern eine Erweiterung der Abteilung II hervor (ebd. S.300ff.). Die Beispiele führt Luxemburg zu ihrer allgemeinen Schlussfolgerung:
„Was durch die obigen Beispiele klargemacht werden sollte, ist die Tatsache, daß zum mindesten der zu kapitalisierende Mehrwert und der ihm entsprechende Teil der kapitalistischen Produktenmasse unmöglich innerhalb der kapitalistischen Kreise realisiert werden kann und unbedingt außerhalb dieser Kreise, in nichtkapitalistisch produzierenden Gesellschaftsschichten und -formen, seine Abnehmer suchen muß (ebd., S. 308).“
Sie führt weiter aus, dass die kapitalistische Produktion sich nicht auf die Naturschätze und Produktivkräfte „der gemäßigten Zone“ beschränken kann und für die Entfaltung die „Verfügungsmöglichkeit über alle Erdstriche und Klimate bedarf“. Das gleiche gilt für die Arbeitskräfte – das Kapital „braucht überhaupt die unumschränkte Verfügungsmöglichkeit über alle Arbeitskräfte des Erdrunds“. In diesem Prozess des Ausscheidens von Arbeitskräften aus den „primitiven sozialen Verhältnissen“ und ihrem Übergangs in das kapitalistische Lohnsystem, beschreibt Luxemburg eine historische Grundlage des Kapitalismus. Für diesen Prozess ist die „sogenannte Arbeiterfrage in den Kolonien“ zentral. In den Kolonialländern ergeben sich aufgrund dieses Bezugs von erforderlichen Arbeitskräften „die seltsamsten Mischformen zwischen modernem Lohnsystem und primitiven Herrschaftsverhältnissen“ (ebd., S. 311f.).
Kautsky argumentierte in Bezug auf den imperialistischen Expansionismus in einer ähnlichen Weise wie Luxemburg. Die Haupttriebkraft ist in seiner Argumentation das Verhältnis von Industrie- und Agrarproduktion. Kautsky schreibt, dass die „Produktenmasse pro Arbeiter in der Industrie reicher als in der Landwirtschaft“ wächst. Die Akkumulation würde von daher in engen Grenzen gehalten werden, wenn die Industrie eines Landes sich auf sein Landgebiet als Lieferant und Abnehmer beschränken würde:
„Die kapitalistische Akkumulation kann in der Industrie nur dann ungehindert vor sich gehen und sich frei entfalten, wenn sie das landwirtschaftliche Gebiet, das ihr als Lieferant und Abnehmer dient, beständig erweitert, was eine stete Erweiterung und Verbesserung der Verkehrsmittel notwendig macht (Kautsky 1914, S. 8).“
In Bucharins Schrift ist die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der Produktivkräfte ausschlaggebend. Diese führe zu verschiedenen wirtschaftlichen Typen und unterschiedlichen Produktionssphären, was „die internationale Arbeitsteilung auf sozialer Grundlage ausdehnt“. Damit meint Bucharin die Verschiedenheit zwischen Industrieländern, „die Produkte der Landwirtschaft einführen und Fabrikerzeugnisse ausführen“ einerseits und andererseits Agrarländern, „die Produkte der Landwirtschaft ausführen und Industrieprodukte einführen“ (Bucharin 1915, S. 19). Ein weiterer zentraler Aspekt für Bucharin ist die Entwicklung des Verkehrswesens. Diese Entwicklung ermögliche ein schnelleres „Verwachsen der einzelnen lokalen und „nationalen“ Märkte“ und ein schnelleres Wachsen des „einheitliche[n] Produktionsorganismus der Weltwirtschaft“ (ebd., S. 33f.). Die Entwicklung des Verkehrswesens ist auch zentral für das Finanzkapital, denn der internationale Ausgleich der Preise für Waren und Wertpapiere vollziehe sich über Telegraphen. Dies führe dazu, dass das Telegraphennetz in einem „ebenso fieberhaften Tempo zu[nimmt] wie die Verkehrsmittel“. Dabei seien besonders die zunehmenden Unterseekabel, die die verschiedenen Kontinente verbinden, von Bedeutung (ebd., S. 36).
Der bereits eingeführte Begriff des „staatskapitalistischen Trust“, die Bucharin nutzt, ist in seiner Untersuchung wichtig für die Darstellung der Expansionspolitik. Es wird nachgezeichnet, wie die Konkurrenz in ganzen Produktionszweigen aufhört und der Kampf um die Aufteilung des Mehrwerts unter den Syndikaten in verschiedenen Produktionszweigen zunimmt und der Zentralisationsprozess sich ständig weiterentwickelt. Durch ihn fassen gemischte Unternehmen und Bankkonzerne „die gesamte nationale Produktion zusammen“, welche „die Form eines Verbandes der Verbände annimmt“ – was Bucharin als staatskapitalistischen Trust charakterisiert. Daraus folgt, dass:
„[d]ie Konkurrenz […] die höchste und letzte denkbare Entwicklungsstufe [erreicht]: die Konkurrenz der staatskapitalistischen Trusts auf dem Weltmarkt. In den Grenzen der „nationalen“ Wirtschaften wird sie auf ein Minimum reduziert, aber nur, um in gewaltigem, in keiner der vorhergehenden Epochen möglichem Umfange aufs neue zu entbrennen. Eine Konkurrenz unter den „nationalen Wirtschaften“, d. h. unter ihren herrschenden Klassen, hat es natürlich auch vorher gegeben. […] Heute, in der Epoche des Finanzkapitalismus, ist das alles ganz anders: der Schwerpunkt liegt jetzt in der Konkurrenz von gewaltigen, geschlossenen und organisierten wirtschaftlichen Organismen, die über eine kolossale Kampfkraft im internationalen Wettbewerb der „Nationen“ verfügen. […] Die Aufsaugung kleiner Kapitale, die Aufsaugung schwacher Trusts, ja sogar die Aufsaugung Großer Trusts tritt in den Hintergrund und erscheint als ein Kinderspiel gegenüber der Aufsaugung ganzer Länder, die gewaltsam von ihren wirtschaftlichen Mittelpunkten losgerissen und in das wirtschaftliche System der siegreichen „Nation“ einbezogen werden (ebd., S. 132f.).“
Lenin nimmt in der Schrift Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung von 1916 eine Bestimmung des Begriffs der Annexion vor und führt drei Begriffe für dessen Bestimmung an: (1) den Begriff der Gewalt bzw. der gewaltsamen Angliederung; (2) den Begriff der nationalen Fremdherrschaft und „manchmal“ (3) der Begriff von der Verletzung des Status quo (Lenin 1916a, S. 334). In seiner Karikatur auf den Marxismus macht Lenin schließlich Ausführungen zum ökonomischen Annexionismus. Lenin führt aus, dass das große Finanzkapital eines Landes in der Lage ist, seine Konkurrenten in fremden, politisch unabhängigen Ländern, aufzukaufen. Solch eine ökonomische „Annexion“ sei, so Lenin, durchaus ohne eine politische Annexion realisierbar:
„In der Literatur über den Imperialismus finden wir auf Schritt und Tritt Hinweise, daß z. B. Argentinien in Wirklichkeit eine „Handelskolonie“ Englands, Portugal faktisch ein „Vasall“ Englands ist u. dgl. Das ist richtig. Die ökonomische Abhängigkeit von den englischen Banken, die Verschuldung an England, der Aufkauf von Eisenbahnen, Gruben, Boden usw. durch England – all das macht die genannten Länder zu einer „Annexion“ Englands im ökonomischen Sinne, ohne Zerstörung der politischen Unabhängigkeit dieser Länder (Lenin 1916b, S. 36).“
Die Auseinandersetzung mit der ökonomischen „Annexion“ zieht sich durch Lenins Arbeiten im Jahr 1916. In Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung werden von Lenin die Beispiele Polen, Finnland, Ukraine und Elsass erwähnt und die Entwicklung der Produktivkräfte dort, die sich „zweifellos rascher, stärker und selbstständiger“ als in Indien, Ägypten oder Turkestan und anderen „Kolonien von reinem Typus“ vollziehen. Der Unterschied bestehe darin, dass in Europa „die abhängigen Nationen sowohl eigenes Kapital“, sowie die Möglichkeit besitzen „sich leicht Kapital zu den verschiedenartigsten Bedingungen zu beschaffen“. Im Unterschied dazu haben die Kolonien „kein oder fast kein eigenes Kapital“ und können sich nur durch die politische Unterwerfung Kapital beschaffen (Lenin 1916a, S. 345).
In Karikatur auf den Marxismus spricht Lenin davon, dass die „imperialistische Tendenz zur Bildung großer Weltreiche“ durchaus realisierbar ist und:
„wird in der Praxis auch häufig in Gestalt imperialistischer Bündnisse selbständiger und, im politischen Sinne des Wortes, unabhängiger Staaten realisiert. Solche Bündnisse sind möglich und sind nicht nur in der Form zu verzeichnen, daß das Finanzkapital zweier Länder ökonomisch miteinander verwächst, sondern auch als militärische „Zusammenarbeit“ im imperialistischen Krieg (Lenin 1916b, S. 42).“
Wenig später heißt es in ebendiesem Text über das Finanzkapital, dass es in jedem beliebigen und unabhängigem Land herrschen kann:
„In unseren Thesen wird festgestellt, daß das Finanzkapital in „jedem beliebigen“, „selbst in einem unabhängigen Lande“ herrschen kann und daß deshalb alle Betrachtungen, mit denen die Selbstbestimmung unter Hinweis auf das Finanzkapital für „unrealisierbar“ erklärt wird, reinste Konfusion sind (ebd., S. 44).“
In seiner Imperialismus-Broschüre hebt Lenin in diesem Kontext den Kapitalexport heraus, auf dessen Rolle „bei der Schaffung des internationalen Netzes der Abhängigkeit und der Verbindungen des Finanzkapitals“ eingegangen werden muss (Lenin 1917, S. 244).
Lenin schreibt davon, dass die „kapitalexportierenden Länder […], im übertragenen Sinne, die Welt unter sich verteilt [haben].“ Gleichzeitig führe das Finanzkapital auch „zur direkten Aufteilung der Welt“ (ebd., S. 249). Der Übergang zum Monopolkapitalismus (was Lenin hier synonym mit dem Finanzkapital setzt), sei „mit einer Verschärfung des Kampfes um die Aufteilung der Welt verknüpft“ (ebd., S. 260). Zur Macht des Finanzkapitals führt Lenin aus:
„Was die „halbkolonialen“ Staaten betrifft, so sind sie ein Beispiel für jene Übergangsformen, die uns auf allen Gebieten der Natur und der Gesellschaft begegnen. Das Finanzkapital ist eine so gewaltige, man darf wohl sagen, entscheidende Macht in allen ökonomischen und in allen internationalen Beziehungen, daß es sich sogar Staaten unterwerfen kann und tatsächlich auch unterwirft, die volle politische Unabhängigkeit genießen; wir werden sogleich Beispiele dafür sehen. Aber selbstverständlich bietet dem Finanzkapital die meisten „Annehmlichkeiten“ und die größten Vorteile eine solche Unterwerfung, die mit dem Verlust der politischen Unabhängigkeit der Länder und Völker, die unterworfen werden, verbunden ist. Die halbkolonialen Länder sind in dieser Beziehung als „Mittelding“ typisch. Der Kampf um diese halbabhängigen Länder mußte begreiflicherweise besonders akut werden in der Epoche des Finanzkapitals, als die übrige Welt bereits aufgeteilt war (ebd., S. 263f.).“
Lenin geht sogar so weit und spricht von der „Kolonialpolitik des Finanzkapitalismus“ und macht damit auf die ökonomischen Unterschiede früherer Kolonialpolitik aufmerksam, denn „Kolonialpolitik und Imperialismus hat es auch vor dem jüngsten Stadium des Kapitalismus“ ja sogar „vor dem Kapitalismus“ gegeben. Lenin geht sogar so weit, von der „Kolonialpolitik des Finanzkapitalismus“ zu sprechen, und lenkt damit die Aufmerksamkeit auf die ökonomischen Unterschiede zur früheren Kolonialpolitik. Er betont, dass „Kolonialpolitik und Imperialismus“ nicht erst im jüngsten Stadium des Kapitalismus existierten, sondern sogar „vor dem Kapitalismus“ bereits eine Rolle spielten. So kann die Sklaverei im alten Rom ebenfalls als eine Form des Imperialismus betrachtet werden. Aber auch die Kolonialpolitik der früheren Stadien des Kapitalismus „unterschieden sich wesentlich von der Kolonialpolitik des Finanzkapitals“ (ebd., S. 264).
Die Betonung der Kolonialpolitik des Finanzkapitals zieht sich durch das gesamte sechste Kapitel der Imperialismus-Schrift (Die Aufteilung der Welt unter die Großmächte). Lenin unterstreicht, dass so bald von der „Kolonialpolitik in der Epoche des kapitalistischen Imperialismus“ gesprochen wird, festgestellt werden müsse:
„daß das Finanzkapital und die ihm entsprechende internationale Politik, die auf einen Kampf der Großmächte um die ökonomische und politische Aufteilung der Welt hinausläuft, eine ganze Reihe von Übergangsformen der staatlichen Abhängigkeit schaffen. Typisch für diese Epoche sind nicht nur die beiden Hauptgruppen von Ländern – die Kolonien besitzenden und die Kolonien selber -, sondern auch die verschiedenartigen Formen der abhängigen Länder, die politisch, formal selbständig, in Wirklichkeit aber in ein Netz finanzieller und diplomatischer Abhängigkeit verstrickt sind (ebd., S. 267).“
Lenin spricht davon, dass es die Form „finanzieller und diplomatischer Abhängigkeit, bei politischer Unabhängigkeit“zwischen einzelnen großen und kleinen Staaten immer gegeben hat, allerdings wird diese Form „in der Epoche des kapitalistischen Imperialismus […] zum allgemeinen System“ und bildet einen Teil der „Gesamtheit der Beziehungen bei der „Aufteilung der Welt“ und wird zu einem „Kettenglied der Operationen des Weltfinanzkapitals“ (ebd., S. 268).
Gerade beim Thema der Kolonien treten deutliche Unterschiede zwischen Lenin und den übrigen Arbeiten hervor, sowohl in der Schwerpunktsetzung als auch in der Argumentation. So setzten sich vor allem Hobson, aber auch Hilferding mit den verschiedenen Formen der Kolonien sowie ihrer allgemeinen Bedeutung auseinander. Bei Luxemburg sowie Kautsky ist das Thema der Akkumulation der Ausgangspunkt ihrer Betrachtung der kolonialen Unterwerfung. Bucharin legt seinen Fokus auf ein Thema, das in Lenins Argumentation ebenfalls sehr zentral ist – die Konkurrenz „staatskapitalistischer Trusts“ um die Herrschaft über ganze Länder. Dies ist auch der Fluchtpunkt für Lenin: aus dem Kapitalexport heraus entwickelt er die „Kolonialpolitik des Finanzkapitals“. Dabei geht es um die (Welt)Herrschaft einiger weniger Staaten, die ein umfassendes System der Abhängigkeit geschaffen haben, in dem Kolonien ebenso eine Rolle spielen wie politisch unabhängige Staaten, die durch die Macht des Finanzkapitals kontrolliert werden.
Zusammenfassung
Bei Hobson und Hilferding ist mehr über die Stagnation des Kolonialhandels zu erfahren. Hobson gelangt in seiner empirischen Untersuchung des britischen Kolonialreichs zu dem Schluss, dass die koloniale Expansion nicht abgeschlossen ist und sich weiter intensiviert. Luxemburg und Kautsky ähneln sich in ihrer Argumentation über die Rolle eines kapitalistischen Äußeren, als Notwendigkeit zur weiteren Akkumulation. In einer gewissen Weise weicht diese Auffassung von dem Zusammenhang zwischen Kapital- und Warenexport (Hilferding, Bucharin und Lenin) ab. Bucharin hingegen beschreibt die Hintergründe der internationalen Unterschiede zwischen Ländern (Industrieländer/Agrarländer) und führte diese auf die ungleichmäßige Entwicklung zurück. Von Bucharin wurde auch der Zusammenhang zwischen der Ausbreitung des Verkehrswesens und der internationalen Ausbeutung erkannt. Es findet sich bei Bucharin eine zugespitzte Beschreibung des Weltmarktes. Er beschreibt die Konkurrenz zwischen den staatskapitalistischen Trusts als höchste Form des Konkurrenzverhältnisses, durch welche ein Wettbewerb der Nationen entstand.
Lenins spitzt in diesem Kontext seine bisherige Analyse über das Finanzkapital und den Kapitalexport weiter zu. In dieser Zuspitzung besteht das Alleinstellungsmerkmal seiner Arbeit. Er setzt sich mit der ökonomischen Annexion durch das Finanzkapital auseinander, ohne einer gleichzeitigen politischen Annexion. Die abhängigen Länder besitzen eigenes Kapital und haben die Möglichkeit, sich international leicht zusätzliches Kapital zu verschaffen, im Unterschied zu den klassischen Kolonien, die kein oder kaum eigenes Kapital besitzen. Das Finanzkapital ist in der Lage, unabhängige Staaten zu unterwerfen- es entsteht eine „Kolonialpolitik des Finanzkapitals“ (Lenin 1917, S. 264). Hilferding sprach vom Finanzkapital als Negation der Negation des Wucherkapitals. Lenin schafft es, die vollständige Entwicklung des Finanzkapitals sowie die eigentliche Synthese in der Epoche des Monopolkapitals zu beschreiben, die in der Ablösung des klassischen Kolonialismus durch die Kolonialpolitik des Finanzkapitals mündet.
2.4 Parasitismus und Fäulnis
Für Lenins Begriff des Imperialismus sind der Parasitismus und Fäulnis zentral. In der hier berücksichtigten Literatur ist dieses im Vergleich ein eher ein randständiges Thema.
Aus dem Umstand, dass der Imperialismus „eine ungeheure Anhäufung von Geldkapital in wenigen Ländern“ bedeutet, folgert Lenin das Anwachsen einer Schicht von Rentnern, die vom „Kuponschneiden“ leben. Diese von der Produktion völlig isolierte Rentnerschicht erlangt durch den Kapitalexport eine größere Bedeutung und:
„drückt dem ganzen Land, das von der Ausbeutung der Arbeit einiger überseeischer Länder und Kolonien lebt, den Stempel des Parasitismus auf (Lenin 1917, S. 281).“
Das Wesen des Parasitismus, das gleichsetzt wird mit dem Wesen des Imperialismus, sieht Lenin darin, dass „[d]ie Einnahmen der Rentner […] also im „handelstüchtigsten“ Lande der Welt fünfmal so groß wie die Einnahmen aus dem Außenhandel [sind] (ebd., S. 282).“
Der Parasitismus hat die Welt „in ein Häuflein Wucherstaaten“ und eine große Mehrheit von „Schuldnerstaaten“ verwandelt (ebd., S. 282). Die Bourgeoisie dieser Wucherstaaten lebt im steigenden Maße von Kapitalexport und „Kuponschneiden“ (ebd., S. 305).
Wir sehen, dass Lenin aus den Eigentumsverhältnissen, die für den Begriff des Finanzkapitals zentral sind, sowie aus dem Konzept des Kapitalexports an dieser Stelle seiner Argumentation die gesellschaftliche Ebene und deren Folgen ableitet.
Ein weiteres Thema, das auch in anderen Büchern berücksichtig wird, ist die Entstehung einer Arbeiteraristokratie. Hilferding beschreibt die Auswirkung der Entwicklung des Aktienwesens für die Arbeiterklasse:
„Auch die Entwicklung des Aktienwesens wirkt zunächst in ähnlicher Weise. Sie trennt die Leitung vom Besitz und macht die Leitung zur besonderen Funktion höher bezahlter Lohnarbeiter und Angestellter. Zugleich werden die höheren Posten zu einflußreichen und reich dotierten Stellungen, die, der Möglichkeit nach, allen Angestellten offenzustehen scheinen. Das Interesse an der Karriere, der Drang nach dem Avancement, das sich in jeder Hierarchie ausbildet, erwacht so in jedem einzelnen Angestellten und besiegt ihre Solidaritätsgefühle. Jeder hofft vor dem anderen hinaufzukommen und sich aus der halbproletarischen Lage emporzuarbeiten zu der Höhe kapitalistischen Einkommens. Je rascher die Entwicklung der Aktiengesellschaften, je größer ihr Umfang, desto größer auch die Zahl der Stellen, vor allem auch der einflußreichen und gut bezahlten (Hilferding 1910, S. 475).“
Bucharin legt dar, dass die Kolonialpolitik der Großmächte dem „staatskapitalistischen Trust“ riesige Einkünfte liefert. Dies sei der Grund dafür, weshalb die Bourgeoisie Kolonialpolitik betreibe. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, „den Arbeitslohn der Arbeiter auf Kosten der Ausbeutung der Eingeborenen der Kolonien und unterworfenen Völkern zu erhöhen (Bucharin 1915, S. 185).“
In seinem Artikel Sozialismus und Krieg spricht Lenin davon, dass die ökonomische Grundlage des Opportunismus und des Sozialchauvinismus ein und dieselbe ist. Es sind die Interessen einer kleinen Schicht von privilegierten Arbeitern und Kleinbürgern, die ihre Stellung, ihr Recht „auf Brocken vom Tische der Bourgeoisie verteidigen“, auf einen Teil des Profits die diese Bourgeoisie durch die Ausplünderung fremder Nationen erhält (Lenin 1915a, S. 311). In Karikatur auf den Marxismus heißt es bei Lenin sogar, dass:
„[d]ie Arbeiter der unterdrückenden Nation […] bis zu einem gewissen Grade Teilhaber ihrer Bourgeoisie [sind] bei der Ausplünderung der Arbeiter (und der Masse der Bevölkerung) der unterdrückten Nation (Lenin 1916b, S. 48).“
In seiner Imperialismusschrift fasst Lenin sehr knapp die Ursachen und Wirkungen hinter dem Parasitismus auf:
„Ursachen: 1. Ausbeutung der ganzen Welt durch das betreffende Land; 2. seine Monopolstellung auf dem Weltmarkt; 3. sein Kolonialmonopol. Wirkungen: 1. Verbürgerung eines Teils des englischen Proletariats; 2. ein Teil des Proletariats läßt sich von Leuten führen, die von der Bourgeoisie gekauft sind oder zumindest von ihr bezahlt werden (Lenin 1917, S. 289).“
In Lenins Imperialismusbegriff fließt demnach sowohl die Auswirkung des Imperialismus auf die nationale Bourgeoisie als auch auf die Arbeiterklasse mit ein.
Erwähnenswert ist, dass für vorhergegangene Schriften (wie Hobson, Luxemburg, Kautsky und Bucharin) das Thema des Militarismus von großer Bedeutung war und wie dieser im Zusammenhang mit der imperialistischen Ausdehnung steht. Lenin behandelt das Thema nicht im engeren Sinne, untersucht aber weitergefasst die Triebkräfte, die dazu führen, dass die Arbeiterklasse anfälliger für den Militarismus und Chauvinismus wird.
Zusammenfassung
Nachdem Lenin die Konzentration des Kapitals, die entstehenden Monopole und die Wechselwirkung dieses Prozesses mit den Banken sowie dem daraus wachsenden Finanzkapital analysierte und dieses sowohl in seiner nationalen als auch seiner internationalen Entwicklung untersuchte, mündet seine Arbeit in einer Auseinandersetzung mit den Klassenverhältnissen und dem subjektiven Faktor. Darin setzt sich Lenin deutlich von den bisherigen Arbeiten ab. Ein zentraler Fokus der anderen Autoren bestand in der Auseinandersetzung mit dem Militarismus. Lenin beschreibt hingegen, wie in den imperialistischen Ländern eine Schicht von Rentnern entsteht, die vom Kuponschneiden leben. Der Kapitalexport stärkt diese Schicht weiter. Lenin greift an dieser Stelle noch einmal die Entwicklung auf, die er in Auseinandersetzung mit dem Finanzkapital beschrieb, welche dazu führt, dass einige wenige Millionäre und Milliardäre die Geschicke der Welt lenken. Diese Entwicklung führt dazu, dass sich international ein Häuflein Wucherstaaten herausbildet und sich die große Mehrheit der Länder zu Schuldnerstaaten verwandeln. In Bezug auf die Arbeiterklasse deckt sich Lenins Beschreibung der Bestechung und der Entstehung einer Arbeiteraristokratie mit vorangegangenen Arbeiten. Lenins Imperialismus-Broschüre zeichnet sich dadurch aus, dass er die Auswirkungen auf den subjektiven Faktor darlegt. Lenin deckt im Unterschied zu den anderen Autoren auf, dass die Bestechung die materielle Grundlage für den Opportunismus und Sozialchauvinismus ist. Er deckt somit die materielle Grundlage hinter dem Phänomen des Militarismus auf, welche im Fokus anderer Arbeiten stand. Lenin spricht davon, wie eine besondere Schicht der Arbeiter in den unterdrückenden Nationen quasi Teilhaber ihrer nationalen Bourgeoisie werden. Bei Lenin finden wir auch eine prägnante Zuspitzung auf die Ursachen und Wirkungen in diesem Prozess. Er beschreibt drei Ursachen: (1) die Ausbeutung der ganzen Welt, (2) die Monopolstellung auf dem Weltmarkt einiger weniger Länder, (3) das Kolonialmonopol. Daraus folgt: (1) die Verbürgerung des Proletariats in den unterdrückenden Ländern und (2) die Tendenz einer opportunistischen Führung der Arbeiterbewegung. Lenins Analyse des Imperialismus läuft also auf die Auseinandersetzung mit den Kampfbedingungen der Arbeiterklasse in den imperialistischen Ländern hinaus.
2.5 Kritik des Imperialismus
Am Ende dieses Abschnitts soll es um ein besonders virulentes Thema gehen – den Ultraimperialismus. Dieser wird schnell und gern als Waffe genutzt, um gewisse Argumente zu diskreditieren. Häufig scheint jedoch unklar zu sein, was genau mit dem Begriff des Ultraimperialismus sowie mit der Kritik daran gemeint ist bzw. gemeint war.
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs kommt es zu einem erbitterten Streit in der internationalen Arbeiterbewegung über den Charakter des Imperialismus. Im Zentrum steht die Frage, ob sich eine dauerhafte und stabile Zusammenarbeit imperialistischer Staaten herausbildet, oder ob ihre Gegensätze unversöhnlich bleiben.
Es lässt sich feststellen, dass Kautsky nicht die erste Person war, die in diese Richtung argumentierte. Bereits 1902 schrieb der englische liberale Imperialismuskritiker John A. Hobson über einen sogenannten „Inter-Imperialismus“. In Der Imperialismus beschäftigt sich Hobson im sechsten Kapitel (Die imperiale Föderation) mit der Entwicklung des britischen Kolonialismus und der Tendenz der Föderalisierung des britischen Kolonialreichs, durch welche es zu einer umfassenden Neuordnung der politischen Beziehungen Englands zu seinen Kolonien gekommen ist (Hobson 1902, S. 278f.). Die demokratische Bewegung sei „eng mit der Bildung eines Bundesstaates verknüpft“, erläutert Hobson. Daraufhin skizziert Hobson eine mögliche zukünftige Entwicklung der imperialistischen Staaten:
„Gehen wir, wie wir müssen, davon aus, daß gute Ordnung und Zivilisation in der Welt nur gewährleistet sind bei zunehmender Anwendung des Föderativprinzips in der internationalen Politik, dann wird es uns nur natürlich erscheinen, daß sich zunächst einmal Staaten zusammenschließen, welche durch Gemeinsamkeit von Blut, Sprache und Einrichtungen eng miteinander verwandt sind, und daß eine Phase des föderierten Briten- oder Angelsachsentums, Pangermanismus, Panslawismus und Panlatinismus der schon erreichten Phase folgt. Vielleicht steckt eine Spur von übertriebener Logik in einer solchen Abfolge der Ereignisse, doch in einer umfassenden, allgemeinen Geschichtsperspektive erscheint sie plausibel und wünschenswert genug. Die Christenheit, auf diese Art in wenigen großen Föderativreichen organisiert, jedes mit einer Gefolgschaft von unzivilisierten, abhängigen Gebieten – das erschiene für viele als legitimste Weiterbildung der gegenwärtigen Tendenz und als beste Sicherheit für einen dauerhaften Frieden auf der festen Grundlage des Inter-Imperialismus. Lassen wir die äußersten Konsequenzen der Konzeption als zu fern liegend für eine fruchtbare Diskussion in der Gegenwart beiseite und beschränken wir unsere Aufmerksamkeit auf einen britischen imperialen Staatenbund, dann werden wir leicht darin überein-stimmen, daß eine freiwillige Föderation freier britischer Staaten, die friedlich für die gemeinsame Sicherheit und Prosperität zusammenwirken, an sich höchst wünschenswert ist und wirklich eine Vorstufe für eine künftige größere Föderation zivilisierter Staaten sein könnte (ebd., S. 280f.).“
Hobson spricht hier, wenn auch vielleicht mit einer gewissen Zurückhaltung, davon, dass in der Föderalisierung eine allgemeine Tendenz in der Weltpolitik liege. Eine Föderation freier britischer Staaten (d.h. Kolonien) könnte seiner Ansicht nach die Vorstufe für eine Föderation auf einer höheren Stufe sein – einen Inter-Imperialismus. Dieser würde einen dauerhaften Frieden sichern. Dieser Gedankengang wird aber schnell mit der Begründung abgebrochen, dass er zu fern in der Zukunft liege, um eine fruchtbare Diskussion in der Gegenwart zu ermöglichen.
Lenin stellt fest, dass Kautsky mit dem Begriff des Ultraimperialismus im Wesentlichen das beschreibt, was Hobson bereits 13 Jahre zuvor als Inter-Imperialismus bezeichnet hatte (Lenin 1917, S. 299).
Ähnliche Überlegungen finden sich in Hilferdings Finanzkapital. Dort ist an mehreren Stellen die Rede von einem sogenannten „Generalkartell“, das gedanklich aus der Tendenz der fortschreitenden Monopolisierung entwickelt wird:
„Und diese Frage muß dahin beantwortet werden, daß es eine absolute Grenze für die Kartellierung nicht gibt. Vielmehr ist eine Tendenz zu stetiger Ausbreitung der Kartellierung vorhanden. Die unabhängigen Industrien geraten, wie wir gesehen haben, immer mehr in Abhängigkeit von kartellierten, um schließlich von ihnen annektiert zu werden. Als Resultat des Prozesses ergäbe sich dann ein Generalkartell. Die ganze kapitalistische Produktion wird bewußt geregelt von einer Instanz, die das Ausmaß der Produktion in allen ihren Sphären bestimmt. Dann wird die Preisfestsetzung rein nominell und bedeutet nur mehr die Verteilung des Gesamtprodukts auf die Kartellmagnaten einerseits, auf die Masse aller anderen Gesellschaftsmitglieder anderseits (Hilferding 1910, S. 349).“
Eine Seite später spricht Hilferding davon, wie die Tendenz zur Herstellung eines Generalkartells mit der Tendenz der Bildung einer Zentralbank zusammentreffen und aus ihrer Vereinigung die gewaltige Konzentrationsmacht des Finanzkapitals erwächst (ebd., S. 350). Hilferding räumt schließlich aber ein, dass ein solches Generalkartell zwar ökonomisch denkbar, aber sozial und politisch unmöglich sei:
„Wer diese Kontrolle ausübt und wem die Produktion gehört, ist eine Frage der Macht. An sich wäre ein Generalkartell ökonomisch denkbar, das die Gesamtproduktion leitete und damit die Krisen beseitigte, wenn auch ein solcher Zustand sozial und politisch eine Unmöglichkeit ist, da er an dem Interessengegensatz, den er auf die äußerste Spitze treiben würde, zugrunde gehen müßte. Aber von den einzelnen Kartellen eine Aufhebung der Krisen erwarten, zeugt nur von der Einsichtslosigkeit in die Ursache der Krisen und den Zusammenhang des kapitalistischen Systems (ebd., S. 440).“
Kautsky führt aus, dass die Unterjochung fremder Gebiete und Völker nur durch den Sozialismus beendet werden kann. Unmittelbar danach stellt er die Frage, ob die durch das Streben nach Besatzung ausgelösten Gegensätze zwischen den kapitalistischen Industriestaaten, die zu einem Wettrüsten führen, überhaupt anders als durch den Sozialismus überwunden werden können (Kautsky 1914, S. 11f.). Er Antwortet sogleich:
„Eine ökonomische Notwendigkeit für eine Fortsetzung des Wettrüstens nach dem Weltkrieg liegt nicht vor, auch nicht vom Standpunkt der Kapitalistenklasse selbst, sondern höchstens vom Standpunkt einiger Rüstungsinteressenten.
Umgekehrt wird gerade die kapitalistische Wirtschaft durch die Gegensätze ihrer Staaten aufs äußerste bedroht. Jeder weitersehende Kapitalist muß heute seinen Genossen zurufen: Kapitalisten aller Länder, vereinigt euch (ebd., S. 12)!“
Kautsky überträgt anschließend die Tendenz zur Kartellbildung, die sich aus der Konkurrenz ergibt, auf die imperialistischen Großmächte. Er argumentiert, dass ein Zusammenschluss der stärksten Mächte nach dem Weltkrieg dem Wettrüsten ein Ende setzen könnte:
„Vom rein ökonomischen Standpunkt ist es also nicht ausgeschlossen, daß der Kapitalismus noch eine neue Phase erlebt, die Übertragung der Kartellpolitik auf die äußere Politik, eine Phase des Ultraimperialismus, den wir natürlich ebenso energisch bekämpfen müßten wie den Imperialismus, dessen Gefahren aber in anderer Richtung lägen, nicht in der des Wettrüstens und der Gefährdung des Weltfriedens (ebd., S. 13).“
In Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund verpackt Kautsky seine Idee eines „Ultraimperialismus“ in eine Kritik an einer mechanischen Vorstellung über die Geschichte. So müsse man aufpassen, wenn „man mit dem Begriff der ökonomischen Notwendigkeit operiert“, dass der ökonomische Prozess nicht als ein starrer Mechanismus aufgefasst werde. Denn die Gesellschaft stelle kein Mechanismus dar, „sondern ein Organismus“, wodurch die „Begriffe der Elastizität und Anpassungsfähigkeit gegeben“ sind. Der gesellschaftliche Gesamtprozess entsteht aus dem Zusammenspiel zahlloser Einzelwillen, die sich teils gegenseitig verstärken, wenn sie in dieselbe Richtung wirken, oder einander hemmen. Kautsky betont, dass große Mengen regelmäßig wiederkehrender Prozesse sich mit einer Art Naturnotwendigkeit durchsetzen. Daraus folgert Kautsky:
„Auf Grund solcher Erkenntnisse können wir voraussehen, wie große Massen unter bestimmten Umständen wirken werden. Diese Voraussicht setzt jedoch voraus, daß wir alle unter jenen Umständen wirksamen Faktoren genau kennen. Haben sich einige von ihnen geändert, ohne daß wir es wußten, oder haben wir ihre Aenderung falsch eingeschätzt, dann wird die Masse anders handeln, als wir vorausgesehen.
Zu den Faktoren, die sich am schwersten berechnen lassen, gehören die Machtverhältnisse der einzelnen Klassen (Kautsky 1915, S. 17f.).“
Kautsky bezieht sich auf Marx und hebt hervor, dass dieser zeigt, wie die ökonomischen Verhältnisse zwischen Menschen durch die Elastizität und Anpassungsfähigkeit der Produktionsweise geprägt sind – im Gegensatz zur bürgerlichen Ökonomie, die „jeden Eingriff in den Produktionsprozess für die schlimmste Gefährdung der Gesellschaft erklärte“. Marx hingegen zeige, so Kautsky, wie durch Eingriffe einer regelnden Macht (wie der Staatsgewalt, oder Gewerkschaften), „der Produktionsprozeß nicht nur geschädigt, sondern vielmehr auf eine höhere Stufe gehoben wird.“ Dies führt die Argumentation in die Gegenwart, in der Kautsky die Monopolisierung in den Vordergrund rückt:
„Seitdem hat sich die Elastizität und Anpassungsfähigkeit der Produktion nicht vermindert, sondern erheblich gesteigert, wie der jetzige Weltkrieg deutlich beweist. […] Andererseits der Zentralisation der Betriebe, ihre Organisierung in Kartellen und Trusts, der Zunahme ihrer Beherrschung durch einige wenige Großbanken und der wachsenden ökonomischen Bedeutung der Staatsgewalt. An Stelle zahlloser Einzelwillen, die in einer neuen, unerhörten Situation schwer rasch zu einem einheitlichen Gesamtwillen zu vereinigen sind, treten einige wenige Machthaber, die alle in gleicher Weise interessiert und gewöhnt sind, sich mit einander zu verständen. Ihnen gelingt es leichter, den Gesamtprozeß in eine neue Richtung zu lenken (ebd., S. 20).“
Schließlich geht Kautsky in seiner Argumentation so weit, die Notwendigkeit des Imperialismus vollständig infrage zu stellen, und stützt sich dabei auf die Elastizität und Anpassungsfähigkeit der ökonomischen Verhältnisse:
„Betrachtet man diese heute bereits weitgehende Elastizität und Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus, dann wird man nicht mehr ohne weiteres aus der Tatsache, daß der Imperialismus seine starken ökonomischen Triefkräfte im Kapitalismus findet, einfach schließen, er sei unvermeidlich, so lange die kapitalistische Produktionsweise bestehe, und es sei ein Unsinn, ihm innerhalb dieser Produktionsweise widerstehen zu wollen (ebd., S. 21).“
Bucharin setzt an diesem Argumentationsgang an, um seine Kritik an Kautsky zu entwickeln, „die äußerlich dem Fatalismus entgegengesetzt ist.“ Bucharin stimmt Kautsky in dem Punkt zu, dass „das weitere Bestehen des Imperialismus von dem gesellschaftlichen Kräfteverhältnis abhängt“ und rekapituliert anschließend Kautskys zentralen Gedankengang, dass der „Imperialismus […] eine bestimmte Methode der kapitalistischen Politik“ sei und diese auch „ohne gewalttätige Mittel […] denkbar“ ist, weshalb der „bürgerlich-gewaltsamen Tendenz des Imperialismus die friedliche Tendenz des Proletariats entgegengestellt“ werden müsse. Diese Frage kann nach Kautsky, wie Bucharin weiter zusammenfasst, im Rahmen des Kapitalismus gelöst werden. Dadurch mag diese Theorie auf den ersten Blick radikal erscheinen, „in Wirklichkeit ist sie eine durch und durch reformistische Theorie“. Die ökonomische Grundlage für den Ultraimperialismus nach Kautsky liefert die Zunahme der internationalen Verflechtung und die Tendenz der Aufhebung der Konkurrenz von verschiedenen nationalen Gruppen. Diese Tendenz könne durch den Druck der Arbeiterklasse verstärkt werden und es trete für Kautsky an die „Stelle des raubgierigen Imperialismus der sanfte Ultraimperialismus“, wie Bucharin weiter zusammenfasst (Bucharin 1915, S. 149ff.). Bucharin macht Kautsky ein gewisses Zugeständnis und greift zustimmend einen Aspekt von Hilferding auf, der wie gezeigt wurde davon sprach, dass eine Generalkartell ökonomisch denkbar, aber politisch und sozial unmöglich sei:
„In der Tat ist der Imperialismus ja nichts anderes als die Erscheinungsform der Konkurrenz unter den staatskapitalistischen Trusts. Verschwindet diese Konkurrenz, dann verschwindet auch die Grundlage der imperialistischen Politik. Es erfolgt ein Prozeß der Verwandlung des in nationale Gruppen zersplitterten Kapitals in eine einheitliche Weltorganisation, in einen allgemeinen Welttrust, dem das Weltproletariat gegenübersteht.
Erörtert man die Sache abstrakt theoretisch, so ist ein solcher Trust durchaus denkbar, da im allgemeinen keine Schranke für den Prozeß der Kartellierung besteht (ebd., S. 151).“
Und sogleich korrigiert Bucharin seine Aussage:
„Aber diese abstrakte ökonomische Möglichkeit ist noch keineswegs eine reale Wahrscheinlichkeit. Der gleiche Hilferding schreibt an einer anderen Stelle mit vollem Recht:
An sich wäre ein Generalkartell ökonomisch denkbar, das die Gesamtproduktion leitete und damit die Krisen beseitigte, wenn a u c h ein solcher Zustand sozial und politisch eine Unmöglichkeit ist, da er. an dem Interessengegensatz, den er auf die äußerste Spitze treiben würde, zugrunde gehen müßte (ebd., S. 152).“
Bucharin fährt fort mit einer Analyse der Bedingungen, die für eine dauerhafte Vereinigung von staatskapitalistischen Trusts erforderlich sind. Eine erste Bedingung sei „die rein wirtschaftliche Gleichheit“, da für den Abschluss einer Vereinbarung „die Gleichheit der wirtschaftlichen Struktur“ entscheidend sei. Wenn jedoch die Produktionskosten unterschiedlich ausfallen, wäre es für den staatskapitalistischen Trust „mit einer höheren Technik“ nicht vorteilhaft, eine solche Vereinbarung einzugehen. Zusätzlich sei eine „wirtschaftspolitische Gleichheit eine notwendige Voraussetzung für die Bildung dauernder Vereinbarungen“. Ein starker Staat ermöglicht vorteilhafte Bedingungen und hilft dem Finanzkapital bei der Monopolisierung von Absatz- und Rohstoffmärkten sowie der Kapitalanlagen. Aus diesem Grund geht es bei der Einschätzung des Kampfes auf dem Weltmarkt nicht nur um rein wirtschaftliche, sondern auch um wirtschaftspolitische Bedingungen, weshalb es „für den stärkeren staatskapitalistischen Trust sogar vorteilhaft [ist], den Kampf fortzusetzten“ und demnach keine Vereinbarung oder Fusion einzugehen, z.B. wenn die wirtschaftliche Struktur zur gleich, „die militärischen Machtmittel aber bedeutend verschieden sind“ (ebd., S. 152f.).
Schließlich kommt Bucharin auf den ökonomischen Prozess der Internationalisierung zu sprechen:
„Einen gewaltigen Anstoß zur Bildung eines internationalen staatskapitalistischen Trusts gibt der Prozeß der Internationalisierung der kapitalistischen Interessen, den wir im ersten Abschnitt dieser Arbeit beschrieben haben (Beteiligung an auswärtigen Unternehmungen und ihre Finanzierung, internationale Kartelle, Trusts usw.). Aber wie bedeutend dieser Prozeß auch an und für sich sein mag, so steht ihm doch die andere, noch stärkere Tendenz zur Nationalisierung des Kapitals, zu seiner Einschließung in die staatlichen Grenzen entgegen. […] Keinesfalls darf die Bedeutung der bereits vorhandenen internationalen Industrieabkommen überschätzt werden. Wir haben bereits festgestellt, daß viele von diesen Abkommen einen äußerst vorübergehenden Charakter haben und Unternehmerorganisationen von einem verhältnismäßig niedrigen Typus mit einer verhältnismäßig geringen Zentralisation darstellen, und endlich oft nur sehr spezielle Produktionszweige umfassen (das Flaschensyndikat) (ebd., S. 154f.).“
Bucharin schließt seine Kritik am Ultraimperialismus mit der Feststellung ab, dass die Epoche des „Ultraimperialismus“ zwar im Rahmen des Zentralisierungsprozesses denkbar wäre – ein Prozess, in dem die „staatskapitalistischen Trusts […] einander Stück um Stück auffressen, bis die Macht, die alle besiegt hat, die Herrschaft anträte“. Dies sei jedoch nur unter der Annahme möglich, dass der gesamte Prozess mechanistisch betrachtet wird und die Kräfte, die der imperialistischen Politik entgegentreten, unberücksichtigt bleiben:
„In Wirklichkeit muß eine Reihe von Kriegen, die in immer gewaltigeren Ausmaßen folgen, unvermeidlich eine Verschiebung der sozialen Kräfte hervorrufen. Der Zentralisierungsprozeß in seiner kapitalistischen Form stößt hier unvermeidlich auf die ihm gegenüber antagonistische sozial-politische Tendenz. Er kann seinen logischen Schlußpunkt nicht erreichen; er bricht zusammen und wird erst in einer gereinigten, neuen, nicht kapitalistischen Form vollendet. Die Theorie Kautskys ist somit keineswegs realistisch (ebd., S. 159).“
Demnach ist sowohl für Hilferding als auch für Bucharin die Rolle des Subjekts der entscheidende Punkt, der der Tendenz zum Ultraimperialismus entgegenwirkt. Lenin schließt sich dieser Kritik an. In seinem Vorwort zu Bucharins Imperialismus und Weltwirtschaft schreibt Lenin z.B.:
„Abstrakt-theoretisch gesprochen kann man zu dem Schluß kommen, zu dem denn auch Kautsky […] in der Tat gelangt ist: daß es nämlich bereits nicht mehr allzuweit sei bis zum Zusammenschluß dieser Kapitalmagnaten in einem einzigen Welttrust, der die Konkurrenz und den Kampf der staatlich getrennten Finanzkapitale durch ein international zusammengeschlossenes Finanzkapital ersetzen werde. Diese Schlußfolgerung ist aber ganz genau so abstrakt, simplifiziert und falsch, wie es die ähnlichen Gedankengänge unserer „Struvisten“ und „Ökonomisten“ in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts waren […] (Lenin 1915b, S. 103).“
Lenin stimmt zu, dass „eine neue Phase nach dem Imperialismus abstrakt „denkbar“ ist“, was allerdings in der Praxis bedeutet, ein Opportunist zu sein, „der die brennenden Aufgaben der Gegenwart von sich weist im Namen der Phantasie über künftige, nicht brennende Aufgaben“. In der Theorie läuft dies darauf hinaus, dass man „sich nicht auf die in der Wirklichkeit vor sich gehende Entwicklung stützt“ und sich von ihr abwendet. Schließlich formuliert Lenin in seinem Vorwort:
„Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Entwicklung in der Richtung auf einen einzigen, alle Unternehmungen und alle Staaten ausnahmslos umfassenden Welt-Trust verläuft. Doch tut sie dies unter solchen Umständen, in einem solchen Tempo, unter solchen Widersprüchen, Konflikten und Erschütterungen – beileibe nicht nur ökonomischer, sondern auch politischer, nationaler Natur usw. usw. – daß unbedingt, noch ehe es zu einem einzigen Welttrust, zu einer „ultraimperialistischen“ Weltvereinigung der nationalen Finanzkapitale kommt, der Imperialismus unvermeidlich zusammenbrechen, der Kapitalismus sich in sein Gegenteil verwandeln wird (ebd., S. 106).“
In seiner Imperialismus-Broschüre schreibt Lenin davon, dass „Interimperialistische“ oder „ultraimperialistische“ Bündnisse“ eine kapitalistische Wirklichkeit sind und notwendigerweise nur „Atempausen zwischen Kriegen“. Friedliche Bündnisse bereiten Krieg vor, wachsen aus ihnen und:
„erzeugen einen Wechsel der Formen friedlichen und nicht friedlichen Kampfes auf ein und demselben Boden imperialistischer Zusammenhänge und Wechselbeziehungen der Weltwirtschaft und der Weltpolitik (Lenin 1917, S. 301).“
Zusammenfassung
Wir sahen in diesem Kapitel, dass die Diskussion rund um den Ultraimperialismus mit Hobson und seiner Vorstellung eines Inter-Imperialismus begann. Hilferding setzte sich mit der Frage nach der Möglichkeit eines Generalkartells auseinander. Diese Idee wurde von Kautsky aufgriffen und politisch verpackt in der Annahme, dass ein solches Kartell, also ein internationaler Zusammenschluss, die Kriegspolitik beenden würde. Auch Bucharin setzte sich mit der Tendenz einer zunehmenden Internationalisierung des Kapitals auseinander und der Tendenz in Richtung eines Welttrust. Sowohl Hilferding als auch Bucharin sind sich einig darin, dass ein Generalkartell zwar abstrakt vorstellbar, aber wirtschafts- und machtpolitisch unmöglich zu realisieren ist. Die antagonistischen sozial-politischen Tendenzen überwiegen die Entwicklungstendenz hin zu einem Generalkartell. Lenin schließt sich der Kritik von Hilferding und Bucharin an, ohne ihrer Grundaussage etwas Wesentliches hinzuzufügen. Bezugnehmend auf Bucharin schreibt er ebenfalls, dass kein Zweifel daran bestehe, dass die Tendenz auf einen einzigen weltumfassenden Welt-Trust hinauslaufe. Allerdings betont er, dass diese Entwicklung politisch und national derart widersprüchlich sei, dass ihre Realisierung undenkbar bleibe und es unvermeidlich zum Zusammenbruch des Imperialismus kommen werde, bevor ein Welt-Trust entstehen könne. Lenin charakterisiert an dieser Stelle den Opportunismus als die Tendenz, die dringenden Aufgaben der Gegenwart zu vernachlässigen, und bezieht dies auf die abstrakte Vorstellung des Ultraimperialismus. Das ist insofern interessant, als dass Lenin im vorhergingen Kapitel die ökonomische Grundlage des Opportunismus analysierte und wie dieser in der Arbeiterbewegung, innerhalb der unterdrückenden Nationen, einsickert. Lenin nimmt in den letzten Kapiteln seiner Arbeit immer mehr den subjektiven Faktor in den Blick. Auch im letzten Kapitel (Der Platz des Imperialismus in der Geschichte) wird dies deutlich, wenn er den Imperialismus als Übergang zu einer höheren Gesellschaftsformation charakterisiert. Lenins Analyse verläuft also über eine Untersuchung des Entwicklungsprozesses und einer Begriffsbildung des Monopolkapitalismus, zu der subjektiven Seite, also den Aspekt des Übergangs. Dadurch erlangt seine Analyse einen konkreten politischen Wert, dessen Richtigkeit mit der Oktoberrevolution historisch bewiesen wurde.
3. Stellenwert Lenins Imperialismus-Broschüre und die Aufgabe der Begriffsentwicklung
In der Einleitung wurde die These aufgestellt, dass es sich bei der Imperialismus-Broschüre um eine Begriffsentwicklung und -bestimmung des Imperialismus handelt und dass darin das Alleinstellungsmerkmal von Lenins Analyse liegt.
Gleich zu Beginn des Textes wurden die Unterschiede der Imperialismus-Definitionen herausgearbeitet. Lenins Broschüre ist der einzige Text, der den Imperialismus nicht auf die eine oder andere Weise als eine spezifische Form der Politik definiert. Lenins fünf Kriterien deuten auf eine Entwicklung hin, die sich auch durch seine gesamte Schrift zieht. In jedem Kapitel werden Begriffe wie Konzentration, Monopol und die Rolle der Banken entwickelt, die wiederum in einem Verhältnis zueinanderstehen. Dies ermöglicht es Lenin, anhand seiner Definition die verschiedenen Seiten des Imperialismus zu berücksichtigen – sowohl die ökonomischen als auch die politischen Prozesse.
Lenin charakterisiert den Imperialismus als das letzte Stadium des Kapitalismus, da er erkannte, dass sich die politischen und nationalen Widersprüche immer weiter zuspitzen und der Imperialismus an seinen eigenen inneren Widersprüchen zerbrechen wird, um schließlich in eine höhere Gesellschaftsformation überzugehen. Dass es Lenin um diese Entwicklung ging, zeigt sich auch in seinen Kritiken an anderen Schriften, die die Bedingungen hinter einem Phänomen (wie dem Finanzkapital) vernachlässigten, beispielsweise in seiner Kritik an Hilferding.
Der begriffsentwickelnde Charakter der Broschüre Lenins zeigte sich durch die Textvergleiche. Im ersten Kapitel zur Konzentration von Industrie und Bank konnte gezeigt werden, dass sich z.B. Jeidels und Hilferding sehr genau mit den unterschiedlichen Formen der Industriemonopole beschäftigten. In Bucharins und Lenins Untersuchungen wurde diese Unterscheidung der Formen immer irrelevanter. Lenin sprach hauptsächlich von Monopolverbänden und konzentrierte sich auf die Mittel zum Zwang zur Unterwerfung usw.
Lenin ergänzt den Begriff der Konzentration in der Industrie und die Entstehung von Industriemonopolen um den Begriff der Konzentration im Bankwesen und der Bankmonopole. Dabei zeigen sich argumentativ Überschneidungen zwischen Lenin und Autoren wie Jeidels und Hilferding. Dennoch treten auch hier die unterschiedlichen Analyseebenen der jeweiligen Texte deutlich hervor.
Jeidels und Hilferding beschrieben den Konzentrationsprozess der Banken sehr detailliert, wobei Lenin eine starke Parallele zu Jeidels aufweist – insbesondere in der Darstellung des Verschmelzungsprozesses von Industrie- und Bankkapital. Zentral ist dabei die Beherrschung großer Kapitalmengen durch die Banken sowie die Entstehung von Bankmonopolen. In Lenins Ausführungen zeigt sich bereits ein Übergang vom Begriff der Bankkonzentration und der Bankmonopole hin zum umfassenderen Begriff des Finanzkapitals.
Auch bei der Charakterisierung des Verschmelzungsprozesses von Industrie und Banken setzt sich Lenin nicht auf einer konkret-empirischen Ebene mit den einzelnen Vorgängen innerhalb der Banken und der Industrie auseinander. Stattdessen rücken für ihn die wesentlichen Zusammenhänge in den Vordergrund: die Personalunion und die Abhängigkeit des Industriekapitals vom Bankkapital. Lenin beschreibt die Verschmelzung als einen Prozess, der aus der Konzentration von Industrie- und Bankkapital hervorgeht. Großbetriebe und Großbanken bilden dabei die Grundlage dieses Prozesses. Ein entscheidendes Instrument in diesem Zusammenhang sind der Bankkredit und die Aufsichtsräte. Durch die Argumentationen von Jeidels, Hilferding und Lenin zieht sich als zentrales Element die Herrschaft der Banken innerhalb dieses Prozesses.
Der Konzentrationsprozess bildet in Lenins Begriff des Finanzkapitals den Ausgangspunkt. Dies wird auch durch seine Kritik an Hilferding deutlich, in der er auf die Unvollständigkeit von Hilferdings Analyse hinweist, insbesondere aufgrund des fehlenden Fokus auf den Konzentrationsprozess, der letztlich zum Monopol führt. Lenins Argumentation betont an dieser Stelle erneut einen Entwicklungsprozess – eine Entwicklung, die sich auf die Weltwirtschaft bezieht und nicht nur auf ein einzelnes Land. Die Konzentration der Industrie führt zur Konzentration des Bankwesens und schließlich zur Verschmelzung beider Bereiche. Diese Verschmelzung, die nicht mit dem Begriff des Bankkapitals gleichgesetzt werden kann, entwickelt sich zu einem internationalen Herrschaftsverhältnis des Finanzkapitals, in dem einige wenige Länder die Welt dominieren. Lenin spricht in diesem Zusammenhang sogar von der „Kolonialpolitik des Finanzkapitals“. Der Entwicklungsprozess läuft bei Lenin stets auf das Monopol hinaus, wodurch der Begriff des Monopols mit dem des Finanzkapitals untrennbar verbunden wird.
Ausgehend vom Begriff des Finanzkapitals und der Finanzoligarchie gelangt Lenin zum Konzept des Kapitalexports. Entscheidend ist hierbei dessen Rolle bei der Schaffung eines internationalen Netzes von Abhängigkeiten und die zentrale Position, die das Finanzkapital in diesem System einnimmt (Lenin 1917, S. 244). Im Kapitel zum Kapitalexport wird unter anderem darauf hingewiesen, dass Hilferding eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den Großmächten beschreibt, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Formen des Finanzkapitals. Lenin verweist auf verschiedene Typen von Großmächten, darunter den „englischen Kolonialimperialismus“ und den französischen „Wucherimperialismus“. Zudem führt er in seinen Heften zum Imperialismus eine Kategorisierung der unterdrückenden Nationen ein, die er als die „Handvoll Räuber“ bezeichnet. In dieser Analyse beschreibt er lediglich drei Länder als vollständig selbstständig, was auf eine Einteilung der imperialistischen Staaten hindeutet.
Nach den Ausführungen über den Begriff des Kapitalexports wurde auf die Aufteilung der Welt unter den Kapitalverbänden und Großmächten eingegangen. In diesen Ausführungen wurde das internationale Herrschaftsverhältnis des Finanzkapitals sehr plastisch. Lenin spricht von einer ökonomischen „Annexion“ und beschreibt damit einen Prozess, bei dem politisch unabhängige Länder in ein Herrschaftsverhältnis eingebunden werden. Immer wieder betont er, dass das Finanzkapital in der Lage ist, auch in formal unabhängigen Ländern seine Herrschaft auszuüben. Dabei weist er darauf hin, dass die Forderung nach Selbstbestimmung sinnlos bleibt, wenn sie das Wirken des Finanzkapitals außer Acht lässt. Lenin spricht auch immer wieder von einer Kolonialpolitik des Finanzkapitals (um bei seiner Ausdrucksweise zu bleiben) und unterscheidet diese von der klassischen Kolonialpolitik. In diesem Punkt zeigt sich auch ein deutlicher Unterschied zwischen Lenin und den restlichen Arbeiten. Hobson und Hilferding setzten sich mit den verschiedenen Formen der Kolonien sowie ihrer Bedeutung auseinander. Für Luxemburg und Kautsky ist das Thema Akkumulation im Kontext der Kolonien bedeutend. Bucharin geht es vor allem um die Konkurrenz der „staatskapitalistischen Trust“ (die auch für Lenins Argumentation relevant ist). Lenins Argumentation in der Imperialismus-Broschüre hat einen eindeutigen Fluchtpunkt: aus dem Kapitalexport entwickelt sich die „Kolonialpolitik des Finanzkapitals“, die die Weltherrschaft einiger weniger Staaten beschreibt, in einem allgemeinen System der Abhängigkeiten. Lenin geht mit seiner Auseinandersetzung über den Kapitalexport dazu über die Herrschaft des Finanzkapitals auf der Ebene der Weltwirtschaft zu analysieren und arbeitet die gleichen Mechanismen wie bereits in seiner Analyse über den nationalen Rahmen heraus – die Entwicklung hin zur Unterordnung und Beherrschung der (Mehrzahl aller) Länder durch das Finanzkapital.
Lenins begriffliche Entwicklung mündet in einer Auseinandersetzung mit dem subjektiven Faktor. Zuerst analysiert er die ökonomische Grundlage des Opportunismus, den kolonialen Extraprofit, welcher die Bestechung der Arbeiterklasse in den unterdrückenden Nationen ermöglicht. Anschließend erfolgt eine Kritik an der Theorie des Ultraimperialismus, als einer verbreiteten opportunistischen Auffassung. Letztlich endet Lenin mit der Charakterisierung des historischen Platz des Imperialismus als dem „Übergang von der kapitalistischen zu einer höheren ökonomischen Gesellschaftsform“. Dabei geht es Lenin um die wachsenden politischen und nationalen Widersprüche und der Verschärfung des Klassenkampfes, die letztendlich in einer höheren Gesellschaftsformation (dem Kommunismus) münden. Im Zuge dessen spricht Lenin von vier Hauptarten der Monopole bzw. Haupterscheinungsformen des Monopolkapitalismus, die für die untersuchte Epoche charakteristisch sind:
- Das Monopol, das aus der Konzentration erwachsen sind, also die „Monopolverbände der Kapitalisten, die Kartelle, Syndikate und Trusts“;
- Haben diese Monopole zur „Besitzergreifung der wichtigsten Rohstoffquellen geführt“, was die „Macht des Großkapitals ungeheuer gesteigert hat“;
- Das Monopol, dass aus den Banken erwachsen ist, welches die „bescheidenen Vermittlungsunternehmungen zu Monopolisten des Finanzkapitals gewandelt“ hat;
- Das Monopol das aus der Kolonialpolitik erwachsen ist. Neben den alten Motiven der Kolonialpolitik „fügt das Finanzkapital noch den Kampf um Rohstoffquellen hinzu, um Kapitalexport, um „Einflußsphären“ (Lenin 1917, S. 304f.).
Lenin gelingt es mit seiner Untersuchung, das Wesen des Imperialismus aufzudecken, indem er die gesetzmäßige Konzentration beschreibt, die zum Finanzkapital führt, und dieses mit seiner Erscheinung vermittelt – das Verhältnis zwischen beiden aufzudecken. Seine Analyse verläuft von allgemeinen Bestimmungen zu den konkreten Erscheinungsformen, wie der Konkurrenz der ‚Staatsmonopole‘, aber auch zu den veränderten Kampfbedingungen der Arbeiterklasse durch die entstehende Arbeiteraristokratie. So führt seine Analyse zu einem konkret-allgemeinen Begriff des Imperialismus.
Lenin konnte seine Verallgemeinerungen nur deshalb vornehmen, weil er sich intensiv mit dem Forschungsstand seiner Zeit auseinandersetzte. Er war mit der Wissenschaft seiner Epoche bestens vertraut, was ihm erst die Möglichkeit gab, die unterschiedlichsten Texte kritisch zu bewerten. Sein Ziel war jedoch keine bloß empirische Auseinandersetzung mit dem Imperialismus. Vielmehr richtete er seinen Blick bei seinen Verallgemeinerungen stets auf das Subjekt bzw. den subjektiven Faktor. Dies zeigt sich nicht nur in der Art und Weise, wie Lenin das Herrschaftssystem des Finanzkapitals beschreibt, sondern auch in seiner Analyse der gesellschaftlichen Folgen, die für seinen Imperialismusbegriff zentral sind – insbesondere unter den Begriffen „Parasitismus“ und „Fäulnis“.
Die Leistung von Lenins Imperialismus-Broschüre besteht demnach in seiner profunden Beschäftigung mit den Debatten seiner Zeit, die ihm die Begriffsentwicklung in seiner Arbeit ermöglichte. Das hier präsentierte Material von Lenin (was definitiv ausgeweitet werden könnte), zeigt, dass Lenin diese begriffliche Arbeit ermöglichte, die Aufgaben der Arbeiterklasse zu bestimmen. Dies könnte z.B. anhand Lenins Veröffentlichungen über die nationale Frage und die programmatische Diskussion innerhalb der SDAPR aufgezeigt werden. Der Begriff vom Imperialismus war die Voraussetzung dafür, politisch adäquate Losungen zu formulieren. Die Zwangsläufigkeit dieses Zusammenhangs hat spätestens die Oktoberrevolution der Welt praktisch unter Beweis gestellt.
Um an Lenin anknüpfen zu können, ist es von großer Bedeutung, den Verlauf der Imperialismusdebatte zu verstehen, wie auch die Entwicklung der internationalen Verhältnisse selbst. Im ersten Kapitel wurde knapp ausgeführt, dass die Definition eines Begriffs (demnach auch die des Imperialismus) nichts Abgeschlossenes darstellt. Vielmehr verändern sich Begriffe stets. Dies ermöglicht eine genauere Widerspiegelung des Untersuchungsgegenstandes. Die Begriffsentwicklung ist dabei vor allem von der Entwicklung des Widerspiegelungsobjekts selbst bedingt.
Bereits der Ausgang und die Folgen des Zweiten Weltkriegs brachten tiefgreifende internationale Veränderungen mit sich. Dies zeigt sich auch in den Studien über den Imperialismus in den sozialistischen Ländern, auf die gesondert eingegangen werden muss. Zu jener Zeit rechnete wahrscheinlich niemand damit, dass der Sozialismus (sobald er erreicht ist) auch wieder scheitern oder besiegt werden könnte. Die Konterrevolution stellt eine der größten Zäsuren der Geschichte dar und stellt eine schwere Niederlage für die Arbeiterklasse dar. Auch die Auswirkungen dieser Entwicklung auf den Imperialismus und sein Weltsystem müssen berücksichtigt und untersucht werden – was bereits vielfach in der kommunistischen Bewegung geschehen ist.
Lenins Charakterisierung des Finanzkapitals liefert bereits wichtige Hinweise darauf, dass eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Thema Neokolonialismus von großer Bedeutung ist. Ein genaues Verständnis der von ihm beschriebenen Argumente und Prozesse ist entscheidend, um die heutige Herrschaft des Finanzkapitals besser zu begreifen.
All dies kann nicht die Arbeit eines Einzelnen sein, sondern nur das Ergebnis einer kollektiven Anstrengung. Diese Anstrengung ist notwendig, damit wir als kommunistische Bewegung wieder einen Begriff vom Imperialismus unserer Zeit entwickeln, der sich strategisch in unseren Kampforientierungen niederschlägt. Wenn wir diese Anstrengung ernst nehmen, dann beseitigen wir auch die religiösen Dogmen, die im Umgang mit unseren Klassikern existieren, und können an ihrer Arbeit anknüpfen, anstatt sie zu fetischisieren.
Schlussbemerkung
Dieser Artikel konnte lediglich einen groben Überblick über einige Aspekte der historischen Imperialismusdiskussion bieten. Viele der hier angesprochenen Themen ließen sich weiter vertiefen. Trotz der vermutlich an vielen Stellen eher schlaglichtartigen Betrachtung sollte die Ebene von Lenins Analyse und Argumentation deutlich geworden sein. Wenn es der Artikel geschafft hat, dem Leser den einen oder anderen neuen Aspekt aufzuzeigen oder ihn dazu anzuregen, sich mit den hier präsentierten Texten sowie weiteren Texten aus Lenins Heften zum Imperialismus oder mit aktuelleren Veröffentlichungen auseinanderzusetzen und vielleicht sogar der hier entwickelten Argumentation etwas entgegenzusetzen, dann hat dieser Artikel seinen Zweck erfüllt.
Literaturverzeichnis
Bucharin, Nikolai (1915): Imperialismus und Weltwirtschaft. Frankfurt (Main): Verlag Neue Kritik.
Engels, Friedrich (1895): Ergänzungen und Nachtrag zum III. Buch des ‚Kapitals‘. In Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 25, S. 897–919, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1975): Vorarbeiten zum ‚Anti-Dühring‘. In Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 20, S. 573–96, Berlin: Dietz Verlag.
Harvey, David (2005): Der neue Imperialismus, Hamburg: VSA-Verlag.
Hilferding, Rudolf (1910): Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngsten Entwicklungen des Kapitalismus, Berlin: Dietz Verlag.
Hobson, John A. (1902): Der Imperialismus, 2. Auflage, Köln/Berlin: Verlag Kiepenheuer & Witsch.
Hölscher, Reinhold (2018): Kontokorrentkredit, https://www.gabler-banklexikon.de/definition/kontokorrentkredit-59300.
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (1972): Vorwort Hefte zum Imperialismus, In Lenin-Werke (LW), Bd. 39, S. VII–XVII, Berlin: Dietz Verlag.
Jeidels, Otto (1905): Das Verhältnis der deutschen Großbanken zur Industrie. Mit besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie, Leipzig: Verlag von Duncker & Humbolt.
Kautsky, Karl (1914): Der Imperialismus, Die Neue Zeit, Nr. 32–II, S. 908–22.
——— (1915): Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund, Nürnberg: Verlag und Druck der fränkischen Verlagsgesellschaft & Buchdruckerei G.m.b.H.
Klaus, Georg/Buhr Manfred (1975): Philosophische Wörterbuch, 11. Auflage, Bd. 1. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
Kondakow, N. I. (1978): Wörterbuch der Logik, Hsgb. Albrecht, Erhard/Asser, Günter, Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
Kumpf, Fritz (1968): Probleme der Dialektik in Lenins Imperialismus-Analyse. Eine Studie zur dialektischen Logik, Deb Verlag das europäische Buch.
Lenin, Wladimir Iljitsch (1899): Die rückläufige Richtung in der russischen Sozialdemokratie, In Lenin-Werke (LW), Bd. 4, S. 249–79, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1909): Empiriokritizismus und historischer Materialismus. Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie, In Lenin-Werke (LW), Bd. 14, S. 7–366, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1915a): Sozialismus und Krieg (Die Stellung der SDAPR zum Krieg), In Lenin-Werke (LW), Bd. 21, S. 295–341, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1915b): Vorwort zu N. Bucharins Broschüre ‚Weltwirtschaft und Imperialismus“, In Lenin-Werke (LW), Bd. 22, S. 101–106, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1916a): Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung, In Lenin-Werke (LW), Bd. 22, S. 144–59, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1916b): Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den „imperialistischen Ökonomismus“, In Lenin-Werke (LW), Bd. 23, S. 18–71, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1916c): Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus, In Lenin-Werke (LW), Bd. 23, S. 102–18, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1917): Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Gemeinverständlicher Abriß, In Lenin-Werke (LW), Bd. 22, S. 189–309, Berlin: Dietz Verlag.
——— (1972): Hefte zum Imperialismus, In Lenin-Werke (LW), Bd. 39, Berlin: Dietz Verlag.
Luxemburg, Rosa (1913): Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, In Gesammelte Werke 5. Ökonomische Schriften, S. 5–411, Berlin: Dietz Verlag.
Marx, Karl (1894): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Dritter Band: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion, In Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 25, S. 33–919m Berlin: Dietz Verlag.
Patnaik, Utsa/Patnaik, Prabhat (2023): Eine Theorie des Imperialismus, Kassel: Magroven Verlag.
Rauscher, Marion (2013): Emissionsgeschäft, https://www.gabler-banklexikon.de/definition/emissionsgeschaeft-57479.
„1. Trustgesellschaften zur Gründung, Beherrschung usw. von Unternehmungen einer bestimmten Industrie des Inlands oder Auslands, insbesondere im Eisenbahnwesen, der Brauerei […]. 2. Trustgesellschaften, von einer einzelnen industriellen Unternehmung zu dem Zweck gegründet, deren Tätigkeitsgebiet durch Erwerb oder Errichtung verwandter Gesellschaften zu erweitern […]. 3. Gründungsgesellschaften im eigentlichen Sinn, mit dem spekulativen Zweck geschaffen, industrielle Unternehmungen aller Art ins Leben zu rufen, zu erwerben usw. […]. […] Die Brauchbarkeit der Trustgesellschaften für die Großbanken als Werkzeuge der Expansion ist je nach ihrem Charakter verschieden. Die zweite Art, die im Dienst eines einzelnen industriellen Unternehmens steht, scheidet naturgemäß aus: die Beziehung der Großbanken zu ihnen fällt schon unter die Industrietätigkeit der Banken, eine solche Trustgesellschaft ist nicht Organ, sondern Kunde der Großbank. Die dritte Art, die eigentliche Gründungsgesellschaft, ist fast immer von spekulativen Privatbankiers oder kleineren Aktienbanken ins Leben gerufen, sie will die große Masse kleiner und mittlerer Industrieunternehmungen dem großen Kapital zugänglich machen, ihr Gewinn ist ebenso spekulativ und unsicher wie ihr Risiko erheblich […]. Man kann diesen Typus von Gesellschaften dahin charakterisieren, daß sie den Boden ebnen für die Großbanken; sie ziehen industrielle Unternehmungen in den Strudel des Kapitalmarkts hinein, aus dem die Banken sie dann herausfischen (Jeidels 1905, S. 77f.).“
Aus Lenins Hefte zum Imperialismus geht der Stellenwert von Jeidels Arbeit, für Lenins Imperialismus-Broschüre deutlich hervor. In seinem Exzerpt zu Jeidels vermerkt Lenin zu Beginn: „Sobald Jeidels auf das Verhältnis zur Industrie zu sprechen kommt, ist sein Buch reichhaltiger, lebendiger, klüger, wissenschaftlicher (Lenin 1972, S. 143).“ In der Planskizze zur Imperialismusschrift wird Jeidels für das Kapitel über die Banken unter den Punkten der Bankkonzentration, der Verschmelzung mit der Industrie, den Aufsichtsräten und dem universellenCharakter der Banken angeführt (ebd., S. 221f.).
Unter diesem Gesichtspunkt ist im dritten Band des Kapitals der fünfte Abschnitt (Spaltung des Profits in Zins und Unternehmensgewinn. Das zinstragende Kapital) von besonderem Interesse. Marx führt aus, wie durch den Kredit das Kapital zu einer Ware wird, deren Gebrauchswert in einem Teil des Profits besteht, den das verliehene Kapital in der Produktion abwirft. Dieser Teil des Profits, den der Industrielle an den Bankier zahlt, definiert Marx als Zins (Marx 1894, S. 350f.). Der Geldbesitzer, der sein Geld als zinstragendes Kapital verwerten will, wirft es in die Zirkulation und macht sein Geld zur Ware als Kapital. Er verleiht für eine bestimmte Zeit sein Geld an einen Dritten unter der Voraussetzung, dass es nach einem bestimmten Zeitpunkt als realisiertes Kapital wieder zu ihm zurückgelangt (ebd., S. 355f.). Der Zinsfuß beschreibt den Preis der Ware Kapital. Dieser berechnet sich auf Basis der allgemeinen Profitrate (ebd., S. 377f.). Marx spricht auch über die Entstehung von Aktienunternehmen, durch die die Verwaltungsarbeit in einem Unternehmen zunehmend vom Besitz des Kapitals getrennt wird (ebd., S. 401). Später heißt es in Bezug auf die Entwicklung des Kreditsystems: „Es ist dies die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise selbst, und daher ein sich selbst aufhebender Widerspruch, der prima facie als bloßer Übergangspunkt zu einer neuen Produktionsform sich darstellt. Als solcher Widerspruch stellt er sich dann auch in der Erscheinung dar. Er stellt in gewissen Sphären das Monopol her und fordert daher die Staatseinmischung heraus. Er reproduziert eine neue Finanzaristokratie, eine neue Sorte Parasiten in Gestalt von Projektenmachern, Gründern und bloß nominellen Direktoren; ein ganzes System des Schwindels und Betrugs mit Bezug auf Gründungen, Aktienausgabe und Aktienhandel. (ebd., S. 454).“ Marx deckt in seiner Auseinandersetzung mit dem zinstragenden Kapital bereits die Bewegung vom Geldverleih in Richtung Monopol auf und analysiert die Folgen dieser Entwicklung – dem Parasitismus einer Finanzaristokratie.
Emissionsgeschäfte beschreibt die Emission von Wertpapieren durch Kreditinstitute (Rauscher 2013). Kontokorrentkredite sind ein Kredit an Unternehmen, der der Finanzierung der Produktion und Bereitstellung von Gütern dient (Hölscher 2018).
An dieser Stelle sei angemerkt, dass Lenins Konspekt von Jeidels Buch in Bezug auf die sich entwickelnde Beziehung zwischen Großbank und Großindustrie deutlich ausführlicher ausfällt (vgl. Lenin 1972, S. 144-148) als seine Notizen zu Hilferding (ebd., S. 332). Auch finden sich in seinem Konspekt zu Hilferding in den Abschnitten zu der Beziehung von Banken und Industrie mehrfach ein Verweis auf Jeidels – so z.B. explizit in Bezug auf die Aufsichtsratstellen (Lenin 1972, S. 332). Die Unterschiede in den Konspekten lassen darauf schließen, dass Jeidels in der Frage der Verschmelzung durch Beteiligung usw. einen höheren Stellenwert für Lenin besaßen.
Lenin kommentierte diese Stelle bei Jeidels mit der Bemerkung „übliche Geschichte!!“ (Lenin 1972, S. 144).
In seiner Imperialismus-Broschüre gibt Lenin ein Zitat wieder, was aus Jeidels Untersuchung stammt, in der ein Brief einer Berliner Bank an ein deutsches Zementsyndikat angeführt wird, um den Bankenterror zu charakterisieren (Jeidels 19015, S. 126; Lenin 1917, S. 227).
Lenin greift den Punkt des Beherrschens am Schluss eines Konspektes zu Hilferding auf und vermerkt „Finanzkapital = Bankkapital, das die Industrie beherrscht“ schreibt dann aber weiter „genügt nicht: „Finanzkapital = Bankkapital“?“ und führt dann die „Drei wichtigsten Momente“ aus – auf die noch eingegangen wird (Lenin 1972, S. 335).
In Lenins Heft Zur Frage des Imperialismus findet sich ein Interessanter vermerk, in dem Lenin auf diese „Handvoll“ eingeht und sie genauer bestimmt. Er Kategorisiert insgesamt acht Länder. Die erste Kategorie nennt Lenin „die drei ausschlaggebenden (völlig selbständigen) Länder“ und notiert England, Deutschland und die Vereinigten Staaten. Die zweite Kategorie betitelt er mit „zweitrangige (erstklassige, aber nicht völlig selbstständige)“ und listet Frankreich, Russland und Japan auf. Um die ersten beiden Kategorien macht Lenin eine Klammer mit dem Vermerk „diese 6“. Außerhalb der Klammer führt er eine dritte Kategorie ohne Titel an unter der er Italien und Osterreich-Japan anführt (Lenin 1972, S. 186). Lenins Notiz ist deshalb interessant, da aus ihr eine Hierarchisierung der imperialistischen Mächte hervorgeht und teilweise eine Charakterisierung als „nicht völlig selbstständig“.
Bei Lenin findet sich eine Passage, in der er über den Zusammenhang von Kolonien und Kapitalexport spricht und den „englischen Kolonialimperialismus“ vom französischen „Wucherimperialismus“ unterscheidet (Lenin 1917, S. 247).
Auf der Seite ist eine Tabelle abgedruckt, die die Verteilung von Kolonien zeigt. Von den insgesamt 136 Kolonien besaß Großbritannien 50, gefolgt von Frankreich mit 33. An dritter Stelle findet sich Deutschland mit 13. Hieran wird gut ersichtlich warum Lenin vom „englischen Kolonialimperialismus“ sprach im Unterschied zum französischen „Wucherimperialismus“ (Lenin 1917, S. 247).
Lenin führt als Beispiel Portugal an: „Portugal ist ein selbstständiger, souveräner Staat, aber faktisch steht es seit mehr als 200 Jahren, seit dem spanischen Erbfolgekrieg (1701 – 1714), unter dem Protektorat Englands (Lenin 1917, S. 268).“